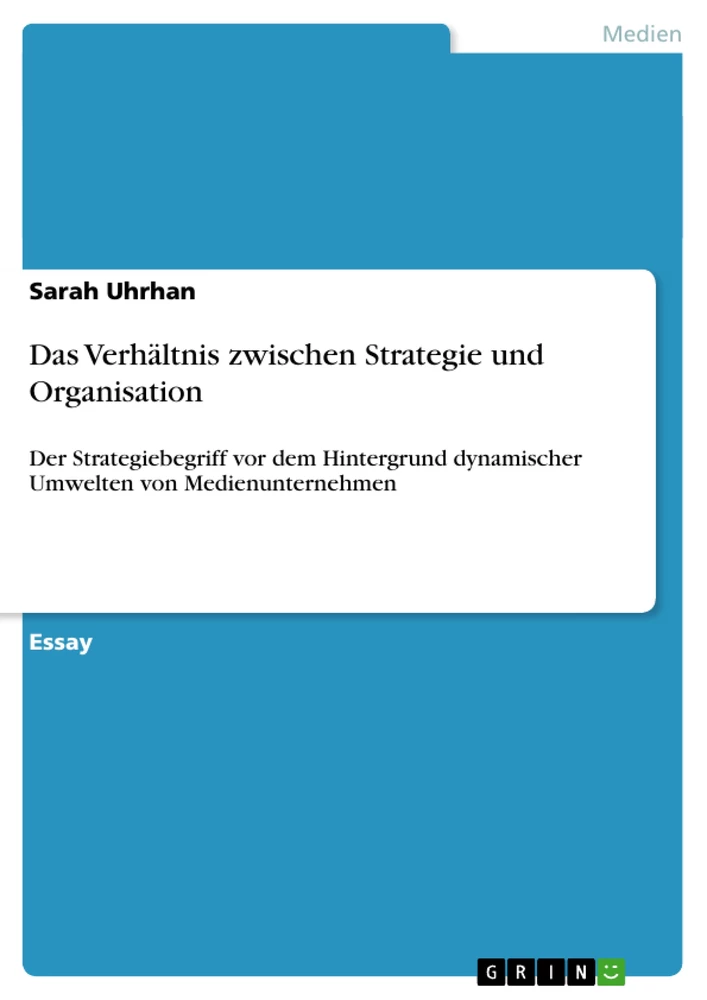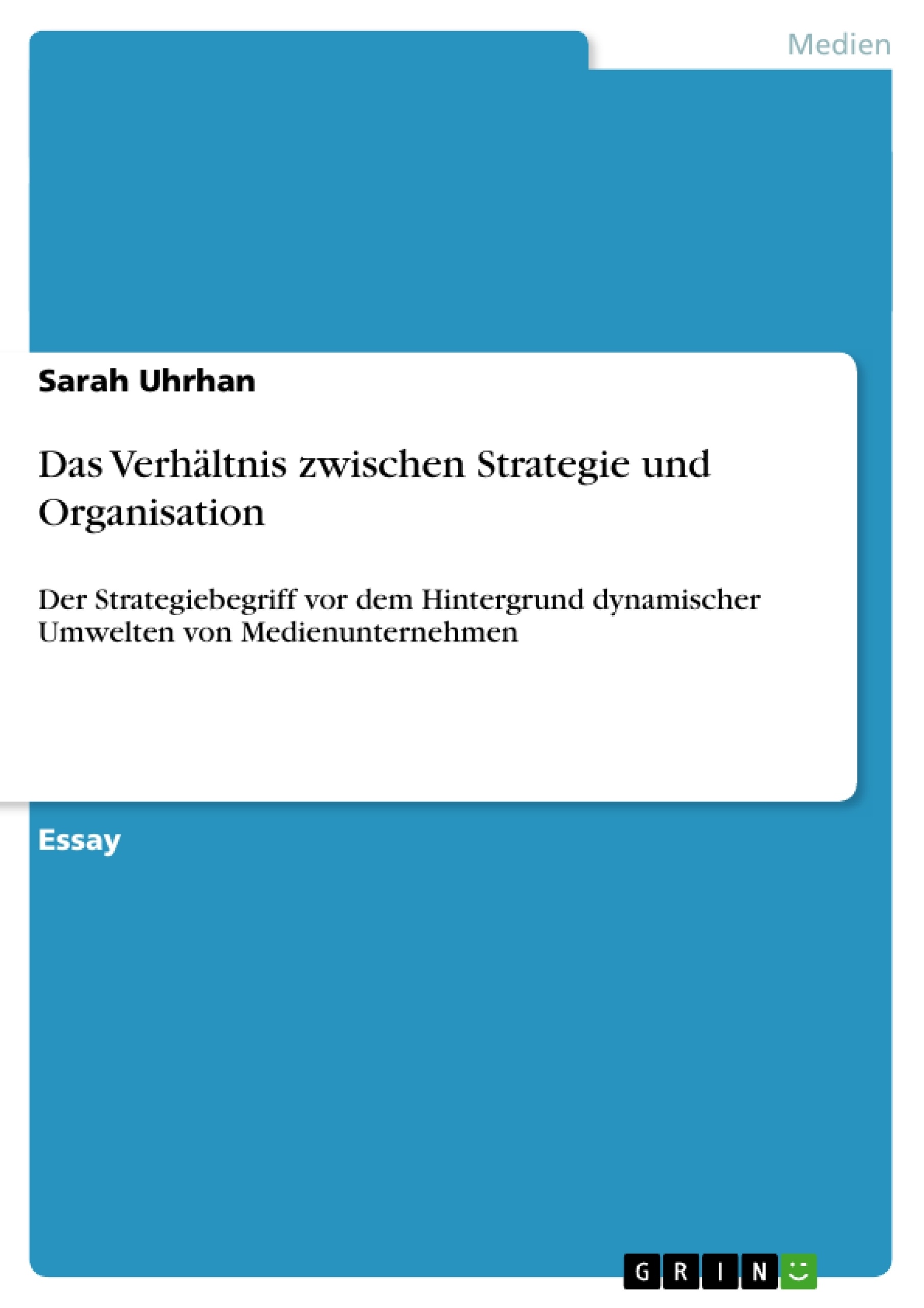Ausgehend von Schreyöggs Lehrbuch 'Organisation. Grundlagen moderner Organisationsgestaltung' (2008) findet eine kritische Betrachtung des unternehmensstrategischen Ansatzes statt. Das klassische Verständnis des Strategie-Begriffs wird vor dem Hintergrund einer dynamischen und komplexen Umwelt von Medienunternehmen aufgrund von Globalisierung, Individualisierung und Mediatisierung reflektiert und erweitert.
Jede Organisation ist in eine komplexe Umwelt eingebettet, innerhalb welcher sie agiert und von der sie beeinflusst wird. Dabei ist jede Organisation Teil der Umwelt eines anderen Systems. Aufgrund der Interdependenzen zwischen Umwelt und Organisation ist es wichtig, sich mit dem Verhältnis von Umwelt zur Organisation auseinanderzusetzen, um das System der Organisation langfristig zu erhalten. Über die Grenzziehung zwischen innen und außen, also der Organisation und seiner Umwelt, wird die Komplexität reduziert, um auf diese Weise gezieltes Handeln innerhalb der Organisation zu ermöglichen und die Organisation näher gestalten zu können. Doch ist es schwierig, diese Grenze eindeutig festzulegen, da Organisationen keine natürlichen objektiv feststellbare Grenzen aufweisen.[1] Luhmann geht davon aus, dass es sich bei einer Organisation immer um ein selbstreferentielles soziales System handelt, in der jedes Subjekt die Umwelt und die Organisation aus seinem eigenen kognitiven Denken und sozialen Verhaltensmustern heraus produziert.[2] Dies hat zur Folge, dass zwei Unternehmen, die in derselben Umwelt agieren, diese ganz anders wahrnehmen können und die eigene Organisation entsprechend unterschiedlich gestalten. Weick bezeichnet diesen Prozess der Selektion und anschließender Organisationsgestaltung als ‚sense-making’.[3] Strategie stellt nun ein Mittel dar, diesen Prozess des ‚sense-making’ anzustoßen, Grenzen zwischen der Organisation und Umwelt zu ziehen und langfristig zu bewahren.
Der unternehmensstrategische Ansatz zählt zu den Umweltinteraktions-Ansätzen und geht von einem wechselseitigen Verhältnis zwischen Umwelt und Organisation aus. Umwelt wird sowohl als Bedrohung als auch als Chance gesehen. So kann eine falsche Einschätzung der Umwelt zum Misserfolg führen, eine erfolgreiche Strategie jedoch Marktanteile und somit Marktmacht generieren.[4] Erschwert wird die Strategieplanung durch Umweltdynamiken, da nur schwer Prognosen zu künftigen Veränderungen der Umwelt getroffen werden können. Eine gewählte Strategie unterliegt somit einer ständigen Bewährungsprobe. Unter dem Begriff Strategie versteht man generell ein „unternehmensintern entwickeltes Leitkonzept zur Bestimmung des Verhältnisses von Unternehmung und Umwelt“[5], das dazu dient, Tätigkeitsbereiche und Kompetenzen einer Organisation festzulegen sowie Wettbewerbsvorteile zu erschaffen, um hierdurch das System in einem fordernden Umfeld zu erhalten.[6] Klassischerweise begreift man Strategie als etwas Statisches, das von einem Unternehmen besitzt und eingesetzt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Strategiebildung erfolgt in der Regel durch Manager mithilfe von Situationsanalysen (SWOT-Analyse), die Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens, wie beispielsweise Unterschiede im Know-how, der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder dem Zugang zu kritischen Ressourcen, den Chancen und Risiken der Umwelt, technologischer, ökonomischer, regulativer und gesellschaftlicher Art, gegenüberstellen[7], um „aus der Vielzahl der Möglichkeiten und Risiken eine auf die spezifischen Stärken der Unternehmung zugeschnittene Strategie zu finden.“[8] Im klassischen Ansatz ist Strategie folglich das Ergebnis eines linearen, bewussten und analytisch-rationalen Entscheidungsprozesses, aus dem konkrete Handlungsempfehlungen an die Organisation und ihre Mitarbeiter abgeleitet werden, wodurch eine hierarchische Unternehmensstruktur begünstigt wird. Henry Mintzberg äußert Kritik am rationalen Charakter dieses Strategiebegriffs und weist darauf hin, dass die realisierte Strategie nie der geplanten entspreche, da sie auch das emergente Resultat bestimmter Handlungsweisen der Organisation darstelle.[9] So können Manager als Entscheidungsträger bei der Auswahl von Strategien die Analyse durch ihre Persönlichkeitsmerkmale und subjektive Wahrnehmung verzerren und beeinflussen.
[...]
[1] Vgl. Schreyögg (2008): 253 ff.
[2] Vgl. Schreyögg (2008): 255 f.
[3] Vgl. Schreyögg (2008): 256
[4] Vgl. Schreyögg (2008): 312
[5] Schreyögg (2008): 312
[6] Vgl. Müller-Stewens (2013): www
[7] Vgl. Schreyögg (2008): 313
[8] Schreyögg (2008): 314
[9] Vgl. Schreyögg (2008): 315
- Quote paper
- Sarah Uhrhan (Author), 2013, Das Verhältnis zwischen Strategie und Organisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269773