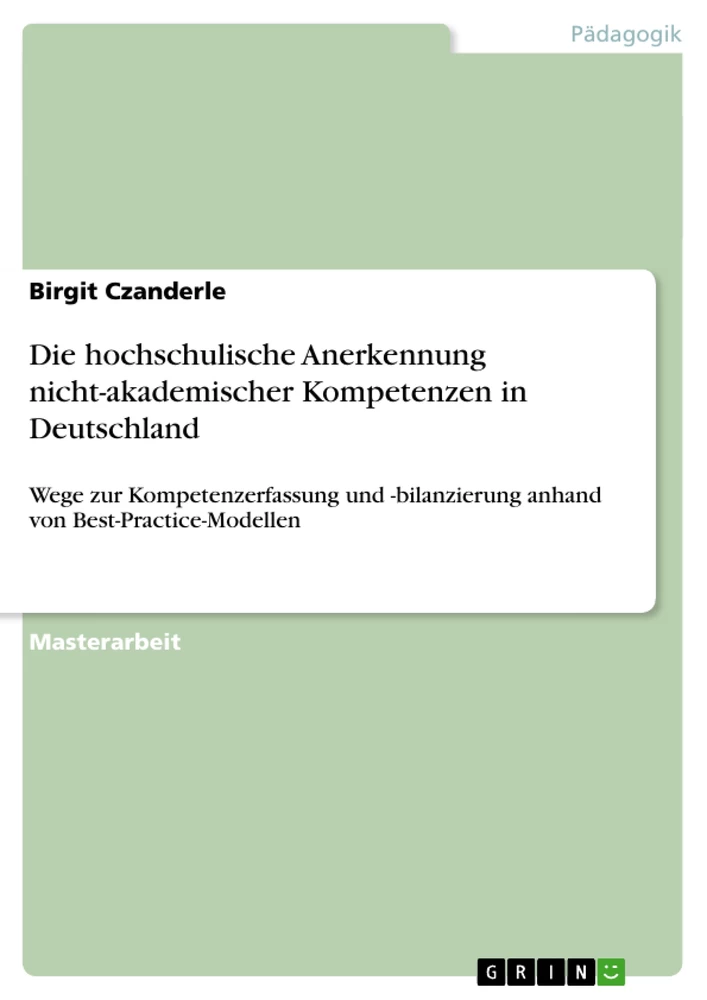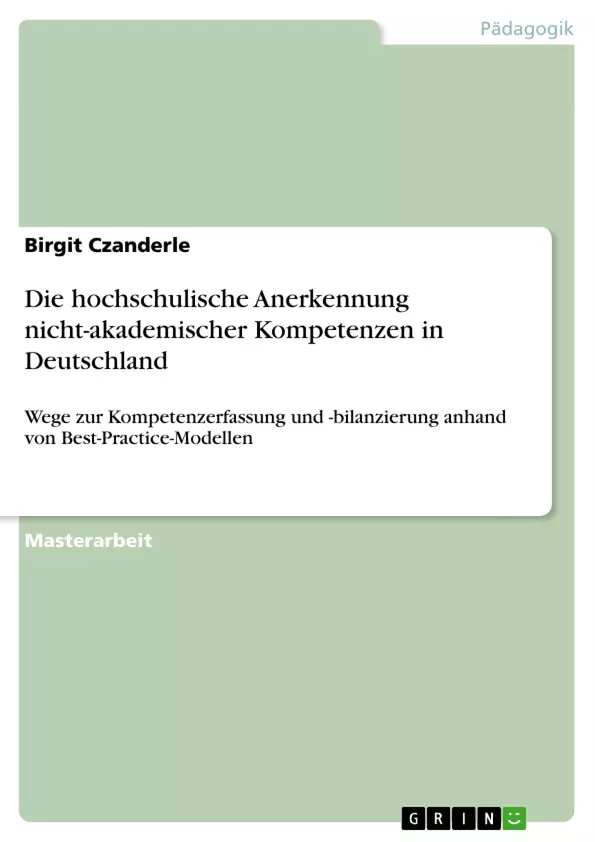Die Hochschullandschaft in Deutschland ist nicht nur durch die im Bologna-Prozess angestoßenen Reformen im Umbruch. Auch seitens der Zusammensetzung der Studierenden ist ein erhebliches Veränderungspotenzial zu erkennen. Und damit sind lediglich zwei Veränderungsprozesse in der deutschen Hochschullandschaft genannt.
Die Studierendengruppe wird zunehmend heterogener und auch die Kompetenzen, die die Studierenden mit in einen Studiengang bringen, lassen sich nicht mehr klar differenzieren. Die Tendenz, dass eine Berufs- und Bildungsbiographie im Laufe eines lebenslangen Lernens im akademischen Sektor mündet, wird zunehmend größer. Diese Durchlässigkeit ist wünschens- und erstrebenswert, markiert jedoch auch einen Paradigmenwechsel in der deutschen Bildungslandschaft. Im Rahmen dieses Paradigmas ist unweigerlich anzuerkennen, dass unterschiedliche Lernorte zu vergleichbaren Lernergebnissen führen können und dass unterschiedliche Bildungswege anschlussfähig gemacht werden müssen.
Aufgrund dieser Tendenzen stellen sich auch in der Studiengangsgestaltung neue Herausforderungen ebenso wie auf bildungspolitischer Ebene. Wie soll mit den Kompetenzen dieser genannten neuen Studierendengruppe umgegangen werden? Diese mit Nichtbeachtung zu versehen, wäre weder effizient noch gesellschaftlich durchsetzbar. So stehen die Hochschulen also vor der Herausforderung, einen transparenten und qualitätsgesicherten Weg zu finden, wie mit bereits erworbenen nicht-akademischen Kompetenzen innerhalb eines Studiums umgegangen werden kann. Doch was ist unter Kompetenzen überhaupt zu verstehen? Und inwiefern werden die Hochschulen bei Ihrer Aufgabe bildungspolitisch unterstützt? Der Anspruch dieser Studierendengruppe lässt sich aus den europäischen Bildungsreformen ableiten. Dies wirft die Frage auf, wie damit auf nationaler Ebene umgegangen wird und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Rechtliche Rahmen jedoch alleine genügen kaum, um eine operative Durchführbarkeit in die Wege zu leiten. Aus dieser Fragestellung heraus sind bildungspolitische Initiativen zu nennen, die hierzu mögliche Instrumentarien entwickelt haben. Auf der Basis dieser Entwicklungen gab es auf Bundesebene geförderte Projekte, die sich mit der Operationalisierbarkeit im Rahmen von Modellentwicklungen auseinander gesetzt bzw. Entwicklungen angestoßen haben. Diese sollen evaluiert werden und eine gemeinsame Wissensbasis geschaffen werden.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1 .1 Einführung, Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
1 .2 Aufbau und Methodik der Arbeit
2. Anerkennung von Kompetenzen – Historie und Verständnis des Kompetenzbegriffes
2 .1 Der Begriff der Anerkennung und seine Abgrenzung
2 .2 Historie des Kompetenzbegriffes
2 .3 Der Kompetenzbegriff
2 .4 Abgrenzung verwandter Begriffe
2 .5 Kompetenzmodelle
2 .5.1 Kompetenzniveaumodelle
2 .5.2 Kompetenzstrukturmodelle
3. Kompetenzerfassung und -bilanzierung
3 .1 Kompetenzerfassung, -messung und -diagnostik
3 .2 Kompetenzbilanzierung
3 .3 Methoden und Instrumente für die Praxis
4. Aufgaben der Hochschulen – Ursprünge und bildungspolitische Lösungsansätze
4 .1 Allgemeine Tendenzen
4 .2 Bologna-Prozess
4 .3 Kopenhagen-Prozess
4 .4 Verschränkungen von Bologna- und Kopenhagen-Prozess
4 .5 Lissabon-Konvention
4 .6 Maastricht-Kommuniqué
4 .7 Bildungspolitische Lösungsansätze bzw. Konzepte
4 .7.1 Ziele und Entwicklungen von Qualifikationsrahmen
4 .7.2 Der Europäische Qualifikationsrahmen
4 .7.3 Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) – Theoretische Fundierung und Verbindungsmöglichkeiten zum ECTS im Kontext des deutschen Ablegerprojektes DECVET..
4 .7.4 Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)
4 .7.5 Fachqualifikationsrahmen – Entstehung, Nutzen und Grenzen
4 .7.6 Beschluss der Kultusministerkonferenz: Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium
5. Anerkennung und Durchlässigkeit in der Praxis – Potentiale und (operative) Schwierigkeiten..
5 .1 Durchlässigkeit zwischen Berufs- und Hochschulbildung – Rahmenbedingungen
5 .2 Problemstellungen in der Praxis
5 .3 ANKOM
5 .3.1 Zielstellungen und Historie des Projekts
5 .3.2 Anrechnungsverfahren
5 .3.3 Projektergebnisse und Ausblick
5 .4 Nexus
6. Best-Practice-Modelle in Deutschland
6 .1 Das Oldenburger Modell
6 .1.1 Ursprünge des Modells
6 .1.2 Individuelle und pauschale Anrechnung
6 .1.3 Äquivalenzvergleich und MLI
6 .1.4 Erfahrungswerte aus dem Modellprojekt
6 .2 Alice Salomon Hochschule Berlin - Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf die Hochschulausbildung von ErzieherInnen
6 .2.1 Darstellung der Projektierung
6 .2.2 Die Entwicklung des pauschalen Anrechnungsverfahrens
6 .2.3 Die Entwicklung des individuellen Anrechnungsverfahrens
6 .3 Pauschale Anrechnung an der Universität Potsdam
6 .4 APEL-Verfahren der Hochschule Fulda und der Universität Kassel
6 .5 Studica - Studieren à la Carte: Neue Formen des Zusammenwirkens von Hochschule und Praxis
7. Verwendbarkeit / Stärken - Schwächen der aufgezeigten Modelle
8. Ableitung von Empfehlungen / Ausblick
Anhang I.
Anlage 1: Bologna-Erklärung (1999) – Auszug
Anlage 2: Berliner Kommuniqué: „Den europäischen Hochschulraum verwirklichen“ (Auszug)
Anlage 3: Lissabon-Abkommen (1997)
Anlage 4: Die Stufen des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) nach Lernergebnissen
Anlage 5: Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.06.2002
Anlage 6: Empfehlung des BMBF, der HRK sowie der KMK
Anlage 7: Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für den Übergang von der beruflichen in die hochschulische Bildung
Anhang II
Fragebogen der qualitativen Kurzbefragung
Literaturverzeichnis
Bücher
Aufsätze in Zeitschriften
Aufsätze in Aufsatzsammlungen
Presseartikel / Forschungsberichte /Tagungsdokumentationen / Gesetzestexte
Internet-Quellen:
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
1.1 Einführung, Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
Die Hochschullandschaft in Deutschland ist nicht nur durch die im Bologna-Prozess angestoßenen Reformen im Umbruch. Auch seitens der Zusammensetzung der Studierenden ist ein erhebliches Veränderungspotenzial zu erkennen. Und damit sind lediglich zwei Veränderungsprozesse in der deutschen Hochschullandschaft genannt.
So sind es nicht mehr nur die klassischen Studierenden, die sich nach dem Abschluss des Abiturs oder der Fachhochschulreife auf den Weg in ein Studium begeben. Vielmehr ist - auch aus den Erfahrungen der Verfasserin - eine zunehmende Anzahl Studierender zu verzeichnen, die sich erst im Laufe Ihrer Bildungs- und Berufsbiographie für ein Studium entscheiden. Damit wird die Gruppe der Studierenden zunehmend heterogener und auch die Kompetenzen, die die Studierenden mit in einen Studiengang bringen, lassen sich nicht mehr klar differenzieren. Die Tendenz, dass eine Berufs- und Bildungsbiographie im Laufe eines lebenslangen Lernens im akademischen Sektor mündet, wird zunehmend größer. Diese Durchlässigkeit ist wünschens- und erstrebenswert, markiert jedoch auch einen Paradigmenwechsel in der deutschen Bildungslandschaft. Im Rahmen dieses Paradigmas ist unweigerlich anzuerkennen, dass unterschiedliche Lernorte zu vergleichbaren Lernergebnissen führen können und dass unterschiedliche Bildungswege anschlussfähig gemacht werden müssen.
Aufgrund dieser Tendenzen stellen sich auch in der Studiengangsgestaltung neue Herausforderungen ebenso wie auf bildungspolitischer Ebene. Wie soll mit den Kompetenzen dieser genannten neuen Studierendengruppe umgegangen werden? Diese mit Nichtbeachtung zu versehen, wäre weder effizient noch gesellschaftlich durchsetzbar. So stehen die Hochschulen also vor der Herausforderung, einen transparenten und qualitätsgesicherten Weg zu finden, wie mit bereits erworbenen nicht-akademischen Kompetenzen innerhalb eines Studiums umgegangen werden kann. Doch was ist unter Kompetenzen überhaupt zu verstehen? Und inwiefern werden die Hochschulen bei Ihrer Aufgabe bildungspolitisch unterstützt? Der Anspruch dieser Studierendengruppe lässt sich aus den europäischen Bildungsreformen ableiten. Dies wirft die Frage auf, wie damit auf nationaler Ebene umgegangen wird und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Rechtliche Rahmen jedoch alleine genügen kaum, um eine operative Durchführbarkeit in die Wege zu leiten. Aus dieser Fragestellung heraus sind bildungspolitische Initiativen zu nennen, die hierzu mögliche Instrumentarien entwickelt haben. Auf der Basis dieser Entwicklungen gab es auf Bundesebene geförderte Projekte, die sich mit der Operationalisierbarkeit im Rahmen von Modellentwicklungen auseinander gesetzt bzw. Entwicklungen angestoßen haben.
Diese Initiativen und Programme haben ihre Betrachtungen und Untersuchungen jedoch jeweils unter einen bestimmten Fokus gestellt haben, so dass an dieser Stelle zwar auf eine Vielzahl literarischer Quellen zurückgegriffen werden kann, die jedoch sehr versprengt und in unterschiedlichen Kontexten verortet sind. Auch Projekte, die sich mit einer generalistischen Aufgabenstellung der Thematik nähern, finden sich in der Literatur häufig nur in Aufsatzsammlungen und Sammelbänden oder Tagungsdokumentationen. Die bildungspolitische Grundlage wird hier zumeist als Wissensbasis vorausgesetzt. Für die operative Arbeit der Hochschulen stellt dies eine zunehmende Schwierigkeit dar, da ein Überblick über das Forschungsfeld nur schwer zu fassen ist. Gesetzliche Rahmenbedingungen sind lediglich aus sog. Grauer Literatur zu entnehmen ebenso wie Projektergebnisse und Empfehlungen.
Aus diesem Grund hat es sich die Verfasserin zur Aufgabe gemacht, einen Überblick über den Status Quo im Gestaltungsfeld der hochschulischen Anrechnung nicht akademischer Leistungen und damit verbunden der aktuellen Durchlässigkeit zu verfassen. Hierin sollen gleichzeitig aktuelle Forschungsprojektergebnisse bzw. Empfehlungen aus den bereits gewonnen Erfahrungen Eingang finden. Weder quantitative noch qualitative Erfahrungswerte aus bereits abgelaufenen Projekten sind durch Literatur zu generieren. Gleichzeitig soll durch die Konsolidierung der bereits vorhandenen wissenschaftlichen Daten und die Generierung eines wissenschaftlichen Überblicks die Sensibilisierung aller am Prozess der Durchlässigkeit und Anerkennung Beteiligten geschärft werden im Hinblick auf den bildungspolitischen Anspruch und eine Bereitschaft zur Anerkennung.
Im Hinblick auf diese Aufgabenstellungen sind jedoch, aufgrund der breit angelegten Thematik kleinere Einschränkungen vorzunehmen. So soll die Frage nach der Öffnung des Hochschulzugangs, die auch einen Teil von Durchlässigkeit ausmacht, lediglich am Rande angesprochen, aber nicht eingehender untersucht werden. Weiters muss eine Beschränkung auf die nationale Ebene stattfinden; entsprechend der Zielstellung der Arbeit soll hier vorrangig ein auf Deutschland bezogener Status Quo erarbeitet werden.
Um die Thematik näher zu beleuchten, ist es erforderlich im Kontext der Zielstellung den Aufbau der Arbeit und das methodische Vorgehen im Folgenden darzustellen.
1.2 Aufbau und Methodik der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich thematisch in einen theoretischen, einen empirischen sowie einen reflexiven Teil.
In Kapitel 2 wird die Thematik der Anerkennung von Kompetenzen theoretisch erarbeitet. Angefangen vom Begriff der Anerkennung und seiner Abgrenzung über die Historie des Kompetenzbegriffes wird schließlich der Versuch unternommen, den Begriff der Kompetenz zu definieren und diesen zu verwandten Begrifflichkeiten abzugrenzen. Daraus resultierend wird kurz auf zwei gängige Kompetenzmodelle Bezug genommen. Kapitel 3 befasst sich im Anschluss im Kontext der Anerkennung mit den Möglichkeiten der Kompetenzerfassung und –bilanzierung und geht dabei auch auf Methoden und Instrumente für die praktische Arbeit ein. Kapitel 4 schlägt aus diesem ersten wissenschaftlich-theoretischen Teil die Brücke zu den Aufgaben der Hochschulen, die sich im Kontext der Forderung nach Anerkennung nicht-akademischer Kompetenzen stellen. Hier werden die europäischen Beschlussfassungen herangezogen, um diese Forderung begründen zu können. Daraus resultierend sollen bildungspolitische Lösungsansätze und Konzepte skizziert werden, die einen Anerkennungsprozess unterstützen sollen. Dazu gehören bekannte Konzepte wie EQR und DQR genauso wie der Beschluss der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2002. Für den gesamten theoretischen Teil bestand die Schwierigkeit in der Recherche der zugrunde liegenden Literatur. Zwar findet sich zahlreiche Literatur zu dieser Thematik, jedoch ist diese häufig eher versprengt in Aufsatzsammlungen bzw. innerhalb des Sektors der grauen Literatur und befasst sich mit der Themenstellung nicht mit ganzheitlichem Blickwinkel sondern mit einem bestimmten Fokus. Gleichzeitig war es erforderlich, die im Kontext des Themas relevanten Beschlussfassungen sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene zu recherchieren und zusammenzustellen.
Kapitel 5 führt in den empirischen Teil der Arbeit ein und betrachtet das Gestaltungsfeld der Anerkennung in der Praxis. Aufgezeigt werden sollen hier einerseits Potenziale, aber vor allem die sich operativ stellenden Schwierigkeiten. Was bedeutet Durchlässigkeit und welche Probleme und Hindernisse sind damit verbunden? Aus der langjährigen Erfahrung der Verfasserin konnten bereits erste Rückschlüsse auf operative Problemstellungen gezogen werden, die es an dieser Stelle jedoch zu belegen galt. Auch an dieser Stelle ist wissenschaftlich lediglich ein sehr fokussiert betrachtender Literaturbestand zu beklagen. Nach Vorstellung dieses Themenfeldes beschäftigt sich das Kapitel weiter mit zwei prominenten Projekten, die sich mit eben diesen Fragestellungen bereits auseinandergesetzt haben. Der empirische Teil der Arbeit kommt in Kapitel 6 zum Tragen, in dem verschiedene Best-Practice-Modelle untersucht werden. Hier waren verschiedene Schritte der empirischen Arbeit notwendig. In einem ersten Schritt galt es festzustellen, welche in den unterschiedlichen Projekten entwickelten Modelle sich tatsächlich als Best-Practice-Modelle eignen, d.h. welche Modelle finden in der Praxis tatsächlich Anwendung. Innerhalb dieser Recherchearbeit hat sich herausgestellt, dass die Mehrzahl der innerhalb der Förderprojekte entwickelten Modelle lediglich konzipiert, aber nicht implementiert wurden und sich daher nicht als Best-Practice-Modelle eignen. Nach der Identifikation der Best-Practice-Modelle galt es einerseits herauszuarbeiten, was eben diese Modelle im Kern ausmacht und wie deren Implementierungsstatus sich darstellt. Hierzu wurde einerseits auf hauptsächlich auf grauer Literatur basierenden Erkenntnissen aufgesetzt, andererseits wurden die Verantwortlichen der modellentwickelnden Hochschulen mittels einer eigens konzipierten Kurzbefragung aufgefordert, Auskunft über den jeweiligen aktuellen Status des Modells zu geben. Im Rahmen der Entwicklung des Fragebogens kristallisierten sich vier Fragen heraus, die bewusst, mit Ausnahme der ersten Frage, in offener Fragetechnik verfasst wurden, um mögliche Antworten so wenig wie möglich einzugrenzen. Das Interesse und damit der Rücklauf zu dieser qualitativen Kurzbefragung erwiesen sich als positiv, so dass anhand der Rückläufe eine operative Bewertung der Modelle vorgenommen werden konnte. Dabei war der Kern des Interesses v.a. auf den operativen Nutzen gerichtet in Verbindung mit der Anzahl der Anerkennungsverfahren pro Zeiteinheit. Gleichzeitig wurden Erwartungen und mögliche Verbesserungspotenziale abgefragt – Daten, die bisher literarisch nicht gezielt erfasst wurden.
Die letzten beiden Kapitel 7 und 8 bilden den reflexiven Teil der vorliegenden Abhandlung und befassen sich aufbauend auf den Erkenntnissen des empirischen Teils mit den Stärken und Schwächen der Modelle bzw. deren Verwendbarkeit und Übertragbarkeit im Rückschluss auf die erarbeiteten theoretischen Grundlagen zu Beginn der Arbeit sowie einer Ableitung von Empfehlungen und einem Ausblick auf weitere Forschungsfelder, die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht werden konnten.
2. Anerkennung von Kompetenzen – Historie und Verständnis des Kompetenzbegriffes
2.1 Der Begriff der Anerkennung und seine Abgrenzung
OECD und EU verwenden für den deutschen Begriff der „Anerkennung“ unterschiedliche Begriffe, die auch gleichzeitig eine unterschiedliche inhaltliche Fokussierung deutlich machen. Während die OECD von „Recognition“ spricht, ist auf der Ebene der EU von „Validation“ die Rede. Definitionen zu diesen drei Begrifflichkeiten finden sich im Glossar zu den „Europäischen Leitlinien für die Validierung nicht formalen und informellen Lernens“, die im Folgenden wiedergegeben werden (vgl. Gutschow, 2010, S. 11).
Unter der „Anerkennung von Lernergebnissen“ verbirgt sich in diesem Kontext eine formelle Anerkennung des Wertes von Kompetenzen durch:
- das Verleihen von Qualifikationen
- das Verleihen von Entsprechungen, Anrechnungspunkten oder Urkunden, die Validierung vorhandener Kompetenzen und / oder
- gesellschaftliche Anerkennung, also die Anerkennung des Wertes von Kompetenzen durch Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft (vgl. CEDEFOP, 2009, S. 85).
Die „Validierung von Lernergebnissen“ meint die Bestätigung durch eine zuständige Behörde oder Stelle, dass die Lernergebnisse einer Person – unabhängig, ob diese in einem formalen, nicht formalen oder informellen Prozess erworben wurden – anhand festgelegter Kriterien bewertet wurden und den Anforderungen eines Validierungsstandards entsprechen. In der Regel führt die Validierung zur Zertifizierung (vgl. CEDEFOP, 2009, S. 89).
Unter der „Zertifizierung von Lernergebnissen“ steht ein Prozess, durch den formal bescheinigt wird, dass bestimmte Lernergebnisse einer Person durch eine zuständige Stelle oder Behörde anhand eines definierten Standards bewertet und validiert wurden. Die Zertifizierung führt stets zur Ausstellung eines Nachweises in Form von Diplomen oder Titeln (vgl. CEDEFOP, 2009, S. 90).
In der bildungspolitischen Landschaft findet sich als Synonym zur Anerkennung auch der Begriff der Anrechnung.
Die Anrechnung früher erbrachter Lernergebnisse führt zur Verkürzung nachfolgender Bildungszeiten, da die bereits in anderen Bildungskontexten erworbenen Kompetenzen im neuen Bildungsgang nicht nochmal gefordert werden. Dabei setzt die Anrechnung zumindest eine partielle Gleichartigkeit des Gelernten voraus, wodurch die Substituierbarkeit spezifischer Kompetenzen gegeben sein kann. (vgl. Weber, 2012, S. 180)
Von Anrechnung ist daher dann die Rede, wenn verpflichtende Lernleistungen eines Bildungsganges durch den Nachweis entsprechender Kompetenzen ersetzt werden können (vgl. Geldermann et al., 2009, S. 142)
Als Kern der Anrechnung oder Anerkennung sind also Kompetenzen zu identifizieren. Aus diesem Grund soll nun in den folgenden Abschnitten der Begriff der Kompetenz näher erläutert werden, zum einen im Hinblick auf seine historische Entwicklung, zum anderen aber auch in seiner eigenen Begrifflichkeit sowie in Abgrenzung zu verwandten Begrifflichkeiten. Außerdem sollen zwei vorrangig verwendete Kompetenzmodelle skizziert werden.
2.2 Historie des Kompetenzbegriffes
Auf sprachwissenschaftlicher Ebene findet sich der Ursprung des Kompetenzbegriffes im lateinischen Begriff competere, was so viel bedeutet wie zusammentreffen, zusammenkommen oder zustehen. Zunächst dient der Begriff in erster Linie juristischen Belangen in der römischen Rechtslehre und meint mit dem Adjektiv competens zuständig, befugt, rechtmäßig, ordentlich. Der Begriff bezieht sich im 18. und auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts insbesondere auf die Bedingungen der Urteilsfähigkeit einer Person. Eine weitere Wortbedeutung von Kompetenz geht ebenfalls auf die römische Rechtsprechung zurück und hat sich aus dem beneficium competentiae entwickelt, was heute dem Existenzminimum entspricht. Dies bezog sich im Mittelalter v.a. auf den Notbedarf des Klerikers, wurde im 19. Jahrhundert dann jedoch abgeleitet in eine militärische Verwendung des Wortes, wonach Kompetenz das meint, was Angehörigen von Heer und Flotte an Finanz- und Sachmitteln gewährt werden muss. (vgl. Grunert, 2012, S. 39)
In der Folgezeit findet der Kompetenzbegriff Einzug in weitere Wissenschaftsfelder, deren Konnotationen für das heutige Begriffsverständnis in den Sozialwissenschaften von Bedeutung sind. 1959 beschäftigt sich Robert W. White im Kontext der Motivationspsychologie damit und definiert Kompetenzen als grundlegende menschliche Handlungsfähigkeiten, die weder angeboren noch das Ergebnis von Reifeprozessen darstellen; Kompetenzen werden in der Anschauung nach White vom Individuum selbst in seiner Auseinandersetzung mit seiner Umwelt herausgebildet. (vgl. Grunert, 2012, S. 40)
In den 1960er Jahren führt der amerikanische Linguist Noam Chomsky den Kompetenzbegriff in die Kommunikationswissenschaften ein, dessen Ansatz erstmals auf die notwendige Unterscheidung zwischen Handlungsvoraussetzungen und der konkreten Handlungsdurchführung verweist (Kompetenz-Performanz-Modell). (vgl. Grunert, 2012, S. 41)
Pierre Bourdieu (1970) fasst diesen Ansatz Chomskys im Bereich der Sozialwissenschaften auf und betrachtet Kompetenz als generatives Potenzial zur Erzeugung sozialer Handlungen, das im Verlauf der Sozialisation erworben wird und damit nicht nur an das einzelne Individuum sondern auch zwingend an seine Umwelt gebunden ist. (vgl. Grunert, 2012, S. 42)
1973 befasste sich McClelland mit der Erfassung von „Kompetenzen“, verbunden mit der Hoffnung, eine bessere Passung zwischen pädagogisch-psychologischen Testinhalten und Anforderungen in realen Situationen und damit einhergehend eine bessere Vorhersage von Leistungsunterschieden innerhalb dieser Situationen zu erzielen. Inhaltlich definiert McClelland Kompetenzen als die für eine spezifische Tätigkeit notwendigen Voraussetzungen, nimmt jedoch selbst keine genauere konzeptuelle oder theoretische Klärung des Begriffs vor. Allerdings wird hier ein Schlüsselmerkmal deutlich: der stärkere Bezug zum wirklichen Leben. (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 6)
Auch Deci und Ryan beschreiben 1985 das Streben des Menschen nach Kompetenz und Selbstbestimmung als Grundbedürfnis und charakterisieren dies als notwendige Bedingung intrinsisch motivierten Verhaltens. (vgl. Grunert, 2012, S. 40)
2.3 Der Kompetenzbegriff
Obwohl uns der Begriff der Kompetenz in unserem Alltag allgegenwärtig scheint, so verwundert es doch sehr, dass dieser nicht klar definiert und eindeutig abgegrenzt dargestellt wird. (Erpenbeck, von Rosenstiel, S. IX) Beschäftigt man sich mit dem Kompetenzbegriff und seiner Verwendung, gewinnt man rasch den Eindruck, eines „uferlosen Ozeans“. Schon im Kontext der historischen Begriffsbetrachtung lassen sich unterschiedliche Facetten erahnen, die es nun herauszuarbeiten gilt.
So soll im nun Folgenden ein Überblick geschaffen werden über unterschiedliche Kompetenzdefinitionen und deren Verständnis und Verwendung mit dem Ziel, deutlich herauszustellen, dass ein einheitliches Begriffsverständnis nicht besteht. Um dies herauszuarbeiten, wurde auf verschiedenartigste Definitionen des Kompetenzbegriffs Bezug genommen, die jedoch in ihrer Diversität auch im thematischen Umfeld der Arbeit zu finden sind. Am Ende dieses Abschnittes soll sodann eine Definition herausgestellt werden, mit deren Verständnis im weiteren Verlauf dieser Abhandlung gearbeitet wird.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) begreift Kompetenzen als „Dispositionen zur Bewältigung bestimmter Anforderungen“ (KMK 2005, S. 16).
Gemäß dem OECD-Projekt DeSeCo (Defining an Selecting Key Competencies) lassen sich Kompetenzen wie folgt definieren:
„A competence is defined as the ability to successfully meet complex demands in a particular context. Competent performance or effective action implies the mobilization of knowledge, cognitive and practical skills, as well as a social and behavioral components such as attitudes, emotions, and values and motivations. A competence – a holistic notion - is therefore not reducible to its cognitive dimension, and thus the terms competence and skill are not synonymous.” (OECD 2003, S. 2)
Mit Hilfe dieser internationalen Definition wird deutlich, dass Kompetenzen zu verstehen sind als komplexe Verbindungen von Wissen, Fähigkeiten und Dispositionen, die situationsgerecht eingesetzt werden (vgl. Gnahs / Nuissl von Rhein, S. 117)
Der EQR versteht Kompetenz als nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und/oder methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und auch für die persönliche / berufliche Entwicklung zu nutzen. In diesem Sinne ist Kompetenz als Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben. (vgl. Gnahs / Nuissl von Rhein, S. 119)
Klieme et al (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 6f.) beziehen sich auf Weinert, der empfiehlt, Kompetenzen als kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen zu definieren. Eben diese Leistungsdispositionen lassen sich auch als Kenntnisse, Fertigkeiten oder Routinen charakterisieren. Damit wird eine weitere Einschränkung des Kompetenzbegriffs auf kognitive Leistungsdispositionen vorgenommen, wobei motivationale oder affektive Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln ausgeschlossen werden. Aus dieser Kontextabhängigkeit ergibt sich ein weiterer entscheidender Aspekt des Kompetenzbegriffs: Kompetenzen können oder müssen durch Lernen erworben werden. Dies impliziert, dass Kompetenzen erworben und durch äußere Einflüsse initiiert werden müssen (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 7).
Erpenbeck und von Rosenstiel verweisen auf McClelland, welcher sich im Jahr 1973 erstmals in der Psychologie um die Abgrenzung des Kompetenzbegriffes bemüht hat, da Kompetenzen offensichtlich nur anhand der tatsächlichen Performanz aufzuklären sind. Kompetenz ist also stets zu sehen als eine Form der Zuschreibung (Attribution) aufgrund des Urteils eines Beobachters. Entsprechend sind Kompetenzen Dispositionen selbstorganisierten Handelns, also Selbstorganisationsdispositionen (vgl. Erpenbeck, von Rosenstiel, S. Xf.). Zu unterscheiden sind innerhalb dieser Definition die folgenden beiden Kompetenztypen: Kompetenzen I als Selbststeuerungsstrategien unter evtl. unscharfer Zielkenntnis und Kompetenzen II als Evolutionsstrategien unter Zieloffenheit (vgl. Erpenbeck, von Rosenstiel, S. XV).
Kompetenzen bezeichnen also Selbstorganisationsdispositionen physischen und psychischen Handelns (vgl. Erpenbeck / von Rosenstiel, 2003, S. XXIX). Pawlik (1976, S. 13-43) und Schuler (2000, S. 67) unterscheiden dabei zwischen einer – subjektzentrierten – Eigenschaftsdiagnostik sowie einer – handlungszentrierten – Verhaltensdiagnostik. Schuler nimmt weiter eine Ergebnisdiagnostik in den Fokus, die sich auf die Ergebnisse konvergent-anforderungsorientierter oder divergent-selbstorganisativer Handlungs- und Tätigkeitssituationen bezieht. Hierauf wird im weiteren Verlauf unter Gliederungspunkt 2.3 nochmals Bezug genommen, um eine Abgrenzung verwandter Begriffe zu verdeutlichen.
Wissen kann nach Arnold und Pätzold (2008, S. 48) sowohl objektivistisch im Sinne von Information als auch subjektivistisch im Sinne von Kompetenz verstanden werden. Im Zuge der neueren Kompetenzdebatte ist Kompetenz jedoch als eine die subjektive Handlungsfähigkeit bezeichnende Kategorie weniger durch eine Orientierung an externen Vorgaben und zertifizierbaren Standards als durch die Entwicklung individueller Dispositionen gekennzeichnet. Damit markiert der Kompetenzbegriff etwas Potenzielles, also eine Verhaltensmöglichkeit bzw. prinzipielle Verfügbarkeit.
Auch Spöttl (2011) bezieht sich auf Weinert, der Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“, versteht (vgl. Spöttl, 2011, S. 14) , so fällt auf, dass in dieser Definition „Wissen“ nicht benannt ist, sondern von Problemen und deren Lösungen auf der Basis kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten gesprochen wird. Wissen wird hier zwar nicht als Kompetenz definiert, ohne Wissen ist Kompetenz jedoch nicht denkbar (vgl. Spöttl, 2011, S. 15).
In der empirischen Bildungsforschung hat sich nach Hartig ein Kompetenzbegriff durchgesetzt, der Kompetenzen definiert als „kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich funktional auf bestimmte Klassen von Situationen und Anforderungen beziehen“ (vgl. Hartig, Klieme, 2006, S. 128) Durch diese Definition erhält der Kompetenzbegriff eine duale Struktur, d.h., Kompetenzen werden nicht allein durch latente Konstrukte auf Seiten des Individuums bestimmt, sondern gleichzeitig durch gesellschaftlich-normative Anforderungen. Erst durch die Zusammenführung des individuell Gekonnten mit dem gesellschaftlich Geforderten kommt es zur Ausbildung einer Kompetenz. (vgl. Spöttl, 2011, S. 17)
Aufgrund der Komplexität des Begriffs ist Kompetenz eher als Programm denn als eindeutig zu definierender Begriff zu verstehen (vgl. Erpenbeck / von Rosenstiel, 2003, S. XXXI).
Die Kompetenz einer Person kann nie direkt beobachtet, sondern ausschließlich indirekt über deren entsprechende Performanz erschlossen werden. Performanz meint in diesem Zusammenhang das betreffende beobachtbare Verhalten oder die beobachtbaren Verhaltensprodukte (vgl. Schott, Azizi Ghanbari, 2012, S. 40).
Trotz der variierenden Begriffsverwendung lassen sich zentrale Charakteristika wie folgt isolieren:
- Kompetenzen werden im Laufe des Sozialisationsprozesses erworben, gefestigt und ausgebaut, haben also einen Sozialisationsbezug.
- Im Sozialisationsprozess bilden sich Kompetenzen durch die aktive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt. Es wird hier auch des Begriff der Aktivitätsbezug verwendet.
- Kompetenzen dienen der effektiven Bewältigung spezifischer Situationen und weisen damit einen Kontext-/ Situationsbezug auf.
- Kompetenzen basieren auf Wissen, auf internalisierten Regeln, Wissenselementen oder Mustern und stellen die Fähigkeit dar, diese situationsgerecht anzuwenden.
- Kompetenzen beinhalten ein Generierungsprinzip: Einerseits dienen sie als Basis konkreten menschlichen Handelns (Performanz) in spezifischen Situationen (Kompetenz-Performanz-Differenz). Im Umkehrschluss führt die Anwendung von Kompetenzen in spezifischen Situationen auch zum Erwerb und Ausbau bestehender Kompetenzen, wodurch Performanz auch konstitutiv für Kompetenz ist.
- Kompetenzen sind ungleich, da sie aufgrund ihres Umwelt- und Situationsbezuges abhängig sind von den dem Individuum zur Verfügung stehenden Möglichkeitsräumen zum Erwerb von Kompetenzen. (vgl. Grunert, 2012, S. 42f.)
Kompetenzen lassen sich zusammenfassend als kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen beschreiben, die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen. Dabei deckt sich dieser Kompetenzbegriff auch mit dem in den großen internationalen Schulleistungsstudien (PISA, TIMSS, PIRLS) verwendeten. Diese Definition erweist sich in mehrfacher Hinsicht als nützlich, wenn Ergebnisse von Bildungsprozessen beschrieben werden sollen:
- Durch den Bezug auf spezifische Kontexte wird eine hinreichend konzeptuelle Abgrenzung von allgemeinen kognitiven Leistungskonstrukten sichergestellt, die jedoch in der Literatur als nur in geringem Maße förderbar betrachtet wird.
- Durch die Bezugnahme auf spezifische Kontexte wird eine Definition spezifischer Kompetenzen erlaubt, die jeweils an die Ziele spezifischer Bildungsmaßnahmen oder –Einrichtungen angepasst werden können.
- Motivationale und affektive Variablen werden durch die Begrenzung auf kognitive Dispositionen im Bildungsgeschehen separat erfasst. Dabei werden auch allgemeine kognitive Fähigkeiten konzeptuell von Kompetenzen abgegrenzt.
Der Begriff „Kontext“ ist innerhalb dieser Definition als Bereich von Situationen und Anforderungen zu verstehen, auf die sich ein spezifisches Kompetenzkonstrukt bezieht. (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 7f.)
Wird Kompetenz als Handlungsmöglichkeit in einem gegebenen Kontext definiert, so umfasst sie gleichzeitig drei Elemente:
- Die handelnde Person muss über die einschlägigen Fähigkeiten verfügen.
- Es muss erlaubt und möglich sein, dass die Person dieses Handeln ausführt.
- Es müssen die notwendigen materiellen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Handlungsmöglichkeit ist dabei nicht nur zu verstehen als einfache Routinefertigkeiten, sondern bezieht auch Elemente wie Komplexität, Selbstständigkeit, an Standards orientierte Qualität, Verstehen und Wissen ein und orientiert sich an einem beschreibbar umrissenen Handlungskontext. (vgl. Reischmann, 2004, S. 9)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Notwendige Elemente für Kompetenz (vgl. Reischmann, 2004, S. 9)
Definitorisch werden also unter Kompetenzen Fähigkeiten, Kenntnisse, Methoden, Wissen, Einstellungen und Werte verstanden, deren Erwerb, Entwicklung und Verwendung sich auf die gesamte Lebenszeit eines Individuums bezieht. Sie sind damit an das Individuum und dessen Handlungsfähigkeit gebunden (subjektbezogen). Damit umfasst der Kompetenzbegriff Qualifikationen und nimmt in seinem Subjektbezug elementare bildungstheoretische Ziele und Inhalte auf. (vgl. Dehnbostel et al, 2009, S. 56)
Die Komplexität und der stufenartige Aufbau werden außerdem illustriert durch die „Kompetenztreppe nach North“ in der Modifikation von Wildt, da hier die Entwicklung vom Wissen zur Kompetenz plastisch dargestellt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Kompetenztreppe nach North (vgl. Wildt, 2006, S. 7)
Erpenbeck (2006) hat für die Umschreibung des Kompetenzbegriffs ein „Zwiebelmodell“ gewählt, bestehend aus den Elementen Wissen, Qualifikation und Kompetenz. Dabei ist Wissen als Basis definiert, welches Qualifikationen in bestimmten Anforderungssituationen ermöglicht. Kompetenz umschließt beide Begrifflichkeiten und nimmt Bezug auf die Selbstorganisationsfähigkeit des Individuums, sein Wissen und seine Qualifikationen auch in anderen, fremden Anforderungssituationen erfolgreich einsetzen zu können (vgl. Hartmann, 2012).
Abbildung 2: Der Kompetenzbegriff nach Erpenbeck (2006) (in Anlehnung an: Erpenbeck (2006), S. 34)
Abbildung 2 skizziert diese Begrifflichkeit. Da sich auch das im weiteren Verlauf der Arbeit beschriebene Projekt ANKOM auf diesen Kompetenzbegriff verständigt hat (vgl. Hartmann, 2012) , soll er auch im Kontext dieser Arbeit Verwendung finden.
2.4 Abgrenzung verwandter Begriffe
Um den Kompetenzbegriff transparenter werden zu lassen, genügt es nicht, sich nur dessen Begrifflichkeit näher zu betrachten und seine Historie zu analysieren, vielmehr bedarf es einer Abgrenzung verwandter oder ähnlich benutzter Begrifflichkeiten.
Im Gegensatz zu dem von der OECD verwandten Kompetenzbegriff werden unter Qualifikationen definierte Bündel von Wissensbeständen oder Fertigkeiten verstanden, die in organisierten Qualifizierungs- bzw. Bildungsprozessen vermittelt werden (vgl. Gnahs / Nuissl von Rhein, S. 117). Ebenso stellen es Erpenbeck und von Rosenstiel (2003, S. XI) dar, die Qualifikationen als Positionen eines gleichsam mechanisch abgeforderten Prüfungshandelns und damit als Wissens- und Fertigkeitspositionen beschreiben. Beide (S. XXIX) definieren Qualifikationen weiter als klar zu umreißende Komplexe von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Qualifikationen sind handlungsorientiert und i.d.R. so eindeutig zu fassen, dass sie durch Zertifizierungen überprüft werden können. (vgl. Teichler, 1995, S. 501)
Für die Bestimmung des Kompetenzbegriffes ist die Unterscheidung zur Qualifikation grundlegend. Kompetenz bezieht sich dabei als immer vorläufiges Ergebnis der Kompetenzentwicklung auf den individuellen Lerner. Qualifikationen hingegen sind primär nicht aus der entwicklungsorientierten Perspektive des Subjekts bestimmt (vgl. Dehnbostel et al., 2009, S. 56).
Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Ansätze des Kompetenzbegriffes wird außerdem deutlich, dass Kompetenzen nicht alleine als Wissen zu fassen sind, das in Lernprozessen angeeignet vermittelt und in Leistungstests geprüft wird. Diese Differenzierung zwischen Wissen und Können bzw. Wissen und Handeln findet sich bereit in frühen Konzepten von Habermas und Roth. Damit basieren Kompetenzen zwar auf Wissen, deklaratives Wissen ist eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für die erfolgreiche Bewältigung einer spezifischen Situation. Auch Aufenanger unterscheidet 1992 zwischen dem methodologischen Wissen über ein Regelsystem und seiner Anwendung sowie dem präpositionalen Wissen im Sinne der konkreten inhaltlichen Ausrichtung der Regelanwendung. (vgl. Grunert, 2012, S. 64)
Ebenfalls verwandte Begriffe sind „Kenntnisse“ und „Fertigkeiten“, die im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) als weitere Lernergebnisbereiche neben dem Bereich der „Kompetenz“ aufgeführt sind.
Kenntnisse sind in diesem Kontext zu verstehen als „das Ergebnis der Verarbeitung von Informationen durch Lernen“. Sie bezeichnen also die Summe der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis eines Lern- oder Arbeitsbereiches. Umschrieben wird der Bereich der Kenntnisse auch mit „Theorie- und/oder Faktenwissen“. (vgl. Gnahs / Nuissl von Rhein, S. 119)
Als weiterer Lernergebnisbereich sind „Fertigkeiten“ aufgeführt, die als Fähigkeit verstanden werden müssen, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen zur Ausführung von Aufgaben und Lösung von Problemen. Im EQR werden diese Fertigkeiten weiter unterschieden in kognitive und praktische Fertigkeiten. (vgl. Gnahs / Nuissl von Rhein, S. 119) Fertigkeiten bezeichnen also durch Übung automatisierte Komponenten von Tätigkeiten (vgl. Erpenbeck / von Rosenstiel, 2003, S. XXVIII).
„Fähigkeiten“ als weiterer verwandter Begriff beschreiben verfestigte Systeme verallgemeinerter psychophysischer Handlungsprozesse. Auch Fähigkeiten sind handlungsorientiert und können sich gleichermaßen auf konvergent-anforderungsorientierte wie divergent-selbstorganisative Handlungssituationen beziehen. (vgl. Erpenbeck / von Rosenstiel, 2003, S. XXIX)
Schaut man sich weitere verwandte Begriffe an, so stößt man bei Erpenbeck / von Rosenstiel (2003, S. XXVIII-XXIX) auf Merkmale und Eigenschaften. Dabei bezeichnen Merkmale unterschiedliche und dabei auch messbar unterscheidbare den Individuen jeweils eigene Erscheinungsformen ihrer Persönlichkeit. Merkmale sind subjektzentriert und sind eher im Bereich der konvergent-anforderungsorientierten denn der divergent-selbstorganisativen Handlungssituationen von Belang (vgl. Erpenbeck / von Rosenstiel, 2003, S. XXVIII) Auch im Falle der Eigenschaften handelt es sich um subjektzentrierte Attribute, die wie Merkmale, stets beschreibende oder erklärende Konstruktbegriffe darstellen, im Sinne von Persönlichkeitsmerkmalen. Eigenschaften finden sich gleichermaßen im Bereich der konvergent-anforderungsorientierten wie der divergent-selbstorganisativen Handlungssituationen (vgl. Erpenbeck / von Rosenstiel, 2003, S. XXVIII) Die folgende Tabelle 2 verdeutlicht die Abgrenzung der Begrifflichkeiten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Die Abgrenzung traditioneller Attributionsbegriffe der Kompetenz (in Anlehnung an Erpenbeck / von Rosenstiel, 2003, S. XXX)
2.5 Kompetenzmodelle
Werden Kompetenzen empirisch erfasst, so stellt sich die Frage, welche Modelle die Grundlage für die Entwicklung geeigneter Messinstrumente sowie für die Beschreibung der gewonnen Ergebnisse bilden. Dabei werden neben weiteren vorrangig zwei Modellformen unterschieden: Kompetenzniveaumodelle (2.5.1) sowie Kompetenzstrukturmodelle (2.5.2). Beide Modelle beziehen sich auf unterschiedliche Konstrukte von Kompetenzen, schließen sich dabei jedoch keineswegs aus, sondern können sich idealerweise ergänzen. (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 11)
2.5.1 Kompetenzniveaumodelle
Die Frage, was unterschiedliche Personen können, d.h., welche spezifischen Anforderungen sie bewältigen können, steht im Mittelpunkt der Kompetenzniveaumodelle. Diese kommen v.a. bei der Ergebnismessung von Bildungsprozessen im Zuge von Evaluationen (Output) zum Tragen, werden jedoch auch bei der Formulierung und Untersuchung von Modellen zur Kompetenzentwicklung herangezogen. (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 11) Sie haben ihren Ursprung in dem Wunsch nach einer kriteriumsorientierten Interpretation der quantitativen Leistungswerte. Dazu wird eine kontinuierliche Skala, auf der sich aus rein pragmatischer Sicht nicht jeder einzelne Punkt exakt beschreiben lässt, in Abschnitte unterteilt, die als Kompetenzniveaus oder Kompetenzstufen bezeichnet werden. Für genau diese Abschnitte wird dann eine kriteriumsorientierte Beschreibung der erfassten Kompetenzen vorgenommen. Kompetenzniveaumodelle befassen sich also mit der Definition von Skalenabschnitten sowie deren inhaltlicher Beschreibung. (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 12)
2.5.2 Kompetenzstrukturmodelle
Kompetenzstrukturmodelle befassen sich dagegen mit den Zusammenhängen der Bewältigung unterschiedlicher Anforderungen und damit, mit welchen und wie vielen Dimensionen interindividuelle Kompetenzunterschiede angemessen beschrieben werden können. Sie kommen v.a. bei Forschungsfragen zum Tragen, die sich mit der differenzierten Diagnose von Teilkompetenzen befassen. (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 11) Im Mittelpunkt von Kompetenzstrukturmodellen steht also die Frage der Dimensionalität von Kompetenzstrukturen. Sie werden dann benötigt, wenn das Zustandekommen und die Förderung spezifischer Kompetenzen untersucht werden soll. (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 13)
Im Hinblick auf die Anerkennung von Kompetenzen müssen diese erfasst und bewertet werden. Mit dieser thematischen Fragestellung beschäftigt sich das folgende Kapitel, welches zuerst die theoretischen Grundlagen aufzeigt und im Folgenden auf die Begrifflichkeit der Kompetenzbilanzierung eingeht, um zum Abschluss Methoden und Instrumente für die Praxis zu betrachten.
3. Kompetenzerfassung und -bilanzierung
3.1 Kompetenzerfassung, -messung und -diagnostik
Für die Optimierung von Bildungsprozessen sowie für die Weiterentwicklung des Bildungswesens kommt der Erfassung und Diagnostik von Kompetenzen eine Schlüsselfunktion zu. Dabei dienen Verfahren zur Kompetenzmessung aus der pädagogisch-psychologischen Forschung als Grundlagen individueller Förder-, Platzierungs- und Auswahlentscheidungen genauso wie für die Benotung und Zertifizierung Lernender. Außerdem werden Ergebnisse empirischer Messungen auch zur Evaluation pädagogischer Maßnahmen sowie Institutionen herangezogen. (vgl. Klieme, Maag-Merki, Hartig, 2007, S. 17)
Vor dem Hintergrund der nahezu uferlos erscheinende Diskussion des Kompetenzbegriffes wird schnell deutlich, dass auch die Kompetenzermittlung eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt. In der Praxis werden viele klassische Testverfahren, basierend auf der Messung von Persönlichkeit und Intelligenz etc., den Anforderungen einer entwicklungsfördernden Kompetenzermittlung nicht gerecht (vgl. Steinkellner, Czerny, 2010, S. 11-4). Viele aktuelle Forschungsprojekte im Bereich der Kompetenzmessung sollen dazu führen, dass die derzeitigen Verfahren weiter verbessert und weitere neue Verfahren entwickelt werden (vgl. Steinkellner, Czerny, 2010, S. 11-5).
Die Messung von Kompetenzen erfolgt in unterschiedlichsten Kontexten und auch mit verschiedenartigen Zielsetzungen. Als Beispiele sind hier u.a. Assessment Center und Schulleistungsuntersuchungen zu nennen. Die Ansätze einer solchen Kompetenzmessung können dabei sowohl qualitativer als auch quantitativer Natur sein, aber auch beide verknüpfen. Da Kompetenzen jedoch aus ihrer Eigenschaft heraus nicht direkt prüfbar sind, sondern aus der Performanz innerhalb einer Handlungssituation erschlossen werden, kann auch die Kompetenzmessung nur kontextspezifisch erfolgen. (vgl. Hertel, 2009, S. 52) Die folgende Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Arten der Kompetenzerfassung (qualitativ vs. quantitativ).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Arten der Kompetenzerfassung (vgl. Strauch et al, 2009, S. 36)
Für den weiteren Verlauf der Arbeit soll an dieser Stelle aber auf eine tiefergehende Unterscheidung verzichtet werden.
Es lassen sich grundsätzlich vier verschiedene Methoden der Kompetenzerfassung unterscheiden: die Befragung (mündlich oder schriftlich), die Beobachtung, die Materialanalyse und Mischverfahren (vgl. Strauch et al, 2009, S. 40). Im Hinblick auf den jeweiligen Anwendungsbereich lassen sich die Methoden der Kompetenzerfassung weiter klassifizieren, wozu Tabelle 4 eine Übersicht gibt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: Methoden der Kompetenzerfassung nach Anwendungsbereichen (vgl. Strauch et al., 2009, S. 41)
Welche Methode geeignet scheint, hängt sowohl vom jeweiligen Anwendungskontext als auch von den Kompetenzen ab, die im Schwerpunkt entwickelt werden sollen (vgl. Strauch et al., 2009, S. 41).
Innerhalb des Projektes REAL (Anrechnung der beruflichen Kompetenzen des Meisters / Technischen Betriebswirts auf den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen der FH Stralsund) wurde im Kern eine Kompetenzmatrix entwickelt, die die Erfassung und Bewertung der berufspraktisch erworbenen Kompetenzen ermöglichen sollte. Innerhalb dieser Kompetenzmatrix werden die Tätigkeitsbereiche im Geschäftsprozess den Modulen des Studiengangs gegenübergestellt (vgl. Bütow, 2008, S. 147). Das Projekt verfolgte die Analyse und Bewertung aufgrund der zeitlichen Begrenzung lediglich exemplarisch, jedoch wird der Ansatz von den Akteuren als gangbarer Weg angesehen, berufspraktische Kompetenzen anrechenbar zu beschreiben (vgl. Bütow, 2008, S. 148). Tabelle 5 liefert hierzu eine Beispielmatrix.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5: Kompetenzmatrix (Bütow, 2008, S. 148)
3.2 Kompetenzbilanzierung
Die Kompetenzbilanz fungiert als Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung. Dabei konzentriert sie sich auf sozial-kommunikative, methodische und Selbstkompetenzen, die im sozialen Feld „Familie“ erworben oder weiterentwickelt werden und häufig Potenziale auch für die berufliche Entwicklung bergen (vgl. Erler, Gerzer-Saß et al., 2003, S. 339). Die Arbeit mit der Kompetenzbilanz dient als Basis für einen Prozess der Reflexion und des Dialogs mit dem Fokus auf den Kompetenztransfer aus unterschiedlichen Kontexten in die Arbeitswelt (vgl. Erler, Gerzer-Saß et al., 2003, S. 346).
Definitorisch versteht man unter einer Kompetenzbilanz ein überwiegend qualitativ-subjektivierend und formativ vorgehendes Verfahren zur Feststellung individueller Kompetenzen. Kompetenzbilanzen haben das Ziel, die Aktivität, Selbststärke und Kompetenzerleben des Individuums zu fördern sowie einen Reflexions- und Entwicklungsprozess anzuregen, wodurch sie klar als Maßnahmen mit einem Interventionsziel betrachtet werden sollten. Sie sind außerdem als Laufbahnberatungsverfahren anzusehen, da sie hauptsächlich die berufliche Situation des Individuums zum Anlass haben (vgl. Triebel, 2009, S. 84).
Durch die Entwicklung der Kompetenzbilanz entstand ein Verfahren, das auf Basis der identifizierten und biographisch verankerten Kompetenzen der Teilnehmenden ermöglicht, proaktiv zu werden und die eigene berufliche und private Entwicklung zu steuern. Die Kompetenzbilanz hat sich v.a. bei Fragen der Studien- und Berufswahl, des Um- und Wiedereinstiegs sowie der Karriereplanung als geeignetes Mittel erwiesen (vgl. Seipel, 2010, S. 02-05).
3.3 Methoden und Instrumente für die Praxis
Im Folgenden sollen einige verbreitete Instrumente aus der Praxis kurz dargestellt werden. Hierbei sollen insbesondere der ProfilPASS und der Qualipass betrachtet werden.
Alle in Tabelle 5 (Methoden der Kompetenzerfassung) aufgezeigten Instrumente sind miteinander kombinierbar. Solche Mischverfahren findet man in der Praxis v.a. unter den Begriffen Assessment Center und Kompetenzpass, die als am stärksten strukturierte Instrumente der Mischverfahren gelten (vgl. Strauch et al, 2009, S. 109). Assessment Center werden v.a. in der Beratung, bei der Einstufung in der beruflichen Bildung, bei der Karriereplanung etc. eingesetzt. Kompetenzpässe werden in der Weiterbildung zur Standortbestimmung der Lernenden eingesetzt, um bereits vorhandene Kompetenzen und Stärken festzustellen und transparent zu machen (vgl. Strauch et al., 2009, S. 110).
Ein methodologisch am elaboriertesten und theoretisch am besten begründetes und hinsichtlich der Verfahrensweise ausgereiftes Instrument zu Kompetenzmessung ist der ProfilPASS. Zu verstehen ist der ProfilPASS als Instrument zur Unterstützung des lebensbegleitenden Lernens mit dem Ziel der beruflichen und persönlichen Orientierung und Planung zukünftiger Lernvorhaben. Damit kann er als entwicklungsorientiertes Verfahren charakterisiert werden (vgl. Preißer, Völzke, 2007, S. 64). Das Verfahren der Kompetenzerfassung besteht dabei v.a. aus drei Schritten: der Beschreibung von Tätigkeiten, der Ermittlung von Fähigkeiten durch Reflexion sowie deren abschließende Bewertung (vgl. Preißer, Völzke, 2007, S. 65).
Nach Strauch et al (2009, S. 115) ist der ProfilPASS eine Passaktivität, also ein strukturiertes Verfahren zur Dokumentation der auf unterschiedlichen Wegen erworbenen Kompetenzen eines Individuums. Entscheidend dabei ist eine professionelle Begleitung, die den erforderlichen Reflexionsprozess sowie die Präzisierung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen fördert.
Der Qualipass als weiteres Instrument zur Kompetenzerfassung stützt sich auf einen Kompetenzbegriff, der eine unabhängig vom spezifischen Kontext und der konkreten Aufgabenstellung vorhandene Einheit von Haltung, Wissen und Können in den Mittelpunkt rückt. Als Ziel des Qualipasses sollen Praxiserfahrungen und Kompetenzgewinn dokumentiert, die Leistungs- und Kompetenzvielfalt Jugendlicher anerkannt, die (Berufs-)Wegeplanung und Profilbildung sowie die Engagementbereitschaft und Selbstorganisation junger Menschen verbessert werden (vgl. Gerber, 2003, S. 353). Dabei ist der Qualipass bewusst ein weiches und vielseitig einsetzbares Instrument, um die Erfahrungsbereiche und Kompetenzentwicklungen junger Menschen zu dokumentieren (vgl. Gerber, 2003, S. 360).
Als letztes Instrument soll der Europass genannt werden, der mit seinen fünf Elementen ein standardisiertes, elektronisch nutzbares Format für die europaweit verständliche Dokumentation individueller Berufs- und Lernwege darstellt. Der Europass Lebenslauf als Herzstück ermöglicht einen raschen Überblick über die relevanten Eigenschaften des Passinhabers. Er wird ebenso wie der Europass Sprachenpass online durch das Individuum selbst erstellt mit Hilfe eines entsprechenden Leitfadens. Die verbleibenden drei Dokumente werden von Dritten nach Beendigung bestimmter Lernabschnitte ausgestellt (z.B. nach Abschluss eines Auslandsaufenthaltes) (vgl. Fietz, 2010, S. 198).
Seit dem Jahr 2005 kommt dieses Dokumentenportfolio zum Einsatz und soll als einheitliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz von Qualifikationen und Kompetenzen beitragen. Allerdings beschränkt sich die vorgenommene Standardisierung (sieht man vom Sprachpass ab) auf eine Definition einheitlicher Formate. Indes könnten einheitliche Deskriptoren für Lernergebnisse analog zu DQR / EQR und ECVET die Aussagekraft dieses Instrumentes deutlich erhöhen (vgl. Hölbling, 2012, S. 203).
Das vorliegende Kapitel soll lediglich einen kurzen Einblick geben in die Möglichkeiten der Kompetenzdiagnostik und –bilanzierung geben, kann im Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit jedoch nicht vertiefter betrachtet werden.
Nach dieser theoretischen Einführung in die Begrifflichkeiten sollen im nächsten Kapitel bildungspolitische Ursprünge und Lösungsansätze aufgezeigt werden, die den Aspekt der Durchlässigkeit im Sinne eines lebenslangen Lernens einerseits fordern, aber auch fördernd unterstützen.
4. Aufgaben der Hochschulen – Ursprünge und bildungspolitische Lösungsansätze
4.1 Allgemeine Tendenzen
Neben der Erleichterung des Hochschulzugangs und der Gestaltung zielgruppenspezifischer akademischer Bildungsangebote ist die Gestaltung flexibler Übergänge durch Anrechnung der bildungspolitisch sicherlich effektivste Aspekt für die Umsetzung von Durchlässigkeit im Bildungssystem. Mittels einer solchen Anerkennung lassen sich Sackgassen, unnötige Umwege sowie ineffiziente Wiederholungen vermeiden (vgl. Mucke, 2010, S. 169).
Die Thematik der Durchlässigkeit, auf die in Kapitel 5 näher eingegangen wird, und der Themenkomplex der Anerkennung stehen nicht im luftleeren Raum, sondern fußen auf europäischen Beschlussfassungen und münden in unterschiedlichen bildungspolitischen Lösungsansätzen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Anerkennung nicht-akademischer Kompetenzen?
Es geht darum, beruflich erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium anzurechnen, um die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu erhöhen.
Welche Rolle spielt der Bologna-Prozess dabei?
Der Bologna-Prozess stieß Reformen an, die lebenslanges Lernen fördern und unterschiedliche Bildungswege durch Leistungspunktesysteme (ECTS) vergleichbar machen sollen.
Was ist der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)?
Der DQR ist ein Instrument zur Einordnung von Qualifikationen im deutschen Bildungssystem, um Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung zu schaffen.
Was verbirgt sich hinter dem Projekt ANKOM?
ANKOM ist eine Initiative zur Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge, die Modellentwicklungen für die operative Umsetzung an Hochschulen fördert.
Welche Best-Practice-Modelle gibt es in Deutschland?
Die Arbeit nennt unter anderem das Oldenburger Modell sowie Verfahren an der Universität Potsdam und der Hochschule Fulda zur pauschalen oder individuellen Anrechnung.
- Quote paper
- Birgit Czanderle (Author), 2013, Die hochschulische Anerkennung nicht-akademischer Kompetenzen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269763