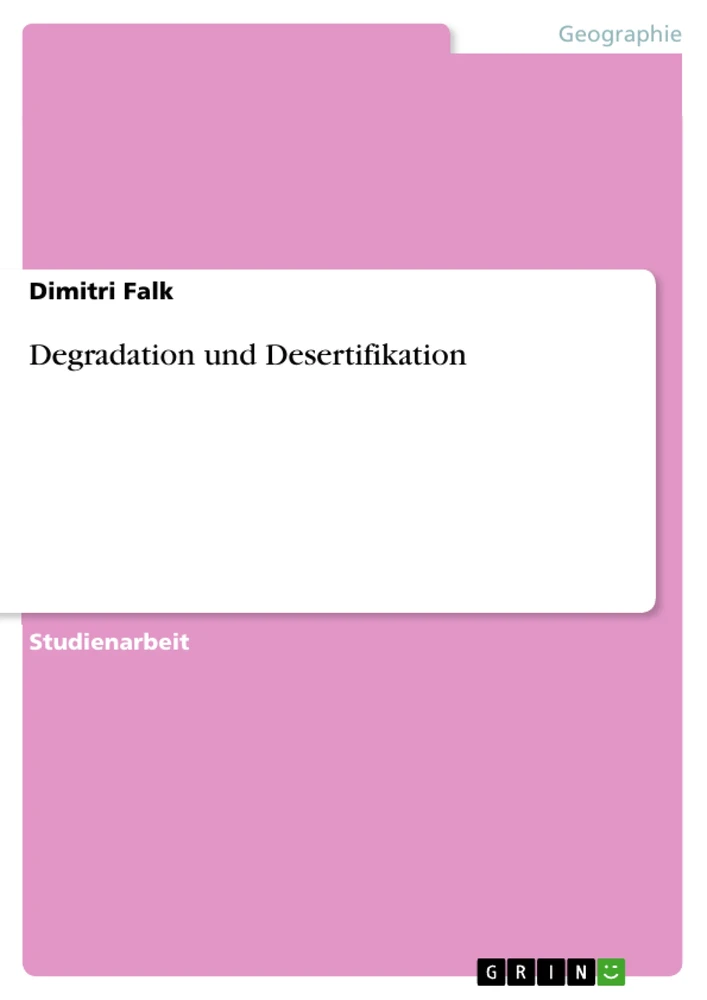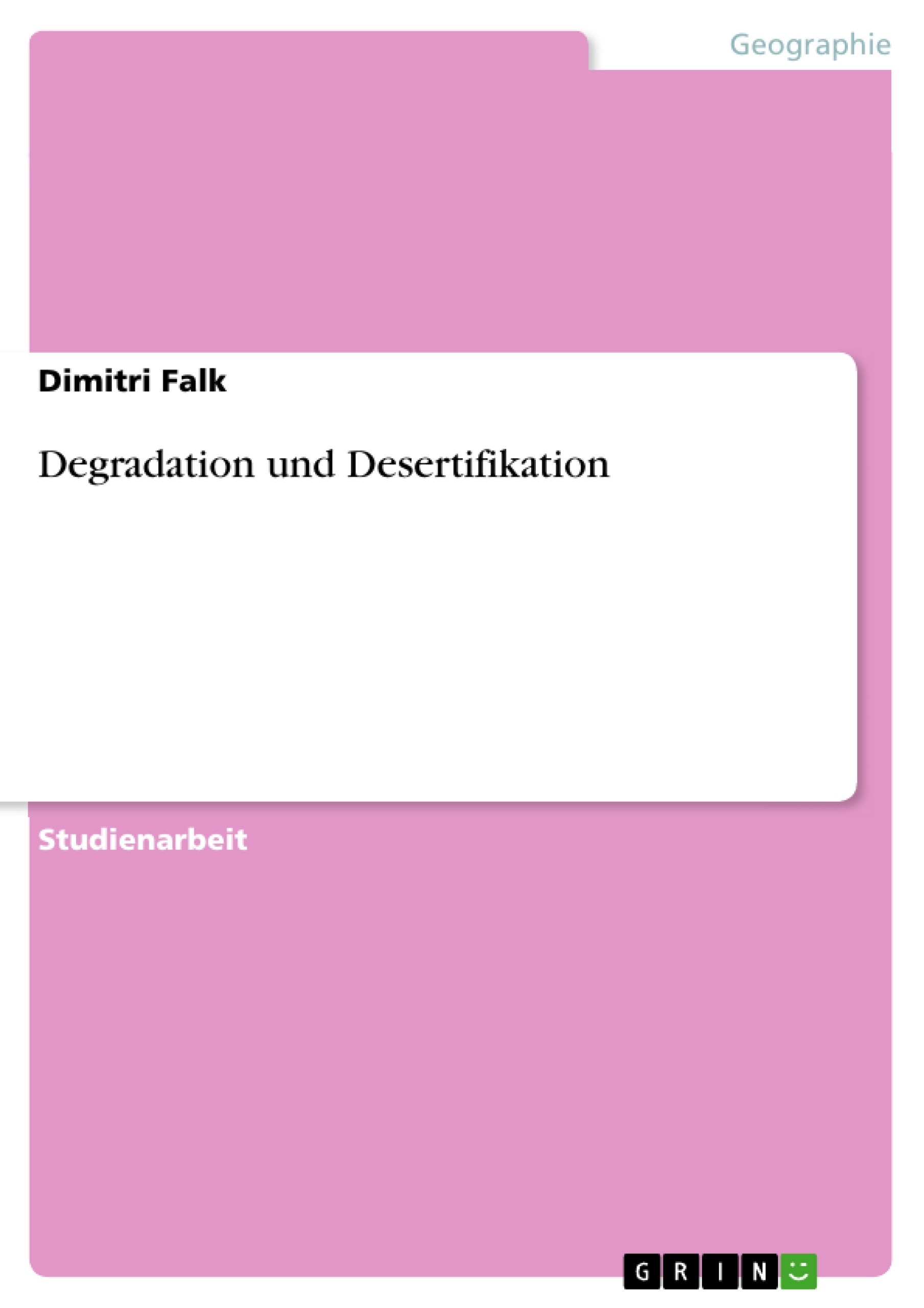Bereits im Jahre 1972 wurde der Bodenschutz als überregionales politisches Ziel in der Europäischen Bodencharta festgehalten und der Boden als kostbares, begrenzt vorhandenes und leicht zerstörbares Gut klassifiziert (Kuntze 1994:357). Bedingt durch die Auswirkungen der Dürre im Sahel 1968-1973 wurde der Begriff der Desertifikation im Rahmen von nachfolgenden UN-Umweltkonferenzen 1977 in Nairobi und 1992 in Rio der Janeiro weltweit bekannt und diskutiert (Strahler/Strahler 2005:611). Die stetig wachsende Weltbevölkerung stellt zunehmende Ansprüche an den Boden, da die landwirtschaftliche Nutzfläche zur Gewährleistung der Ernährung nicht proportional zum Bevölkerungswachstum größer wird (Mensching/Seuffert 2001:6). Daraus ergibt sich mit der Zeit eine zunehmend intensivere Nutzung des Bodens, sodass eine Regeneration und somit eine nachhaltige Nutzung für künftige Generationen immer problematischer wird. In Anbetracht der UN-Milleniumsziele zählt die Desertifikation ebenfalls zu den „größten Umwelt- und Entwicklungsproblemen des 21. Jahrhunderts“ (Opp 2004:49), auch wenn sich die Problematik größtenteils dem Bewusstsein der Öffentlichkeit entzieht.
Den Einstieg in das Thema stellt eine Abhandlung über den Begriff Desertifikation dar, da auf Grund der uneinheitlichen Definition die Tragweite nicht eindeutig zu erfassen ist. Dadurch kommt es zu Schwierigkeiten, die ebenfalls thematisiert werden. Darauf basierend wird anhand einer Definition das Ausmaß der Desertifikation quantitativ beleuchtet, indem desertifikationsgefährdete Gebiete aufgezeigt werden. Anschließend werden anhand der Sahelzone Ursachen für das Desertifikationsgeschehen detailliert betrachtet. Aufbauend auf den daraus resultierenden sozioökonomischen und ökologischen Folgen wird auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Desertifikation anhand aktueller Projekte eingegangen, die abschließend bewertet werden.
Ziel der Arbeit ist es die Zusammenhänge rund um das Thema Desertifikation herauszuarbeiten und einen strukturierten Einblick in das komplexe Ursache-Wirkungs-Gefüge zu erlangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Abgrenzung des Begriffs Desertifikation
- 3 Geographische Verbreitung der Desertifikation
- 4 Ursachen der Desertifikation
- 4.1 Klimatische Randbedingungen
- 4.2 Sozioökonomische Randbedingungen
- 4.3 Unangepasste Landnutzung
- 5 Folgen der Desertifikation
- 5.1 Sozioökonomische Folgen
- 5.2 Ökologische Folgen
- 6 Maßnahmen zur Bekämpfung der Desertifikation
- 6.1 Sozioökonomische Maßnahmen
- 6.2 Ökologische Maßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexen Zusammenhänge der Desertifikation. Ziel ist es, einen strukturierten Einblick in das Ursache-Wirkungs-Gefüge zu geben und die verschiedenen Facetten des Problems zu beleuchten.
- Abgrenzung des Begriffs Desertifikation und Herausarbeitung der Problematik uneinheitlicher Definitionen
- Geographische Verbreitung der Desertifikation und Darstellung betroffener Regionen
- Analyse der Ursachen der Desertifikation, einschließlich klimatischer, sozioökonomischer und landnutzungsbedingter Faktoren
- Betrachtung der sozioökonomischen und ökologischen Folgen der Desertifikation
- Vorstellung und Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Desertifikation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Desertifikation ein und betont deren Bedeutung als globales Umwelt- und Entwicklungsproblem. Sie verweist auf die Uneinheitlichkeit der Begriffsbestimmung und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von einer Begriffsklärung über die geographische Verbreitung bis hin zu den Ursachen, Folgen und Bekämpfungsmaßnahmen reicht. Die Arbeit hebt die Bedeutung nachhaltiger Bodennutzung für zukünftige Generationen hervor und stellt den Bezug zu den UN-Millenniumzielen her.
2 Abgrenzung des Begriffs Desertifikation: Dieses Kapitel befasst sich kritisch mit den unterschiedlichen Definitionen von Desertifikation und unterscheidet sie von der natürlichen Wüstenbildung (Desertion). Es analysiert die UNCCD-Definition von 1992 und diskutiert deren Schwächen, insbesondere die fehlende Berücksichtigung der Degradationsintensität. Die Arbeit betont die Wichtigkeit einer eindeutigen Definition für die korrekte Erfassung der geographischen Verbreitung und die Entwicklung effektiver Bekämpfungsmaßnahmen. Eine präzisere Definition, die die anthropogene Komponente und die langfristige Entwicklung wüstenartiger Bedingungen in ehemals nicht-wüstenhaften Regionen betont, wird vorgestellt.
3 Geographische Verbreitung der Desertifikation: Kapitel 3 beschreibt die geographische Verbreitung der Desertifikation, basierend auf der UN-Definition und unter Berücksichtigung der Klimazonen (arid, semi-arid, trocken subhumid). Es wird auf die "Risk of Human-Induced Desertification Map" des US-Landwirtschaftsministeriums verwiesen, die gefährdete Gebiete weltweit darstellt. Die Karte visualisiert die hohe Gefährdung in Afrika (Sahelzone), Zentralasien, dem Nahen Osten und anderen Regionen. Es wird hervorgehoben, dass Desertifikation nicht gleichmäßig, sondern lokal konzentriert auftritt.
Schlüsselwörter
Desertifikation, Landdegradation, Wüstenbildung, anthropogene Einflüsse, Sahelzone, nachhaltige Landnutzung, sozioökonomische Faktoren, ökologische Folgen, Bekämpfungsmaßnahmen, UNCCD.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Desertifikation: Ursachen, Folgen und Bekämpfung"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Desertifikation. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht die komplexen Zusammenhänge der Desertifikation, beleuchtet die Problematik uneinheitlicher Definitionen, analysiert die geographische Verbreitung, Ursachen (klimatische, sozioökonomische und landnutzungsbedingte Faktoren), Folgen (sozioökonomisch und ökologisch) und vorstellt und bewertet Maßnahmen zur Bekämpfung der Desertifikation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Abgrenzung des Begriffs Desertifikation, Geographische Verbreitung der Desertifikation, Ursachen der Desertifikation (mit Unterkapiteln zu klimatischen, sozioökonomischen und landnutzungsspezifischen Faktoren), Folgen der Desertifikation (sozioökonomische und ökologische Folgen) und Maßnahmen zur Bekämpfung der Desertifikation (sozioökonomische und ökologische Maßnahmen).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, einen strukturierten Einblick in das Ursache-Wirkungs-Gefüge der Desertifikation zu geben und die verschiedenen Facetten des Problems zu beleuchten. Es soll ein Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen natürlichen und menschlichen Faktoren geschaffen werden.
Wie wird der Begriff "Desertifikation" abgegrenzt?
Die Arbeit befasst sich kritisch mit den unterschiedlichen Definitionen von Desertifikation und unterscheidet sie von der natürlichen Wüstenbildung (Desertion). Sie analysiert die UNCCD-Definition von 1992 und deren Schwächen und schlägt eine präzisere Definition vor, die die anthropogene Komponente und die langfristige Entwicklung wüstenartiger Bedingungen in ehemals nicht-wüstenhaften Regionen betont.
Wo ist die Desertifikation geographisch verbreitet?
Kapitel 3 beschreibt die geographische Verbreitung der Desertifikation basierend auf der UN-Definition und unter Berücksichtigung der Klimazonen. Es werden gefährdete Gebiete weltweit, insbesondere in Afrika (Sahelzone), Zentralasien und dem Nahen Osten, dargestellt. Die Desertifikation tritt nicht gleichmäßig, sondern lokal konzentriert auf.
Welche Ursachen werden für die Desertifikation genannt?
Die Arbeit analysiert die Ursachen der Desertifikation, die in klimatische Randbedingungen, sozioökonomische Randbedingungen und unangepasste Landnutzung unterteilt werden. Diese Faktoren werden im Detail untersucht.
Welche Folgen hat die Desertifikation?
Die Arbeit betrachtet sowohl die sozioökonomischen Folgen (z.B. Verlust von landwirtschaftlichen Flächen, Armut) als auch die ökologischen Folgen (z.B. Verlust der Biodiversität, Bodenerosion) der Desertifikation.
Welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Desertifikation werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt und bewertet sozioökonomische und ökologische Maßnahmen zur Bekämpfung der Desertifikation vor. Dies beinhaltet Maßnahmen zur nachhaltigen Landnutzung und zur Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen in betroffenen Regionen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Desertifikation, Landdegradation, Wüstenbildung, anthropogene Einflüsse, Sahelzone, nachhaltige Landnutzung, sozioökonomische Faktoren, ökologische Folgen, Bekämpfungsmaßnahmen, UNCCD.
- Arbeit zitieren
- Dimitri Falk (Autor:in), 2009, Degradation und Desertifikation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269563