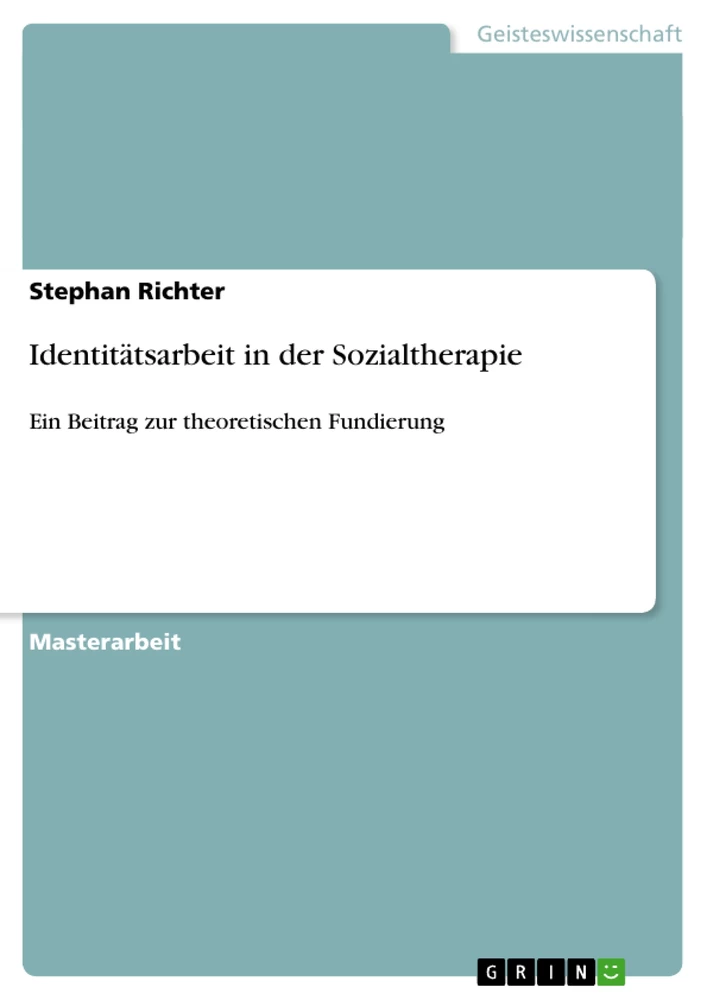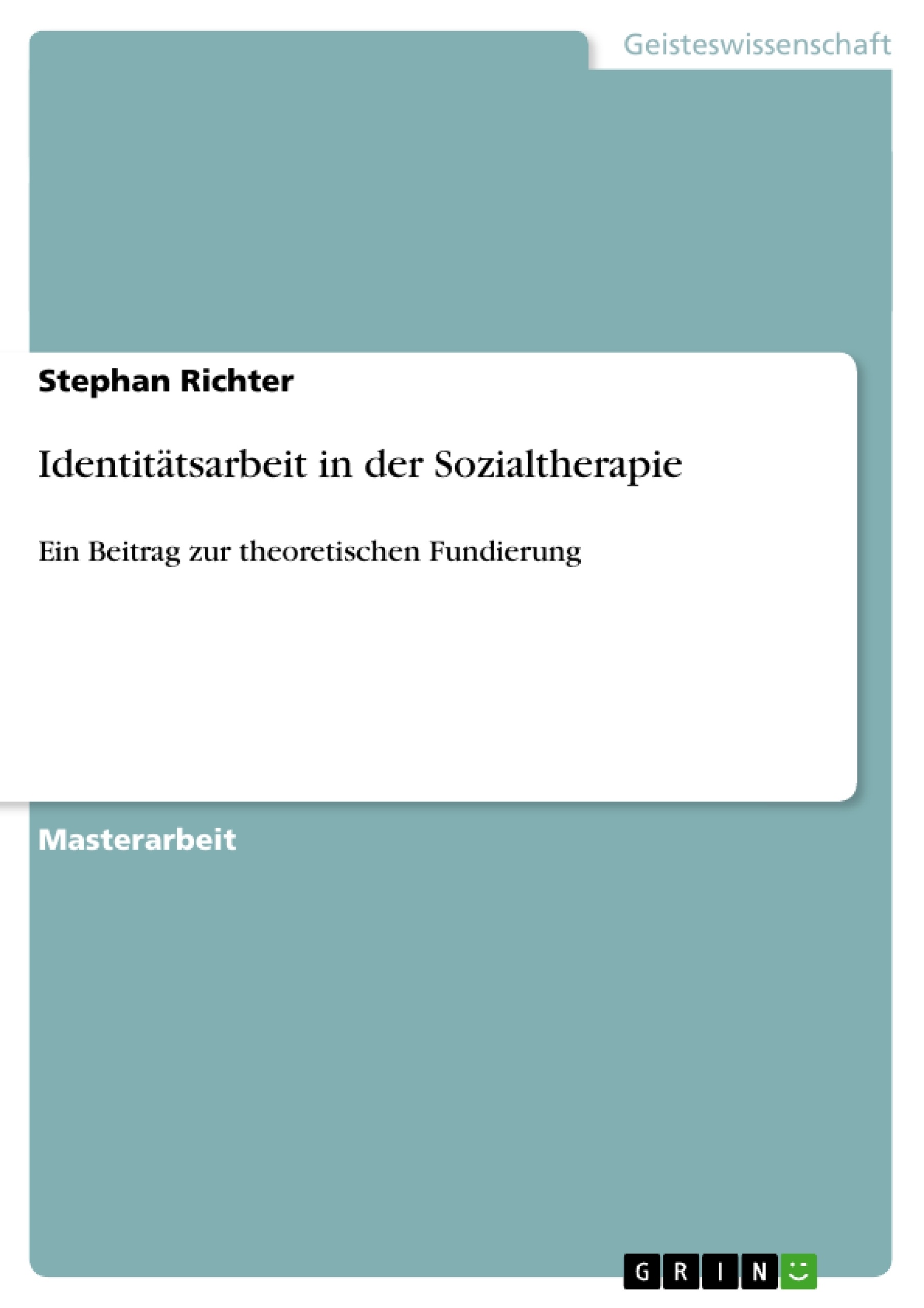Der Autor wählte mit dem Begriff "Sozialtherapie" ein Thema, das als Denk- und Handlungsansatz in der Sozialen Arbeit einerseits seit langer Zeit etabliert ist, andererseits sich aber auch durch ein breites, manchmal auch unscharfes Profil auszeichnet. Insofern stellt sich der Autor hier einer besonderen Herausforderung, indem er einen Aspekt von Sozialtherapie fokussiert und zu einer theoretischen Unterlegung beitragen will.
Der Autor fragt nach der Bedeutung von Identitätstheorien in der Sozialtherapie und ob sich hierüber Sozialtherapie konturieren, d.h. theoretisch und methodisch unterlegen lässt. Der Autor bearbeitet zur Beantwortung seiner Fragestellung neben den essentiellen Veröffentlichungen zur Sozialtherapie für die Diskussion und Begründung notwendige Modelle zu Gesundheit und Krankheit und zur Identität. Das entspricht einer angemessenen Theorierezeption. Er greift dabei auf die für die Thematik relevante Literatur zurück.
Der Autor kann durch die Auswahl seiner Bezugspunkte - allgemeine Veröffentlichungen zur Sozialtherapie, spezifische Konzepte, Modelle und Methoden der Sozialtherapie sowie Identitätstheorien - die Sinnhaftigkeit seiner Fragestellung sowohl verdeutlichen wie auch beantworten. Mit der Frage nach einer identitätstheoretischen Unterlegung von Sozialtherapie gelingt es dem Autor, Kernelemente von Sozialtherapie zu erfassen und sie zudem noch an andere grundlegende Aspekte von Sozialtherapie wie Diagnostik, Gesundheitsverständnis und soziale Unterstützung rückzubinden. Zudem zeigt er auf, wie diese Erkenntnisse auch in einen spezifischen Handlungsansatz - der biografischen Narration - münden können.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 - Einleitung
1.1 Skizze
Kapitel 2 - Die Sozialtherapie
2.1 Sozialtherapie - Horizontbestimmung
2.2 Soziale Therapie nach Schwendter
2.3 Sozialtherapie nach Richter
2.4 Die gemeindepsychologische Perspektive nach Keupp
2.5 Zusammenfassung
Kapitel 3 - Abgrenzungen und Verwandtschaften der Sozialtherapie
3.1 Sozialtherapie in Abgrenzung zur Soziotherapie
3.2 Sozialtherapie und die Verwandtschaft zur klinischen Sozialarbeit
3.3 Die Abgrenzung zur Sozialtherapie im Strafvollzug
3.4 Die Verwandtschaft zur gemeindepsychologischen Perspektive
Kapitel 4 - Konzepte, Modelle und Methoden der Sozialtherapie
4.1 Soziale Anamnese und diagnostisches Arbeiten
4.1.1 Allgemeines
4.1.2 Falleinschätzung im Systemischen-Case-Management (SCM)
4.1.3 Dialogische Diagnose nach Röh
4.1.4 Zusammenfassung
4.2 Gesundheitsverständnis in der Sozialtherapie
4.2.1 Gesundheitsförderung und Gesundheitsverständnis
4.2.2 Salutogenese
4.2.3 Zusammenfassung
4.3 Das bio-psycho-soziale Modell
4.4 Soziale Krankheit und Gesundung
4.4.1 Zusammenfassung
4.5 Soziale Unterstützung, soziale Netzwerke
4.6 Interventionsstrategien und Handlungsmethoden
4.7 Der Versuch einer Definition für Sozialtherapie
Kapitel 5 - Identitätstheorie und Identitätsarbeit
5.1 Horizontbestimmung
5.1.1 Identität als Ich-Identität nach Erikson
5.1.2 Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile
5.2. Identität als Produkt von Interaktion (Krappmann)
5.2.1 Rollendistanz
5.2.2 Empathie
5.2.3 Ambiguitätstoleranz
5.2.4 Identitätsdarstellung
5.2.5. Zusammenfassung
5.3. Identitätsbegriff nach Frey und Haußer
5.3.1 Zusammenfassung
5.4. Identitätsarbeit nach Keupp
5.4.1 Zusammenfassung
5.5. Das Modell der alltäglichen Identitätsarbeit
5.5.1 Die Struktur der alltäglichen Identitätsarbeit
5.5.2 Der Prozess der alltäglichen Identitätsarbeit
5.5.3 Zusammenfassung
Kapitel 6 - Gesamtanalyse zum Thema Identitätsarbeit in der Sozialtherapie
6.1 Teil 1: Allgemeine Aspekte, Thesen und Fragestellungen
6.2 Teil 2: Biografische Narrationen als Behandlungsansatz
6.2.1 Bedeutung und Potentiale biografischer Narrationen
6.2.2 Anwendung biografischer Gespräche
6.3 Resümee
Literaturverzeichnis
Kapitel 1 - Einleitung
Der vorliegende Beitrag ist eine rein theoretische Arbeit und stellt sich die Sozialtherapie zum zentralen Thema. Da es teils sehr weitläufige Ausführungen darüber gibt, was Sozialtherapie eigentlich ist und welches Profil sie hat, erscheint eine möglichst genaue Definition nötig. Hierfür bedarf es zuvor einer theoretischen Herleitung. Entsprechende Grundlagenkonzepte, Modelle und Methoden werden dargestellt. Soweit zum ersten Teil des Beitrages der theoretischen Fundierung der Sozialtherapie Der zweite Teil geht auf die Identitätstheorie mit dem Ziel ein, eine Verbindung zur Sozialtherapie herzustellen. Vorab wird hierfür folgende Grundannahme vertreten: Identität ist als lebenslanger Konstruktionsprozess von Subjekten zu verstehen. Er ist als alltägliche Identitätsarbeit zu begreifen. Folgende Thesen werden die weitere theoretische Fundierung lenken:
- Identitätsarbeit bei Klienten ist ein unausweichliches Begleitphänomen des sozialtherapeutischen Handelns.
- Das Ausmaß von Handlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten bei Klienten hängt von deren Identitätsarbeit ab.
- Gelingende Identitätsarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für gelingendes sozialtherapeutisches Handeln.
- Gelingende Identitätsarbeit steht im Sinne des sozialtherapeutischen Gesundheitsverständnisses.
Zentrale Fragestellungen der Arbeit lauten wie folgt:
- Welchen Stellenwert hat Identitätstheorie hinsichtlich der Sozialtherapie?
- Was zeichnet die Sozialtherapie unter Verwendung der Theorie der Identitätsarbeit aus?
Schließlich soll aus den gewonnenen Erkenntnissen ein sozialtherapeutischer Behandlungsansatz entworfen werden, der einerseits identitätstheoretisch begründet ist und andererseits die theoretische Fundierung der Sozialtherapie auch auf der methodischen Ebene bereichert. Die praktische Anwendung dieses Behandlungsansatzes und deren Analyse bzw. Evaluation ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Sie könnte als ein mögliches Folgeprojekt in Angriff genommen werden. Zur Veranschaulichung der Struktur der Arbeit soll die in Punkt 1.1 dargestellte Skizze dienen.
Der Beitrag richtet sich an sozialtherapeutisch Tätige, also vorrangig an Sozialarbeiter im psychosozialen Praxisfeld bzw. klinisch-sozialarbeiterischen Arbeitskontext. Zugang zur Thematik der Sozialtherapie habe ich zum einen aufgrund des eigenen Arbeitsfeldes erhalten. Sozialarbeit mit Patienten aus dem Berliner Maßregelvollzug findet immer im multidisziplinären Rahmen statt. Sie bedarf - so meine Erfahrung - stellenweise noch eigenständigere Konturen und professionsspezifischere Aufgaben. Hierzu zählt die Sozialtherapie. Zum anderen bereitete das berufsbegleitende Studium klinische Sozialarbeit den Zugang zur Sozialtherapie.
Eine Beobachtung in der Praxis hat schließlich dazu geführt, die Identitätstheorie näher zu beleuchten. In den meisten Gesprächen stellen Klienten einen Bezug zu ihrer Identität her und thematisieren Aspekte ihres Selbstkonzeptes. Deshalb lag die Entwicklung der oben aufgeführten Thesen nahe.
Die hauptsächlich zum Thema Sozialtherapie verwendete Literatur ist von Schwendter, Richter und Keupp. Diese Autoren werden zur Erörterung herangezogen, weil sie wichtige Grundverständnisfragen und Haltungen klären. Zum Zweck der Konkretisierung werden dann geeignete Konzepte, Modelle und Methoden für die Sozialtherapie daraus abgeleitet. Die dafür verwendete Literatur ist thematisch weit gestreut, entspricht aber den grundsätzlichen Maßgaben von Schwendter, Richter und Keupp. Auffallend ist dabei, dass sowohl alte wie auch aktuelle Beiträge hier zum Zuge kommen. Dies soll verdeutlichen, dass Sozialtherapie im Grunde bereits seit den 30er Jahren Gegenstand von Behandlungskonzepten bzw. -planungen ist. Aktuellere Beiträge beispielsweise von Binner und Ortmann konkretisieren die Sozialtherapie.
Krappmann hat der Entwicklung der Identitätstheorie 1969 einen wichtigen Impuls gegeben. Die von ihm vertretene Interaktionsthese gilt bis heute als unbestritten und wird von anderen Autoren aufgegriffen und vertieft. Frey und Haußer geben dafür ein Beispiel. Schließlich hat sich Keupp, Straus und Höfer mit der Identitätsthematik vor dem Hintergrund der Postmoderne beschäftigt. Sie haben das Modell der alltäglichen Identitätsarbeit entworfen, das hier als wichtige Grundlage für die Entwicklung eines Behandlungsansatzes darstellt.
Der Behandlungsansatz stütz sich auf biografische Narrationen. Eine auf biografischnarrativen Gesprächen basierende aktuelle Studie von Blezinger, Köttig, Rosenthal und Witte sowie die von Glinka erarbeitete Einführung in die narrative Interviewtechnik fließen als wichtige Quellen mit ein.
1.1 Skizze
Die folgende Skizze soll die Struktur der Arbeit verdeutlichen. Die Gesamtanalyse wird auf der Grundlage von zwei Theorieteilen erstellt, versucht diese zu verbinden und mündet schließlich in einem Behandlungsansatz, der biografische Narrationen in den Mittelpunkt rückt. Hierin ist schließlich auch das Fazit der Arbeit zu sehen.
Die Thematik der Sozialtherapie ist kegelförmig angeordnet. Dieser Kegel soll die inhaltliche Konkretisierung versinnbildlichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1 Sozialtherapie - Horizontbestimmung
Zunächst gilt es zu klären, was unter Sozialtherapie grundlegend zu verstehen ist. Die Auffassungen differieren teils in unterschiedlichste Richtungen. Der Blick in das Fachlexikon der Sozialen Arbeit gibt darüber einen ersten Aufschluss. Hier beschreibt Lippenmeier in der Fassung von 1997 die Sozialtherapie als Psychotherapeutische Methode, welche sich die gezielte Beeinflussung des sozialen Umfelds von Klienten zum Schwerpunkt macht (vgl. Lippenmeier, 1997, 900). In der Auflage von 2007 benennt er im gleichen Lexikon die Sozialtherapie als ein psychosoziales Verfahren der gezielten Einflussnahme auf krankmachende Faktoren in sozialen Beziehungen und soz. Umfeld von Klienten (Lippenmeier, 2007, 914). In dieser Definition nimmt Lippenmeier Abstand vom psychotherapeutischen Bezug und gibt der Sozialtherapie eine konkretere Zielrichtung bzw. Aufgabenstellung.
Dieser Umstand verdeutlicht einmal mehr den Entwicklungsprozess, in dem sich die Sozialtherapie befindet. Nicht zuletzt tauchen vor diesem Hintergrund verschiedene Termini auf, die im Zusammenhang mit der Sozialtherapie stehen bzw. in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel Soziale Therapie (Schwendter, 2000, 8), klinische Sozialarbeit, Soziotherapie etc.
Setzt man sich nun das Ziel der einigermaßen befriedigenden Klärung, erscheint es wichtig, zunächst die Grundhaltungen bzw. Betrachtungsweisen darzustellen, die den Entwicklungsprozess der Sozialtherapie in neuerer Zeit beeinflussen.
2.2 Soziale Therapie nach Schwendter
Schwendter schreibt: Meiner Ansicht nach ist Soziale Therapie die Reflexion auf die Gleichzeitigkeit gesellschaftlicher und psychischer Ursachen je bestehender Leidenserfahrungen, verbunden mit dem Ensemble möglicher Interventionen zur Behebung oder Minderung dieser. (Schwendter, 2000, 15). Gemeint ist eine Therapieform, die im Gegensatz zum individualisierenden Vorgehen die Bedeutsamkeit und Gleichzeitigkeit von sozialen und gesellschaftlichen Faktoren sowie deren Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit anerkennt und fokussiert.
Schwendter sieht zwei wichtige Säulen, nämlich Sozialtherapie einesteils als Reflexion und anderenteils als Interventionsschwerpunkt.
Mit der Reflexion meint Schwendter eine spezielle Art sozialer Anamnese und bezeichnet diese als integrales Moment Sozialer Therapie (Schwendter, 2000, 16). Sie erfasst Probleme bzw. Leidenserfahrungen von Menschen und ist sich zugleich deren gesellschaftlichen bzw. sozialen und psychischen Ursachen bewusst. Die angesprochene Reflexion geht im Kern davon aus, dass Leidenserfahrungen, sozialer bzw. gesellschaftlicher Kontext, Umwelt und psychische Verfassung von Menschen in einem interaktiven sowie dynamischen und auch gleichzeitigen Zusammenhang stehen.
Es lässt sich weiter aus der Sozialen Therapie ableiten, dass sich auch die im psychosozialen Praxisfeld beruflich Tätigen und die Institutionen, in denen sie arbeiten, der Reflexion stellen müssen. Sie sind damit Bestandteil der sozialen Anamnese. Im Hinblick auf Probleme von Menschen oder sozialen Gruppen stellen sie wesentliche Einflussgrößen für einen Therapieprozess dar (vgl. Schwendter, 2000, 18). Der soziale Kontext muss in einem komplexen, nämlich in einem gesellschaftlichen Zusammenhang gesehen werden. Schwendter schreibt hierzu: Häufig wird in der Verknüpfung der Vielzahl diverser Leidenserfahrungen von einer Person, einer Gruppe, einem Gemeinwesen geradezu ein Regelkreis sichtbar, wie die eine […] Leidenserfahrung durch die […] drei nächsten verstärkt wird…(Schwendter, 2000, 17). Eine detaillierte soziale Anamnese in der Sozialen Therapie muss die Verknüpfungen dieser Regelkreise wahrnehmbar machen. Nur so werden diese für eine Soziale Therapie zugänglich. Insgesamt öffnet Schwendter der Sozialen Therapie ein sehr großes Anwendungsgebiet. Sie wendet sich Personen, Gruppen und schließlich auch dem Gemeinwesen und ganzen Regionen zu. Soziale Anamnese als Teil der Sozialen Therapie bedarf wissenschaftlich praxisorientierter Forschung. Schwendter schlägt beispielsweise die teilnehmende Beobachtung als Forschungsmethode vor (vgl. Schwendter, 2000, 26 f.). Der bereits angedeutete andere Teil der Sozialen Therapie neben der sozialen Anamnese ist der Interventionsschwerpunkt. Ohne ihn wäre die Soziale Therapie lediglich reine Soziologie und könnte keine therapeutische Wirkung entfalten.
Der Interventionsschwerpunkt beinhaltet alle Handlungsmöglichkeiten, jegliches „Handwerkszeug“ bzw. jegliche Methoden, die potentiell zur Behebung oder Minderung von Problemen beitragen. Schwendter spricht von einem Ensemble möglicher Interventionen, über das man bewusst verfügen und deshalb fortwährend neu reflektieren muss (vgl. Schwendter, 2000, 15).
Auffallend ist bei Schwendter, dass er ausgewählte Kontexte (z.B. Familie, Schule, Institutionen) detailliert aufzeigt und diese direkt in Verbindung mit der Sozialen Therapie bringt. Er schreibt hierbei von exemplarischen Orten Sozialer Therapie (vgl. Schwendter, 2000, 185 - 228). Diese Analyse untermauert seine primäre Vorstellung von Sozialer Therapie, die eingangs schon zitiert wurde. Des Weiteren zeigt sich in seiner Analyse ein Settingansatz, denn settingorientierte Interventionen richten sich sowohl an die strukturellen Bedingungen eines Settings, als auch an die in einem Setting involvierten Personengruppen (vgl. Techniker Krankenkasse, 2003).
2.3 Sozialtherapie nach Richter
Mit vergleichbaren Ansichten, wie die bisher dargestellten, charakterisiert Richter die Sozialtherapie, welche für ihn zunächst einmal eine neue Sichtweise von Therapie darstellt. Den Grund dafür sieht er in der zunehmenden Überzeugung, dass psychisches Wohlbefinden soziales Wohlbefinden einschließt und zugleich voraussetzt. Mit einem solchen Fokus kommt er zu der Einschätzung, dass jede Therapie mehr und mehr auch soziale Therapie sein muss (vgl. Richter, 2005, 887).
Sozialtherapie bezieht sich auf Menschen in ihren komplexen sozialen Zusammenhängen. Hierzu gehören persönliche Beziehungen, Wohn- und ökonomische Verhältnisse, Arbeitssituation und Probleme von Menschen mit bzw. in Institutionen. Diese sozialen Faktoren können verantwortlich dafür sein, dass Menschen erkranken, sich sozial nicht mehr zurechtfinden oder dass Menschen von Krankheiten nicht genesen. Richter arbeitet an dieser Stelle einmal mehr den Unterschied zur Individualtherapie heraus, welche Krankheit oder Leiden lediglich als persönliche Angelegenheit eines Betroffenen behandelt. Für ihn bestimmt sich der sozialtherapeutische Ansatz aus einem sozialbezogenen Gesundheitsbegriff heraus, der schließlich auf ein möglichst gleiches und gemeinsames Wohlergehen aller in einer Gesellschaft, die von dem Prinzip der Solidarität geleitet und strukturiert wird abzielt (Richter, 2005, 888).
Ein schlagkräftiges Argument für eine solche bzw. seine Perspektive liefert der Sachverhalt, dass Menschen aus unteren Sozialschichten am ehesten einem Scheitern oder einem psychosozialen Erkranken ausgesetzt sind. Des Weiteren hat genau dieser Personenkreis weniger Möglichkeiten der Genesung und scheitert rasch einmal mehr aufgrund von Stigmatisierungen bzw. Individualzuschreibungen, die das soziale Umfeld über ihn trifft (vgl. Richter, 2005, 888).
Aus praktischen Gründen liegt es zwar nahe, die unmittelbare Behandlungsintervention auf einen engen psychosozialen Problemkreis zu begrenzen (z.B. Kommunikationsschwierigkeiten in einer Paarbeziehung), im Kern ist der sozialtherapeutische Standpunkt jedoch ein sehr viel weit gefasster. Die Kommunikationsschwierigkeiten in einer Paarbeziehung sind demnach vielmehr in Verbindung mit den allgegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen zu bringen (z.B. Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile und zunehmende Rollenunsicherheit) (vgl. Richter, 2005, 887).
Die Entwicklung sozialtherapeutischen Denkens geht mit sozialanalytischen und sozialkritischen Reflexionen einher. Auf den Prüfstand kommen hierbei komplexe Sachverhalte bzw. Zusammenhänge, die einen ganzheitlichen Zugang zur sozialen Problematik einer Person, einer Gruppe oder eines Gemeinwesens ermöglichen soll. In diesem Blickwinkel darf auch nicht vor politischem Engagement zurück geschreckt werden. Dieses ist ebenfalls Teil sozialtherapeutischen Handelns und Denkens.
Große Defizite in der psychosozialen Praxis zeigen sich nach Richter in mangelhafter Koordinierung von sozialen Diensten untereinander und anhand nicht vorhandener Übereinkünfte für ganzheitliche Betreuungskonzepte. Somit werden soziale Aspekte, biologische Aspekte und psychische Aspekte eines Betroffenen nicht zusammenhängend gesehen und verstanden, sondern einzeln und nicht miteinander abgestimmt behandelt. Die moderne Sozialtherapie tritt diesem Effekt entgegen und setzt sich im Wesentlichen das Ziel, ganzheitliche Betrachtungsweisen und Behandlungskonzepte zu etablieren. Richter fordert zudem ein stärkeres interdisziplinäres Zusammenwirken der verschiedenen Berufsgruppen in Institutionen der Gesundheitshilfe, bei dem die sozialen Faktoren größere Berücksichtigung finden müssen (vgl. Richter, 2005, 888 f.).
2.4 Die gemeindepsychologische Perspektive nach Keupp
Spätestens an dieser Stelle muss ein weiterer Autor zum Thema Sozialtherapie aufgeführt werden. Heiner Keupp schreibt nicht explizit über die Sozialtherapie. Was jedoch Keupp unter gemeindepsychologischer Perspektive versteht, meint im Kern Sozialtherapie, wie sie hier bisher dargestellt wurde. Schwendter bezieht sich zudem direkt auf Keupp, indem er die gemeindepsychologische mit der sozialtherapeutischen Perspektive gleichsetzt (vgl. Schwendter, 2000, 264).
Eine gemeindepsychologische Perspektive versucht sich an der Rekonstruktion sozialen Alltags, die ihn prägenden spezifischen Lebenswelten und deren Bedeutung für die in ihnen lebenden Menschen. Sein gezieltes Augenmerk richtet Keupp auf die Netzwerkanalyse, welche zum einen die Struktur der sozialen Beziehungen eines Individuums beschreibt und zum anderen Handlungsmöglichkeiten von Menschen aufdeckt (vgl. Keupp, 1982, 44 f.).
Die gemeindepsychologische Perspektive, die das Netzwerkkonzept verinnerlicht, zielt über die „klinische Perspektive“ hinaus, die sich auf die Persönlichkeit eines leidenden Individuums konzentriert und hat damit entscheidende Bedeutung für die psychosoziale Praxis (Keupp, 1982, 44).
Keupp sieht psychisches Leiden im gesellschaftlichen Durchschnitt als ein zunehmendes Antwortmuster der Subjekte auf gesellschaftliche Ansprüche, Belastungen und Widersprüche an (vgl. Keupp, 1982, 14). So kommt er in einer These zu folgendem Schluss: Eine gemeindepsychologische Perspektive orientiert die psychosoziale Praxis an psychischen, sozialen und materiellen Ressourcen in der konkreten Lebenswelt, an den Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen und nicht nur an den Defiziten. Sie plädiert […] für eine Grundhaltung, die therapeutische Techniken als organisierte Erfahrungsbildung begreift, auf die in konkreten Situationen, in einer spezifischen Beziehungsanalyse zurückgegriffen werden kann. (Keupp, 1982, 16).
Keupp benennt des Weiteren, dass eine gemeindepsychologische Perspektive am ehesten als spezifische Grundhaltung zu charakterisieren ist. Hierbei möchte er sich jedoch einen Punkt offen halten, indem er schreibt, die gemeindepsychologische Perspektive lässt sich nicht über disziplineigene Methoden und Theorien definieren (vgl. Keupp, 1982, 11). Der zuletzt dargestellte Umstand zeigt sich als mindestens diskussionswürdig, da mittlerweile spezielle Berufszweige auf der genannten „organisierten Erfahrungsbildung“ aufbauen und sehr wohl auf disziplineigene Methoden und Theorien verweisen können, zum Beispiel die klinische Sozialarbeit. Sie gibt es in Deutschland aber auch noch nicht so lange, wie die Keuppschen Thesen zur gemeindepsychologischen Perspektive. Dass die Sozialtherapie ebenfalls auf organisierter Erfahrungsbildung basiert und zunehmend auch auf disziplineigene Methoden und Theorien aufbaut, soll in dieser Arbeit aufgezeigt werden. Auf weitere Thesen von Keupp zu dieser Thematik wird später noch eingegangen.
Grundlegend ist bereits an diesem Punkt der Horizont von Sozialtherapie in etwa bestimmt. Es ging bisher primär um das Selbstverständnis von Sozialtherapie. Richter und Schwendter haben hierfür eine sehr prägende Theoriebildung geleistet und Grundlagen gebildet. Hierauf verweist beispielsweise auch Olm (vgl. Olm, 2004, 142, 147). Keupp hingegen hat sich gezielter der Thematik der psychosozialen Praxis gestellt. Seine vorgeschlagene gemeindepsychologische Perspektive enthält ebenfalls Aspekte, die für die Sozialtherapie idealtypisch sind. Die Verwandtschaft zwischen gemeindepsychologischer Perspektive und Sozialtherapie wird an späterer Stelle noch einmal beleuchtet.
2.5 Zusammenfassung
In der nun folgenden Zusammenfassung der bisher dargelegten Aspekte soll noch deutlicher zum Ausdruck kommen, welches Selbstverständnis die Sozialtherapie hat. Für eine bessere Übersicht sorgen die thesenartig hervorgehobenen Stichpunkte. Verbindungen zu speziellen Konzepten werden hergeleitet. Dann können auch Abgrenzungen und Verbindungen zu anderen Termini vorgenommen werden.
- Sozialtherapie setzt das Leiden von Menschen immer in Bezug zur sozialen, gesellschaftlichen, ökonomischen und gesundheitlichen Lebensrealität. Sie sieht Probleme bzw. Belastungen immer im Kontext der sozialen Bezüge von Menschen.
Insbesondere Krankheit und Gesundheit werden damit als multifaktorielle bzw. auch multidimensionale Phänomene verstanden. Für die Minderung von psychosozialem Leiden ggf. auch für die Überwindung von Krankheit werden Ressourcen auf verschiedenen Ebenen gesucht. Diese gilt es zu aktivieren und zu fördern. Die Sozialtherapie setzt auch hier besonders den Fokus auf den sozialen Kontext.
- Die Sozialtherapie kann in zweierlei Hinsicht aufgefasst werden:
1.) Sozialtherapie im erweiterten und
2.) Sozialtherapie im engeren Sinne.
Dieser Aufteilung zu Folge hätte Sozialtherapie im erweiterten Sinne einen gemeinwesenorientierten Schwerpunkt mit politischer Ambition. Sozialtherapie im engeren Sinne hätte hingegen einen subjektbezogenen Schwerpunkt, der sich als Behandlung beschreiben lässt.
- Sozialtherapie als soziale Bewegung: Besonders die Ausführungen von Schwendter und Richter lassen Züge einer solchen Haltung für die Sozialtherapie erkennen. Sie ist letztendlich auf Minderung und Beseitigung sozialer Probleme auf sehr breiter bzw. gesellschaftlicher Ebene gerichtet und zeigt sich schließlich als Sozialtherapie im erweiterten Sinne.
Schwendters Soziale Therapie richtet ihren Fokus auf Einzelne und Gruppen, aber auch auf Gemeinwesen bis hin auf ganze Regionen und schließt beispielsweise Lobbyarbeit und Unterstützung von Bürgerinitiativen mit ein (vgl. Schwendter, 2000, 277 f., 284 f.). Dies ist konsequent, wenn der gesellschaftliche bzw. soziale Kontext bei der Ursachensuche nach sozialen und psychischen Problemen von Menschen herangezogen wird. Schließlich entwickelt Schwendter das Anliegen, Soziale Therapie auch im Sinne sozialer Bewegung mit der Absicht gesellschaftlichen Wandels zu verstehen.
Beginnend damit, dass sich Sozialtherapie an einzelne Menschen in ihren bio-psycho- sozialen Bezügen richtet, schreitet Richter rasch alle Ebenen von Betätigungsfeldern der Sozialtherapie ab und erreicht schließlich die Ebene der Politik. Auch hier gibt es das Betätigungsfeld der Sozialtherapie, will sie doch auf einer großen Bandbreite von sozialen Faktoren positiven Einfluss nehmen. Sie setzt sich schließlich das Ziel einer sozialbezogenen Gesundheitsperspektive, in der es um gleiches und gemeinsames Wohlergehen bzw. Wohlbefinden aller geht (vgl. Richter, 2005, 888 ff.).
Diese übergeordnete Absicht von beiden Autoren ist sicherlich für die grundsätzliche Haltung wichtig, wenn in der Praxis sozialtherapeutisches Handeln umgesetzt wird. Sowohl Schwendter als auch Richter haben damit einen wichtigen Teil für das Grundverständnis von Sozialtherapie erarbeitet.
Dieses Grundverständnis muss sich jedoch wiederum vor unrealistischen Allwirksamkeits- und Erfolgsphantasien abgrenzen. Keupp warnt vor einem grenzenlosen Bewältigungsoptimismus, der vor dem Hintergrund großer gesellschaftlicher Probleme, wie zum Beispiel die Langzeitarbeitslosigkeit, unangebracht ist (vgl. Keupp, 1982, 20). In diesem Punkt zeigt sich ein gewisser Pragmatismus, auf den Richter und Schwendter nicht verweisen.
Anhand einer These von Keupp kann sein gesellschaftskritisches Grundverständnis für psychosoziale Praxis verdeutlicht werden. Bezogen auf die psychosoziale Tätigkeit formuliert er: Noch so umwälzende Konzepte und Handlungsmodelle blieben wirkungslos, wenn sie nicht politisch und professionell angeeignet, also nicht handlungsfähig, gemacht werden. (Keupp, 1982, 12).
Hierzu noch einmal folgender Hinweis: Ich spreche an dieser Stelle von Sozialtherapie im erweiterten Sinne.
- Die Zielstellung im Sinne von Behandlung hinsichtlich einzelner, von bio- psycho-sozialen Leiden betroffener Menschen kann wie folgt formuliert werden: Sozialtherapie geht es im Kern um die Förderung sozialer Kompetenzen, über die sich die Teilhabe am sozialen Leben in Gemeinschaft und Gesellschaft und am darin enthaltenen Unterstützungspotenzial für die Hilfe suchenden Menschen bestmöglich fördern und sichern lässt… (Binner, Ortmann, 2008, 85).
Die Sozialtherapie nimmt Einfluss auf krankmachende Faktoren in sozialen Beziehungen und sozialer Umwelt. Als besondere Kompetenz darf die gezielte Interaktion zwischen Sozialtherapeuten und Betroffenen bzw. die gezielte Interaktion von Betroffenen untereinander genannt werden. Diese Interaktion mündet einerseits in der Behandlung sozialer Störungen und andererseits in der Förderung sozialer Kompetenzen. In diesem Sinne versteht sich Sozialtherapie als subjektbezogene bzw. subjektorientierte Behandlungsmethode. Bezugnehmend auf die vorgenommene Strukturierung wird hier die Kategorie Sozialtherapie im engeren Sinne.
- Ein weiterer wesentlicher Aspekt für das Selbstverständnis von Sozialtherapie besteht darin, dass das psychosoziale Berufsfeld fortwährend auf einem Prüfstand kritisch beleuchtet und die sozialtherapeutisch Tätigen ihr Handeln reflektieren.
So wurde bereits hervorgehoben, dass der sozialtherapeutische Blickwinkel Probleme bzw. Leidenserfahrungen als sehr komplexe Phänomene wahrnimmt. Dieser Blickwinkel muss immer wieder neue Impulse erfahren und stimuliert werden. Dies sollte mittels Supervision, fachlichem Austausch und Fortbildungen geschehen. Hier geht es einerseits um fachlich qualitative Angelegenheiten und deren Optimierung. Andererseits geht es generell auch um strukturelle Bedingungen in der psychosozialen Praxis und deren Verbesserungsmöglichkeiten.
Aus dem Blickwinkel der Sozialtherapie werden keineswegs andere Behandlungsweisen, wie zum Beispiel eine pharmakotherapeutische Behandlung, kategorisch negativ bewertet und abgelehnt. Aber ausgehend von der sozialtherapeutischen Haltung müssen sich sämtliche Interventionen bzw. Behandlungen immer auch der kritischen und vor allem sozialethischen Reflexion unterziehen. Die nötige Berücksichtigung aller gesamten
Aktivitäten, die in Bezug auf Personen unternommen werden, mündet schließlich in einer interdisziplinären Ausrichtung.
- Die Sozialtherapie (nach Richter), die Soziale Therapie (nach Schwendter) und die gemeindepsychologische Perspektive (nach Keupp) kennzeichnet sich aus durch eine Distanz zum ausschließlich psychotherapeutischen Bezug. Allen drei Theoretikern geht es um eine mindestens gleichwertige Alternative zur Individualtherapie.
Die Autoren sehen im individualisierenden Vorgehen, wie es für klassische psychotherapeutische Methoden in der Regel typisch ist, keine Vereinbarkeit mit der Sozialtherapie. Gleichfalls ist es nach Schwendter abwegig, Sozialtherapie als Behelfsersatz für psychotherapeutische Behandlung zu sehen, der zudem nur nachrangig angewandt wird (vgl. Schwendter, 2000, 7).
Dieses Selbstverständnis von Sozialtherapie bringt auch Richter zum Ausdruck, indem er die Wichtigkeit sozialen Wohlbefindens hervorhebt. Soziales Wohlbefinden ist seiner Ansicht nach in erster Linie vom sozialen Kontext, also von sozialen Faktoren einschließlich der sozialen Schichtzugehörigkeit abhängig. An diesem Punkt schätzt er die klassische Individualtherapie für weniger hilfreich ein (vgl. Richter, 2005, 887). Eine weitere These von Keupp soll diesen Aspekt untermauern. Im Hinblick auf die psychosoziale Praxis schreibt er: Wird psychisches Leiden und seine professionelle Bearbeitung im größeren Rahmen ihrer gesellschaftlichen Situierung und Funktionalität gesehen, reichen psychologische Sichtweisen, welcher Schule auch immer, nicht mehr aus.
(Keupp, 1982, 17).
Es sei an dieser Stelle zugleich auf Victor von Weizsäcker verwiesen, der sehr konkret auf Sozialtherapie eingeht, indem er soziale Krankheit und soziale Gesundung als expliziten Behandlungsbereich definiert und beschreibt (vgl. Weizsäcker, 1930, 33 - 52). Hierauf wird später noch eingegangen, wenn die Bezugskonzepte und -modelle der Sozialtherapie genauer beschrieben werden.
- In der Sozialtherapie verorten sich verschiedene Modelle, Konzepte und Methoden. Diese verschaffen dem Selbstverständnis von Sozialtherapie einen praktischen Bezug und fachlichen Rahmen. Sie weisen allerdings nicht nur auf Klienten bezogene, sondern auch sozialstrukturelle Aspekte auf, die für die sozialtherapeutische Arbeit wichtig sind.
Zunächst soll darauf hingewiesen werden, dass die Auswahl der folgenden Konzepte keine Neuigkeit ist. Keupp und Rerrich, Binner und Ortmann und Schwendter selbst, um nur einige zu nennen, haben diese bereits getroffen. Ich lehne mich in diesem Punkt also lediglich an deren Ausführungen an. Dennoch ist es wichtig, diese Auswahl hier aufzuführen, denn sie soll der Positionierung dienen. Darüber hinaus lässt sich anhand der Konzepte, Modelle und Methoden leichter ableiten, welche Kompetenzen für die sozialtherapeutische Praxis notwendig sind.
Es wurden bereits zwei Schwerpunkte der Sozialtherapie genannt - einesteils die soziale Anamnese und anderenteils der Interventionsschwerpunkt. Daraus lassen sich zwei Konzeptschwerpunkte extrahieren:
- Soziale Anamnese und diagnostisches Arbeiten
- Interventionsstrategien und Handlungsmethoden
Verschiedene Autoren verweisen beim Thema Sozialtherapie wiederholt auf Victor von Weizsäcker (vgl. Hahn, Pauls, 2008, 27; Schwendter, 2000, 7; Lippenmeier, 1997, 900). Seine Entwürfe zur sozialen Krankheit und Gesundung sollen auch hier Berücksichtigung finden:
- Soziale Krankheit und Gesundung
Richter geht es insbesondere um ganzheitliche Verstehens- und Betrachtungsweisen von Problemen sowie um ganzheitliche Interventionskonzepte (Betreuungs- und Behandlungskonzepte). Er fordert diesbezüglich, dass die Zusammenhänge von sozialen, physischen und psychischen Aspekten erkannt werden müssen. Als hilfreich erscheint es daher, das folgende Modell heranzuziehen:
- Das bio-psycho-soziale Modell
Desgleichen entwirft Richter eine sozialbezogene Gesundheitsperspektive für sozialtherapeutisches Handeln. Schwendter benennt anfänglich die Soziale Ätiologie als wesentlicher Gegenstand der Sozialtherapie. Betrachtet man allerdings die Formen seiner Interventionen, lässt sich daraus ebenfalls eine sozialorientierte, gesundheitsfördernde Prämisse herauslesen (vgl. Schwendter, 2000, 229-294). Dass für die Erfassung von Problemen bzw. Leidenserfahrungen auch die Krankheitsgeschichte erhoben werden muss, versteht sich von selbst. Entsprechend ihrem Selbstverständnis stellt sich aber die Sozialtherapie mehr die Frage: Was macht bzw. erhält den Menschen gesund? Deshalb liegt es nahe einen Blick auf die Gesundheitsförderung und das Gesundheitsverständnis der Sozialtherapie zu werfen:
- Gesundheitsförderung und das Gesundheitsverständnis in der Sozialtherapie
Schwendter widmet ein Kapitel seiner zahlreichen Interventionsstrategien der Herstellung sozialer Netzwerke bzw. dem Konzept der sozialen Unterstützung (vgl. Schwendter, 2000, 264-270). Es muss jedoch dringend darauf hingewiesen werden, dass das Konzept der sozialen Netzwerke bzw. das Konzept der sozialen Unterstützung zuvor eingehend von Keupp bearbeitet wurde und Schwendter sich dicht daran anlehnt (vgl. Keupp, 1982, 43- 53, vgl. Schwendter ebd.). Aber dies ist schließlich ein Grund mehr, das Netzwerkkonzept bzw. die soziale Unterstützung aufzunehmen:
- Soziale Unterstützung, Netzwerkarbeit
Bisher wurden Schwendter, Richter und Keupp als wesentliche Autoren aufgeführt. Die Thematik Sozialtherapie erschien mitunter als eine sehr komplexe, eher wenig eingegrenzte Angelegenheit. Dies liegt daran, dass die aufgeführten Autoren einerseits wesentliche Theoriebildung geleistet haben und andererseits Sozialtherapie im erweiterten Sinne definieren.
Dies ändert sich nun. Die verschiedenen Modelle und Konzepte, die hergeleitet wurden, verdeutlichen konkreter den praktischen Bezug und fachlichen Rahmen der Sozialtherapie. Damit verengt sich die Thematik Sozialtherapie zunehmend, kann dann aber auch konkreter bearbeitet werden. Dieser Effekt führt zugleich dazu, dass die Sozialtherapie im Rahmen dieser Arbeit als eine subjektbezogene bzw. subjektorientierte Behandlungsform dargestellt und vertreten wird, d.h. Sozialtherapie im engeren Sinne.
Bevor jedoch auf die Modelle und Konzepte genau eingegangen wird, sollen einige Abgrenzungen und Verwandtschaften zu anderen Termini bzw. Therapieformen aufgezeigt werden. Nachdem dann die Modelle und Konzepte vorgestellt wurden, wird am Schluss des gesamten Themenbereichs Sozialtherapie eine konkrete Aufbereitung erfolgen, die aus meiner Sicht die Sozialtherapie weitgehend definiert.
Kapitel 3 - Abgrenzungen und Verwandtschaften der Sozialtherapie
3.1 Sozialtherapie in Abgrenzung zur Soziotherapie
Soziotherapie ist gemäß § 37a SGB V eine Krankenkassenleistung. Ihre primäre Zielstellung ist die Vermeidung oder Verkürzung von Krankenhausbehandlungen. Anspruchsberechtigt sind Versicherte, die aufgrund ihrer schweren psychischen Erkrankung nicht in der Lage sind, ärztliche Leistungen zu beanspruchen. Als Therapiekonzept ist die Soziotherapie damit sowohl im Hinblick auf ihre Zielstellungen als auch im Hinblick auf die Anspruchsberechtigung - ein spezifisches Krankheitsbild - sehr stark eingegrenzt.
Das Inkrafttreten dieser Krankenkassenleistung hat zu einer klaren Definition und Positionierung von Soziotherapie geführt. Daran gemessen kann die Soziotherapie jedoch nicht mehr in Verbindung mit der Sozialtherapie gebracht werden. Es gilt hier eine Abgrenzung vorzunehmen, so wie dies Binner und Ortmann bereits tun. Aus deren Sicht ist die Soziotherapie ein Sonderfall, bei dem das soziotherapeutische Hilfepotential zu stark reduziert wurde und deshalb kaum Wirkung im sozialtherapeutischen Sinne entfalten kann (vgl. Binner, Ortmann, 2008, 72).
Dörner und Plog kommen zu der Einschätzung, dass Soziotherapie im stationären Kontext auf Alltagsbewältigungsbelange abzielt. Sie fördert die normalen, regelhaften, allgemeinen, alltäglichen, gesunden, nicht an Krankheit gebundenen, d.h. freien Anteile eines Individuums… (Dörner, Plög, 2002, 560). Hierfür sind in erster Linie Pflegepersonen, wegen ihrer ständigen Präsenz verantwortlich und kompetent (vgl. ebd.). Es liegt nahe, eine Abgrenzung vorzunehmen. Einerseits spiegeln sich die bisher dargestellten inhaltlichen Gesichtspunkte der Sozialtherapie nicht bzw. nur sehr verkürzt in der Soziotherapie als Krankenkassenleistung wieder. Zudem sei auf die unterschiedlichen Zielstellungen von Sozio- und Sozialtherapie in diesem Zusammenhang verwiesen. Darüber hinaus erscheint die Sichtweise von Dörner und Plog einleuchtend. Sie spricht dann aber ebenfalls für eine Abgrenzung, weil Soziotherapie in den Kompetenzbereich von Pflegepersonal delegiert wird und ebenfalls einen klar umrissenen und begrenzten Aufgabenbereich wahrnimmt.
3.2 Sozialtherapie und die Verwandtschaft zur klinischen Sozialarbeit
Die klinische Sozialarbeit versteht sich als Fachsozialarbeit und zielt auf den Erhalt, die Förderung und Verbesserung der bio-psycho-sozialen Gesundheit von Einzelnen, Familien und Gruppen ab. Die Aufgabenstellungen liegen nach Ansicht von Hahn und Pauls in der Beratung und in der professionell und sozialtherapeutisch fundierten, sozialen Unterstützung und Begleitung (vgl. Hahn, Pauls, 2008, 22). Sie nennen die Sozialtherapie vor dem Hintergrund der entsprechenden Theoriebildung durch Schwendter als Bezugspunkt der klinischen Sozialarbeit (vgl. Hahn, Pauls, 2008, 27).
Ortmann und Röh verstehen klinische Sozialarbeit im Kern als eine eigenständige Fachsozialarbeit, die sich in sozialarbeitsspezifischen Formen der Behandlung von sozio- psycho-somatisch zu verstehenden Störungen, Erkrankungen und Behinderungen entfaltet. (Ortmann, Röh, 2008, 9). Sie entwerfen eine „klinische“ Dimension, die über die reine individuelle Betrachtung von Störungen weit hinausgeht. Den Dreh- und Angelpunkt für die klinische Sozialarbeit sehen sie im Einbezug von sozialen Umweltbedingungen (vgl. ebd.).
Binner und Ortmann verstehen die Sozialtherapie als eine Spezialform sozialarbeiterischen Denkens und Handelns. Sie sehen keine Unterschiede in den Zielstellungen klinischer Sozialarbeit und Sozialtherapie. Aus professionstheoretischer Sicht kann die von uns entworfene Sozialtherapie zur Entwicklung eigener Verstehensmodelle und Behandlungskonzepte der Sozialarbeit für soziale Problemlagen beziehungsweise die soziale Dimension biopsychosozial zu verstehender Gesundheit und Krankheit beitragen.
(Binner, Ortmann, 2008, 86). Damit gehen sie den Versuch ein, Sozialtherapie als zentrale Methode der klinischen Sozialarbeit zu entwickeln (vgl. Ortmann, Röh, 2008, 11). Hierin ist nicht zuletzt eine recht genaue Positionierung bzw. Verortung der Sozialtherapie zu sehen, der ich mich in dieser Arbeit gern anschließe.
Es soll zugleich darauf verwiesen werden, dass nicht jede Form von Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik den Kern der Sozialtherapie und der klinischen Sozialarbeit trifft. Sie wurden zu Recht als Spezialformen der Sozialarbeit bezeichnet. Dies hängt damit zusammen, dass Sozialtherapie und klinische Sozialarbeit sich zunehmend als fachliche und methodische Spezialbereiche etablieren. Einen Hinweis dafür liefert die Klassifikation therapeutischer Leistungen der Deutschen Rentenversicherung. Hier werden spezielle Leistungen der Sozialtherapie und klinischen Sozialarbeit aufgeführt. Danach deckt lediglich Sozialarbeit/Sozialpädagogik mit entsprechenden Zusatzqualifikationen die erforderliche fachliche Kompetenz in ausnahmslos allen Leistungssegmenten ab (vgl. Deutsche Rentenversicherung, 2007, 119 - 131).
Ein Unterschied zwischen klinischer Sozialarbeit und Sozialtherapie besteht darin, dass die klinische Sozialarbeit das Sozialrecht als eigenen Kompetenzbereich mit einschließt.
3.3 Die Abgrenzung zur Sozialtherapie im Strafvollzug
Sozialtherapie im Strafvollzugskontext gemäß § 9 StVollzG grenzt sich in gewisser Weise vom eigentlichen sozialtherapeutischen Grundgedanken ab. So beinhaltet das Konzept der Sozialtherapeutischen Anstalt in der JVA Berlin Tegel einen überwiegend individualtherapeutischen Charakter. Aufgeführt sind drei Schwerpunkte: integrative Milieutherapie, tiefenpsychologischer und verhaltenstherapeutischer Arbeitsschwerpunkt (vgl. JVA Tegel, 2005). Die Entstehungsgeschichte der dortigen Sozialtherapie war sehr stark beeinflusst von den institutionsinternen Bedingungen der Vollzugsanstalten und nicht zuletzt auch von der Strafrechtsreform 1968. Ziel war hierbei eine Reformierung des Strafvollzugs, die in erster Linie die Sozial- und Kriminalprognose von Straftätern verbessern sollte (vgl. ebd.).
Zur Sozialtherapie im Vollzugskontext soll eine Abgrenzung vorgenommen werden. Sie entspricht einem Sonderfall, dessen Kerngedanke stark zielgruppenspezifisch angelegt und sowohl perspektivisch als auch theoretisch wohl kaum auf die gewöhnliche psychosoziale Praxis ausgerichtet ist. Zudem sei auf den stark individualtherapeutischen Charakter der Sozialtherapie im Vollzug verwiesen, der für eine Abgrenzung spricht.
3.4 Die Verwandtschaft zur gemeindepsychologischen Perspektive
Da bei der Horizontbestimmung bereits eine enge Verwandtschaft zwischen Sozialtherapie und gemeindepsychologische Perspektive anhand von einigen Thesen festgestellt wurde, braucht an dieser Stelle keine in dieser Richtung weiterführende Vertiefung erfolgen. Sie würde bisher Dargelegtes nur wiederholen. Allerdings soll ein Aspekt, den Keupp anspricht, aufgeführt werden.
Keupp verweist auf das Fachgebiet der Sozialepidemiologie. Sie stellt mit ihren Befunden eine wichtige Grundlage für die Gemeindepsychologie bzw. psychosoziale Praxis dar, weil sie versucht, Zusammenhänge zwischen Häufigkeitsbildern psychischen Leidens und Merkmalen gesellschaftlicher Strukturen aufzuspüren (Keupp, 1982, 23).
[...]
- Quote paper
- Stephan Richter (Author), 2009, Identitätsarbeit in der Sozialtherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269440