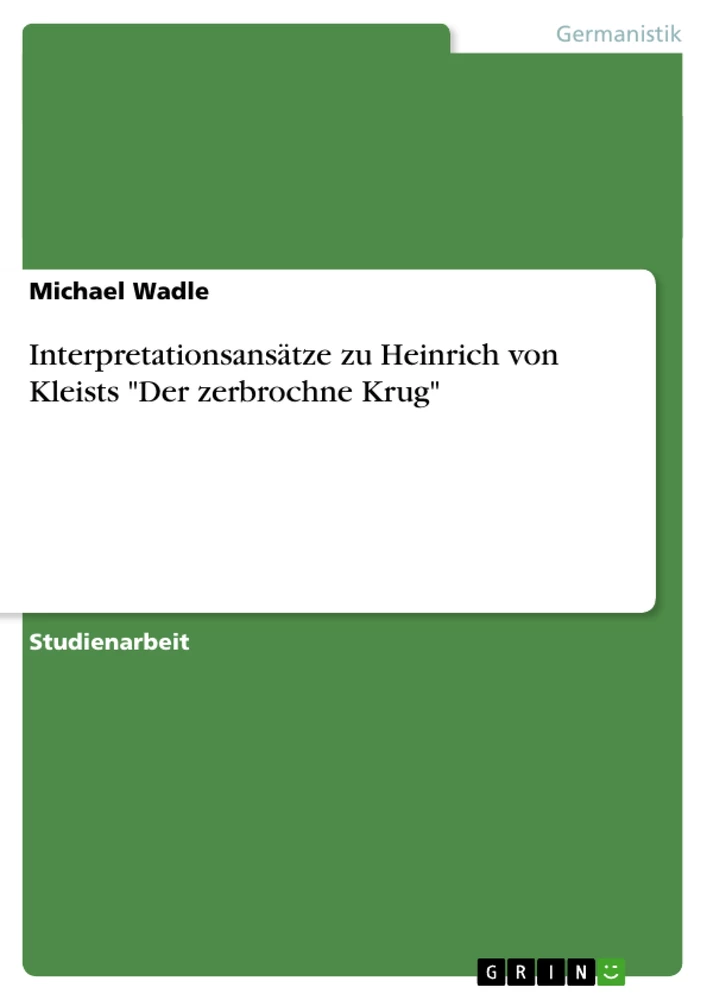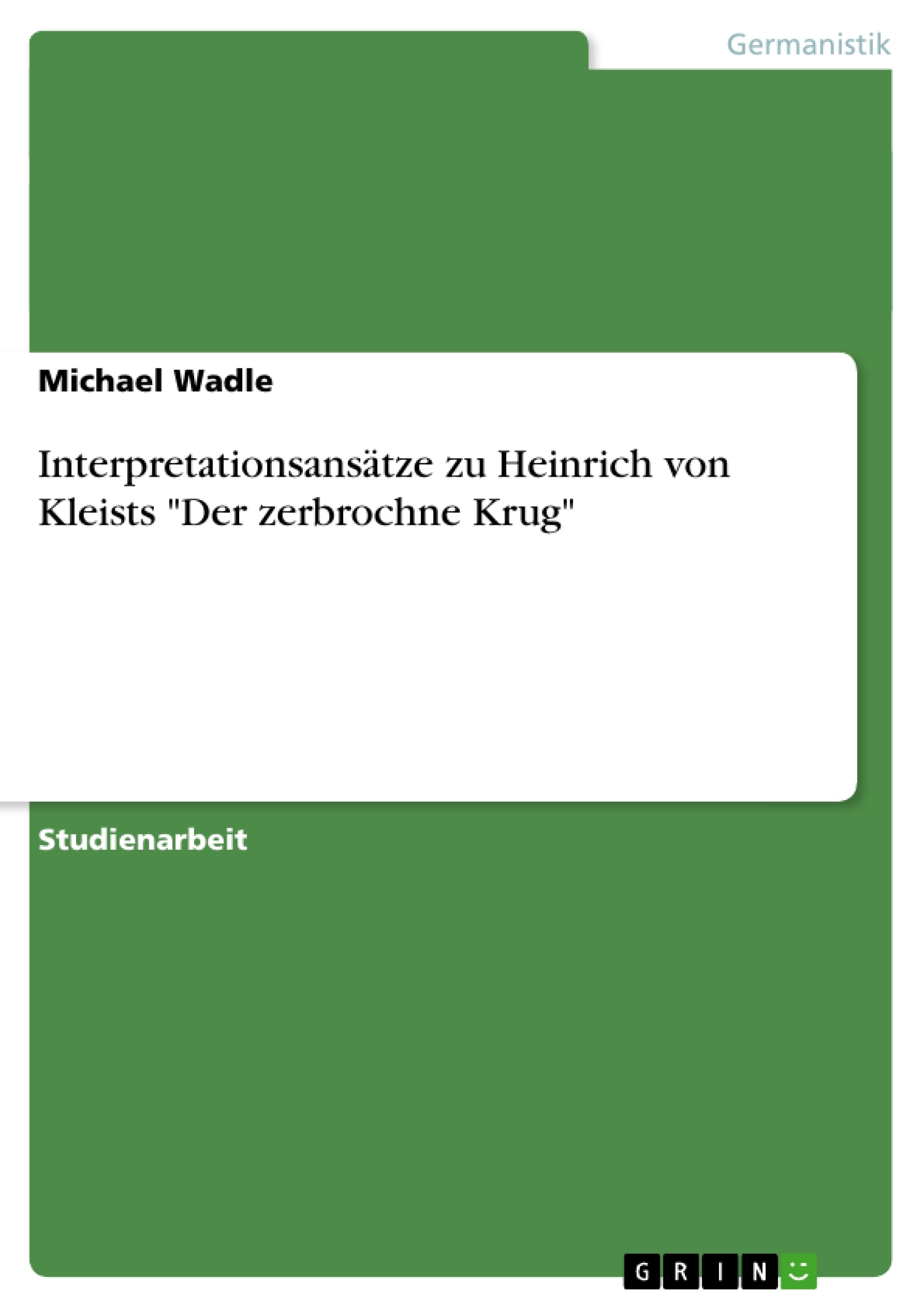Heinrich von Kleists einziges Lustspiel Der zerbrochne Krug entstand zwischen 1803 und 1806. Die Anregung zu diesem Stück erhielt der Dichter einer Anekdote zufolge 1802 während eines Aufenthalts in Bern. Demnach hat Kleist dort gemeinsam mit Ludwig Wieland und Heinrich Zschokke bei der Betrachtung eines Kupferstichs von Jean-Jacques Le Veau mit dem Titel „Le juge ou la cruche cassée“ beschlossen, einen „poetischen Wettkampf“ zu starten. „Für Wieland sollte dies Aufgabe zu einer Satire, für Kleist zu einem Lustspiele, für mich zu einer Erzählung werden“ 1 , berichtet Zschokke 1842 in seiner Selbstschau. Ob ein solcher Dichterwettstreit wirklich staatgefunden hat, ist in der literaturwissenschaftlichen Debatte umstritten, die Orientierung Kleists an dem Kupferstich von Le Veau, auf die Kleist in seiner „Vorrede“ zum Zerbrochnen Krug selbst hinweist, gilt jedoch als sicher. Auf diesem Stich ist hauptsächlich eine Gerichtsszene abgebildet, mit einem Mädchen im Mittelpunkt, das einen offenbar beschädigten Krug bei sich trägt. Das Original dieses Gemäldes stammte allerdings nicht, wie Kleist in seiner „Vorrede“ vermutet „von einem niederländischen Meister“ 2 , sondern von Louis-Philibert Debucourts.
Anhand dieses Gemäldes und unter Verarbeitung anderer Texte, wie die Tragödie König Ödipus von Sophokles und dem biblischen Sündenfall, entstand K leists vieldeutiges Lustspiel rund um den Dorfrichter Adam, der gezwungen ist, über seine eigene Verfehlung zu Gericht zu sitzen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS LUSTSPIEL DER ZERBROCHNE KRUG UND DIE TRAGÖDIE KÖNIG ÖDIPUS VON SOPHOKLES
- PARALLELEN ZWISCHEN DEM ZERBROCHNEN KRUG UND KÖNIG ÖDIPUS
- DER ZERBROCHNE KRUG ALS UMKEHRUNG DES KÖNIG ÖDIPUS
- WARUM IST DER ZERBROCHNE KRUG TROTZ SEINER PARALLELEN ZUR ANTIKEN TRAGÖDIE KÖNIG ÖDIPUS EINE DER GRÖẞTEN DEUTSCHEN KOMÖDIEN?
- JUSTIZKRITIK IM ZERBROCHNEN KRUG
- KLEIST ALS KRITIKER DER RECHTSSYSTEME UND DES JUSTIZWESENS SEINER ZEIT
- DER ZEITGESCHICHTLICHE HINTERGRUND IN BEZUG AUF DIE RECHTSPRECHUNG
- Der zerbrochne Krug als versteckte Kritik am Verfall des Gerichtswesens in Preußen seit Mitte des 18. Jahrhunderts.
- DIE REPRÄSENTANTEN DER VON KLEIST KRITISIERTEN JUSTIZ
- Der Dorfrichter Adam
- Der Gerichtsschreiber Licht
- Der Gerichtsrat Walter
- Der Konflikt zwischen althergebrachtem und neuem reformiertem Recht bzw. zwischen Lokaljustiz und der Zentralmacht.
- Der Konflikt zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Gerichtsverfahren.
- DIE PROBLEMATISIERUNG DER SPRACHE IM ZERBROCHNEN KRUG
- KLEISTS VERHÄLTNIS ZUR SPRACHE – SEINE SPRACHSKEPSIS
- MISSVERSTEHEN - DAS ANEINANDERVORBEIREDEN DER FIGUREN IM ZERBROCHNEN KRUG
- Der Gegensatz zwischen Juristen- und Laiensprache
- DIE MEHRDEUTIGKEIT DER SPRACHE - DAS SCHEMA DES VERDECKENS UND AUFDECKENS DER WAHRHEIT MIT DEM MEDIUM DER SPRACHE
- ZENTRALE DINGSYMBOLE IM ZERBROCHNEN KRUG
- DIE BEDEUTUNG DES KRUGS – SYMBOL FÜR EVES MÄDCHENEHRE ODER DEN NIEDERLÄNDISCHEN STAAT?
- DIE PERÜCKE – SYMBOL FÜR ADAMS RICHTERWÜRDE
- PARALLELEN ZWISCHEN DEM BIBLISCHEN SÜNDENFALL UND DEM ZERBROCHNEN KRUG
- DIE SPRECHENDEN NAMEN DER FIGUREN
- INHALTLICHE PARALLELEN ZWISCHEN DEM BIBLISCHEN SÜNDENFALL UND KLEISTS LUSTSPIEL
- SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ und untersucht seine Vielschichtigkeit und Bedeutungsebenen. Sie befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Stücks, darunter die Parallelen zur antiken Tragödie „König Ödipus“, die Kritik am Justizsystem der damaligen Zeit sowie die Rolle der Sprache und der Symbolik.
- Parallelen zwischen Kleists „Der zerbrochene Krug“ und Sophokles' „König Ödipus“
- Kritik am Justizsystem und Rechtssystem in Preußen im 18. Jahrhundert
- Die Bedeutung der Sprache und Missverständnisse im Stück
- Analyse von zentralen Symbolen im Lustspiel
- Verbindungen zum biblischen Sündenfall
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Stücks und seine Entstehungsgeschichte dar. Sie erläutert, dass Kleist sich bei der Gestaltung des Stücks unter anderem von einem Kupferstich von Jean-Jacques Le Veau inspirieren ließ.
Das zweite Kapitel setzt sich mit den Parallelen zwischen „Der zerbrochene Krug“ und der antiken Tragödie „König Ödipus“ auseinander. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Stücken aufgezeigt und analysiert, warum Kleists Werk trotz der Parallelen zur Tragödie eine Komödie ist.
Im dritten Kapitel wird Kleists Kritik am Rechtssystem seiner Zeit untersucht. Es wird aufgezeigt, wie Kleist in seinem Stück die Schwächen des Justizsystems und die korrupte Rechtsprechung aufzeigt und anprangert.
Kapitel vier befasst sich mit der Bedeutung der Sprache und den Missverständnissen im Stück. Es wird dargelegt, wie die Sprache im Stück zur Verdeckung und Aufdeckung der Wahrheit eingesetzt wird und wie die Figuren durch sprachliche Missverständnisse aneinander vorbeireden.
Das fünfte Kapitel analysiert zentrale Symbole im Stück, insbesondere den Krug und die Perücke. Es wird erläutert, welche Bedeutung diese Symbole für die Handlung und die Figuren haben.
Kapitel sechs widmet sich den Parallelen zwischen dem biblischen Sündenfall und Kleists Lustspiel. Es wird untersucht, inwiefern das Stück Elemente aus dem biblischen Sündenfall aufgreift und in eine neue, satirische Form überträgt.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug, König Ödipus, Justizkritik, Rechtssystem, Sprache, Missverständnis, Symbolik, biblischer Sündenfall, Komödie, Tragödie, Kritik, Satire, Gericht, Recht, Gerechtigkeit.
- Quote paper
- Michael Wadle (Author), 2004, Interpretationsansätze zu Heinrich von Kleists "Der zerbrochne Krug", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26916