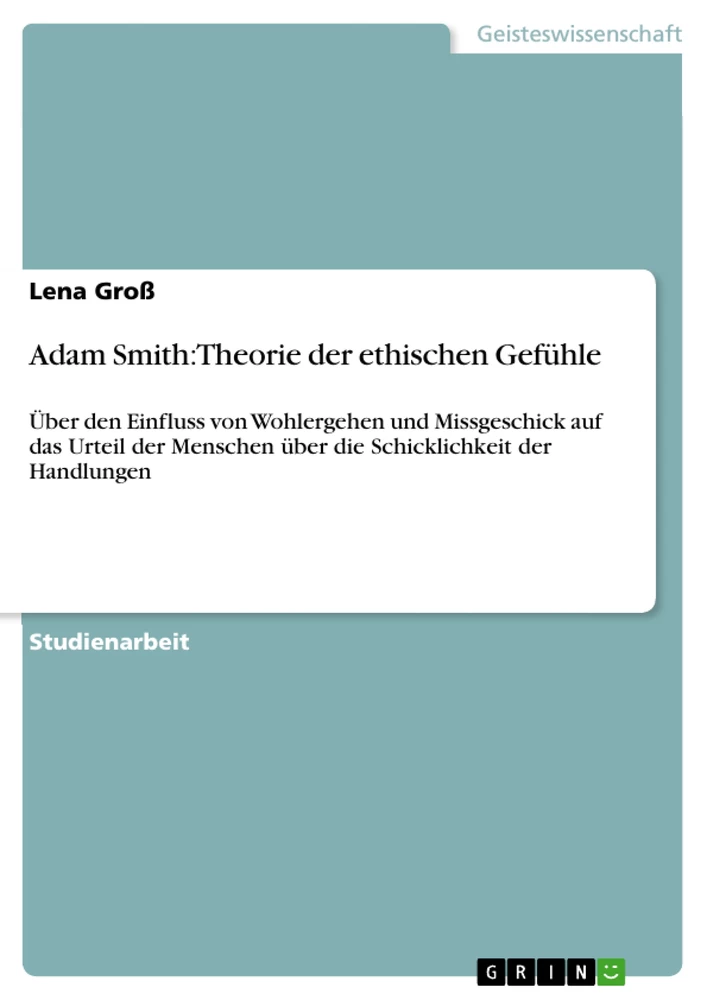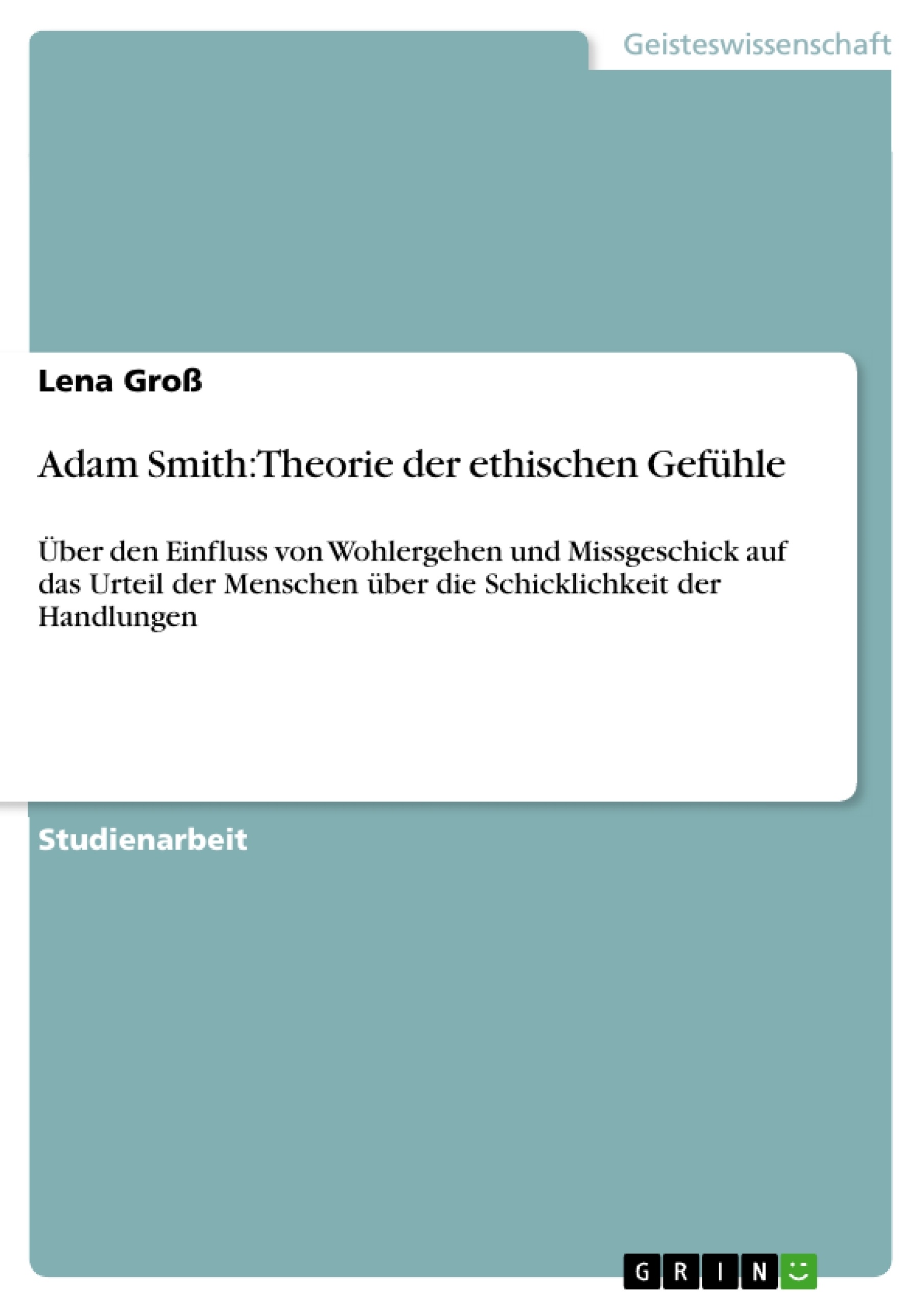Es handelt sich um eine Ausarbeitung vom Ersten Teil, Kapitel 3, Abschitt 1 des Werkes von Adam Smith: Theorie der ethischen Gefühle; es trägt die Überschrift: Über den Einfluss von Wohlergehen und Missgeschick auf das Urteil der Menschen über die Schicklichkeit der Handlungen.
1 Theorie der ethischen Gefühle
Adam Smiths Werk „Theory of Moral Sentiments“ ist eine in sieben Teile gegliederte deskriptive Darstellung der ethischen Gefühle mittels der der Autor die verbindenden Prinzipien und Grundkräfte des menschlichen Zusammenlebens erklären möchte (vgl. Smith 2010, XVII). Smith selbst bezeichnet sein moralphilosophisches Werk als den „Versuch einer Analyse der Prinzipien, mittels welcher die Menschen naturgemäß zunächst das Verhalten und den Charakter ihrer Nächsten und sodann auch ihr eigenes Verhalten und ihren eigenen Charakter beurteilen“ (Schäfer 2011, 18).
In der vorliegenden Arbeit, in welcher der erste Teil von Smiths Theorie, dritter Abschnitt, erstes Kapitel fokussiert wird, wird zunächst der Begriff der Sympathie definiert, der die Grundlage von Smiths Ethik bildet. Durch das sympathetische Verständnis des Menschen ist es ihm möglich mit seinen Mitmenschen mitzufühlen und zugleich deren Gefühlsäußerungen zu bewerten und über die Schicklichkeit dessen zu urteilen. Daran anknüpfend werden die Unterschiede des Sympathiegefühls und damit einhergehend Smiths These erläutert, die besagt, dass die Sympathie mit dem Leiden, im Vergleich mit der Sympathie mit der Freude, weit weniger die Heftigkeit dessen erreicht, was die ursprünglich betroffene Person naturgemäß fühlt, obwohl erstere Sympathie meistens eine lebhaftere Empfindung ist. Zudem wird abschließend aufgezeigt welche Charakterzüge im Menschen Bewunderung erwecken und welche verachtenswert sind. Im Ausblick wird zuletzt ein kurzer Überblick über die folgenden zwei Kapitel gegeben, welche die Verfälschung der ethischen Gefühle durch die Bewunderung der Reichen und dem Streben nach Macht sowie die Ablehnung der Armen umfassen und fortlaufend den Einfluss von Wohlergehen und Missgeschick auf das Urteil der Menschen beinhalten.
2 Unterschiede des Sympathiegefühls
Zunächst beschreibt Smith den Menschen als ein von Natur aus egoistisches Wesen, welches aber durch gewisse Prinzipien bestimmt wird, die ihn an dem Schicksal seiner Mitmenschen teilnehmen lassen und ihm deren Glückseligkeit zum Bedürfnis machen (vgl. Smith 2010, 5). Die Soziabilität ruft in einem Individuum das Bedürfnis hervor, mit anderen Personen sowohl intellektuell als auch affektiv zu interagieren (vgl. Villiez 2005, 66). Durch die Einbildungskraft des Menschen, bildet er sich eine Vorstellung von den Empfindungen einer anderen Person und erlebt dadurch selbst ähnliche Gefühle. Mittels der Phantasie, welche die Quelle seines Mitgefühls ist, entstehen in einem Menschen Affekte, sogenannte Gefühlszustände, die ihn am Wohl und Glück anderer mitfühlen lassen.
Mit dem Begriff Sympathie, der ursprünglich Mitgefühl mit den Leiden bedeutet, bezeichnet Smith das Mitgefühl mit jeder Art von Affekt, d. h. positive als auch negative Affekte. Die Sympathie entspringt jedoch vielmehr aus dem Anblick der Situation, die den Affekt auslöst, als aus dem alleinigen Anblick des Affektes (vgl. Smith 2010, 10). Die Sympathie ist, da Mitfreude und Mitleid Prinzipien der menschlichen Natur sind, für alle Menschen zugänglich. (vgl. Schäfer 2011, 18). Smith setzt die Fähigkeit zur Sympathie sogar als anthropologische Grundkonstante voraus, mittels der die Natur den Menschen zum Leben in der Gemeinschaft überhaupt erst befähigt (vgl. Villiez 2005, 67).
Hume beschreibt die Sympathie künstlerisch metaphorisch als eine mitschwingende Saite eines Musikinstruments, welche in uns den Affekt einer anderen Person nachklingen lässt (vgl. Lohmann 2005, 90). Diese Beschreibung lässt sich mit Smiths Definition vereinen. Wichtig ist, dass das Sympathiegefühl nicht identisch mit dem ursprünglichen Gefühl des Betroffenen ist, sondern dass wir uns mittels der Einbildungskraft vorstellen, was wir in dieser Situation des anderen fühlen würden. Ursachen und Motive, sowie Wirkungen des Affekts der ursprünglichen Person sind ausschlaggebend für die Art und den Grad unseres Mitgefühls. Das sympathetische Verständnis ist mitfühlend, wohlinformiert und zugleich urteilend, indem wir die Gefühlsempfindungen und Gefühlsäußerungen des Betroffenen zudem bewerten und sie als richtig und schicklich und den Anlässen entsprechend als angemessen empfinden oder nicht (vgl. Lohmann 2005, 91). Die eigenen Empfindungen sind demnach die Richtschnur für die Beurteilung der ursprünglichen Affekte.
Die Sympathie bildet die Grundlage unserer moralischen Urteile. Wir sind durch sie dazu in der Lage, das Verhalten unserer Nächsten sowie anschließend auch unser eigenes zu beurteilen. Als gerechtfertigt und objektiv gilt ein moralisches Urteil aber nur dann, wenn es sich „[über die Sympathie und Billigung mit anderen Gefühlen] hinaus aus einer diesem Urteilskontext übergeordneten Perspektive der Unparteilichkeit bewähr[t].“ (Villiez 2005, 68). Durch den hier angedeuteten unparteiischen Zuschauer können eigene Motive und das eigene Verhalten sogar einer moralischen Bewertung unterzogen werden, während das Prinzip der Sympathie es dem Individuum lediglich ermöglicht, die Empfindungen und Affekte anderer zu billigen oder nicht.[1] Diese Arbeit beschäftigt sich jedoch nur mit der subjektiven Bezogenheit des eigenen Urteils. Nachfolgend werden nun Unterschiede der Sympathie anhand Smiths These, dass „unsere Sympathie mit dem Leiden, obwohl sie meistens eine lebhaftere Empfindung ist als unsere Sympathie mit der Freude, doch gemeinhin weit weniger die Heftigkeit dessen erreicht, was die ursprünglich betroffene Person naturgemäß fühlt“ (Smith 2010, 66) beleuchtet und anhand seiner Argumentation belegt.
[...]
[1] Auf eine genauere Ausführung moralischen Urteilens wird hier verzichtet, da diese den Rahmen dieser Arbeit sprängen würde und nicht relevant zur Unterstützung von Smiths These in der vorliegenden Arbeit ist. Zur Erläuterung der drei Dimensionen moralischen Urteilens wird Schäfer 2011, 18ff. empfohlen.
- Quote paper
- Lena Groß (Author), 2012, Adam Smith: Theorie der ethischen Gefühle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269074