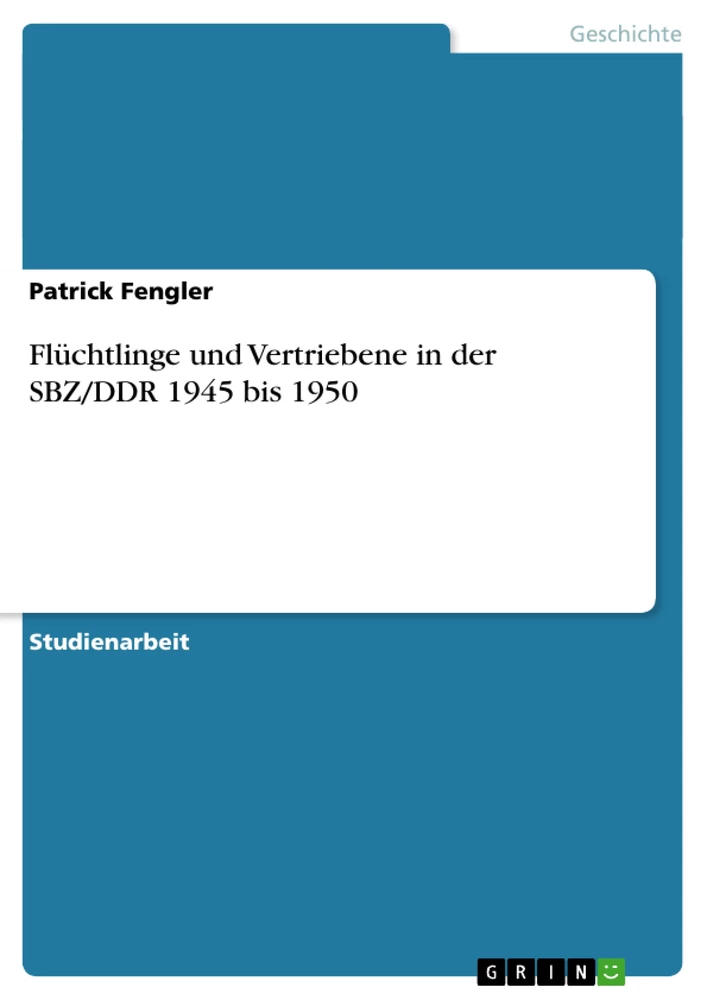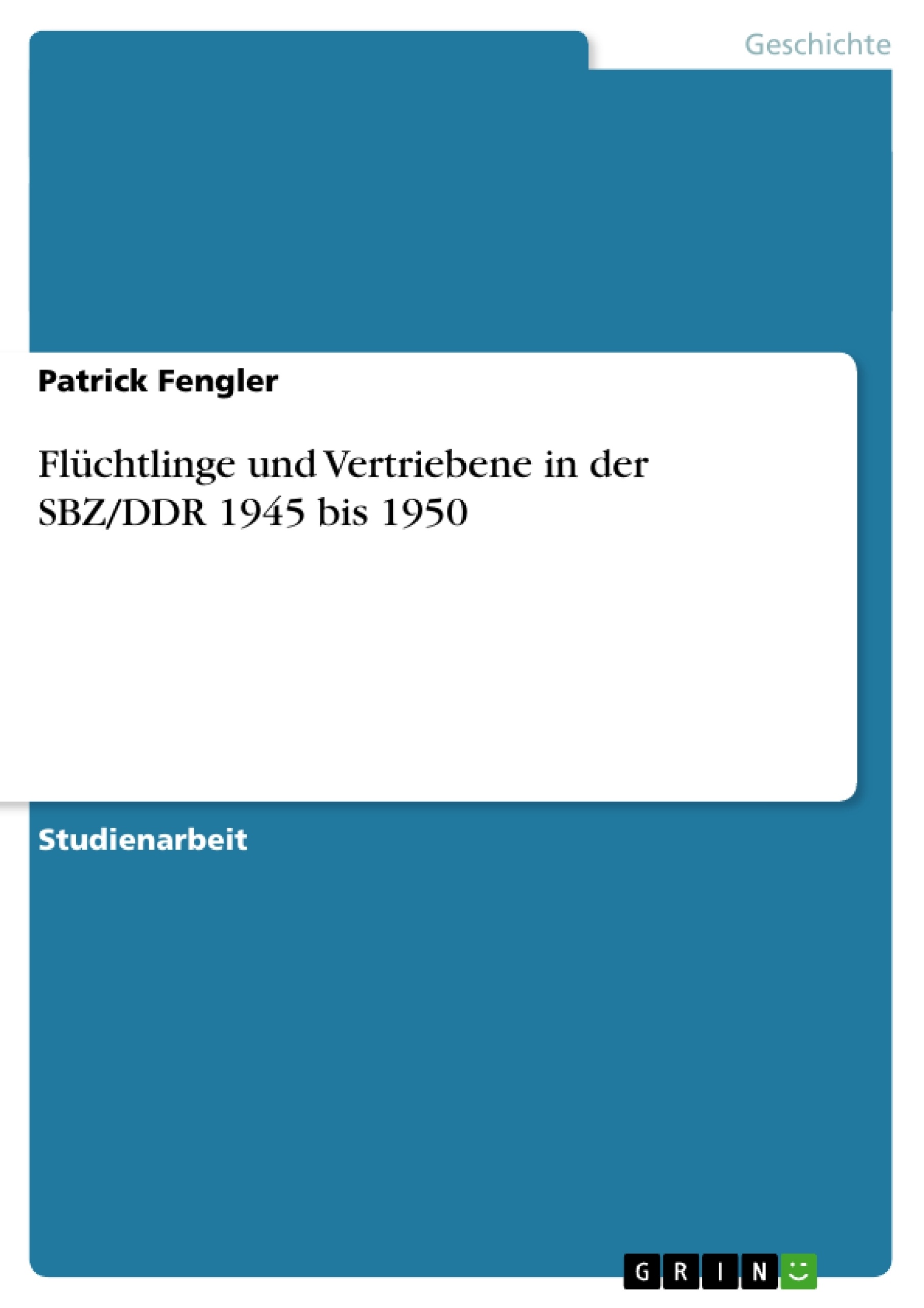Kaum ein Problembereich ist so eng mit der ostdeutschen Nachkriegsgeschichte nach 1945 verknüpft wie die Bodenreform. Sie bildete den ersten Eingriff der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) und der KPD in die bestehende Besitzstruktur der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Die SMAD schrieb der Bodenreform eine wichtige Aufgabe zu. Die Verfügung über die Ressource Boden hatte in der Zeit nach dem Krieg nicht nur eine zentrale Bedeutung für die Sicherung der Ernährung, sondern für die KPD, später dann die SED, auch ein legitimes Mittel zur Herrschaftssicherung.
Die Enteignung von Gutsbesitzern beseitigte die traditionelle Vorherrschaft der Großgrundbesitzer auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone. Aus der Bodenreform ging eine neue soziale Gruppierung, die Neubauern, hervor, die ökonomisch gefestigt und in die ländliche Gesellschaft integriert werden musste. Eine Gruppe der Neubauern stellten die Vertriebenen dar, die im folgenden als Zielgruppe der Bodenreform näher untersucht werden sollen.
In der Arbeit „Die Bodenreform und die Vertriebenen in der SBZ/DDR“ soll ermittelt werden, in welchem Ausmaße die Vertriebenen in der SBZ in den Jahren 1945 bis 1950 bei der Landverteilung benachteiligt wurden, wie die Interessen der Vertriebenen Berücksichtigung fanden und wie sich die wirtschaftliche Situation der Vertriebenen-Neubauern darstellte.
Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Rolle der Bodenreform als Integrationsmoment.
Die Literaturlage zu diesem Thema ist breit gefächert. Zu diesem Zweck werden hauptsächlich Darstellungen von Arnd Bauerkämper , Wolfgang Meinicke und Manfred Wille herangezogen, weil sie sich maßgeblich an der wissenschaftlichen Diskussion zu diesem Thema beteiligen. Ergänzend dazu werden Darstellungen über die Länder Sachsen (Stefan Donth ), Sachsen-Anhalt (Torsten Mehlhase ), Thüringen (Steffi Kaltenborn ), Mecklenburg-Vorpommern (Michael Rusche ) und Brandenburg (Arnd Bauerkämper) verwendet. Als Vertreter der verwendeten DDR-Darstellungen ist die Monographie von Horst Barthel zu nennen. Sie gewährt Einblicke in diverse Statistiken, die für das Bearbeiten des Themas unabdinglich sind.
Inhaltsverzeichnis
- I,1. Einleitung
- 2. Vorbemerkungen
- 2.1. Begriffsbestimmung
- 2.2. Die Ausgangssituation in der SBZ
- 3. Die Bodenreform und die Vertriebenen in der SBZ/DDR
- 3.1. Der Beginn der Bodenreform in der SBZ/DDR
- 3.2. Die Beteiligung der Vertriebenen an den Bodenreformkommissionen
- 3.3. Die wirtschaftliche Notsituation der Vertriebenen-Neubauern
- 3.3.1. Der Mangel an Neubauern-Wirtschaften
- 3.3.2. Der Mangel an lebendem und totem Inventar
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Ausmaß der Benachteiligung von Vertriebenen in der SBZ (1945-1950) während der Bodenreform. Sie analysiert die Berücksichtigung der Interessen der Vertriebenen und deren wirtschaftliche Situation als Neubauer. Der Fokus liegt auf der Rolle der Bodenreform als Integrationsmoment für diese Bevölkerungsgruppe.
- Die Benachteiligung von Vertriebenen während der Bodenreform in der SBZ.
- Die Berücksichtigung der Interessen der Vertriebenen in der Bodenreformpolitik.
- Die wirtschaftliche Situation der Vertriebenen als Neubauer.
- Die Bodenreform als Integrationsinstrument für Vertriebenen.
- Die unterschiedliche Terminologie bezüglich der Vertriebenen und ihre Bedeutung.
Zusammenfassung der Kapitel
I,1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Bodenreform und deren Auswirkungen auf Vertriebene in der SBZ/DDR von 1945 bis 1950 ein. Sie beschreibt die Bodenreform als ersten Eingriff der SMAD und der KPD in die bestehende Besitzstruktur und betont deren Bedeutung für die Ernährungssicherung und Herrschaftssicherung. Die Arbeit fokussiert auf die Untersuchung des Ausmaßes der Benachteiligung der Vertriebenen bei der Landverteilung, die Berücksichtigung ihrer Interessen und ihre wirtschaftliche Situation. Die verwendeten Literaturquellen werden genannt und ihre Relevanz für die wissenschaftliche Diskussion zum Thema hervorgehoben.
2. Vorbemerkungen: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedliche Terminologie bezüglich der Vertriebenen (Flüchtlinge, Umsiedler, Vertriebene) und erklärt die Gründe für diese Unterschiede im Kontext der Integrationspolitik der SBZ. Es wird erläutert, dass der Begriff „Umsiedler“ als offizielle Bezeichnung eingeführt wurde, um die systematische Umsiedlung von Millionen Deutscher zu verschleiern und Schuldzuweisungen zu vermeiden. Der Text argumentiert für die Verwendung des Begriffs „Vertriebene“ im weiteren Verlauf der Arbeit, um die erzwungene und unumkehrbare Natur dieser Migration hervorzuheben.
2.1. Begriffsbestimmung: Dieses Unterkapitel befasst sich detailliert mit den unterschiedlichen Begriffen, die zur Beschreibung der aus den Ostgebieten vertriebenen Bevölkerung verwendet wurden (Vertriebene, Flüchtlinge, Umsiedler). Es analysiert die politischen Gründe für die Verwendung dieser unterschiedlichen Begriffe und die damit verbundene Integrationspolitik der SBZ. Es wird die Absicht der SMAD hervorgehoben, die wahre Dimension der Vertreibung zu verschleiern und die Schuldfrage zu vermeiden. Das Kapitel endet mit der Begründung der Wahl des Terminus „Vertriebene“ für die vorliegende Arbeit.
2.2. Die Ausgangssituation in der SBZ: Dieses Unterkapitel beschreibt die schwierige Ausgangssituation in der SBZ nach dem Krieg, charakterisiert durch Elend, Chaos und Zerstörung. Es beleuchtet die große Anzahl von Vertriebenen, die in der SBZ aufgenommen werden mussten (4,3 Millionen von insgesamt ca. 10 Millionen in allen Besatzungszonen), und den daraus resultierenden Herausforderungen für die Integration dieser Bevölkerungsgruppe. Der hohe Anteil der Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung der SBZ wird betont und in einen Kontext mit den Gesamtzahlen für alle Besatzungszonen gestellt.
3. Die Bodenreform und die Vertriebenen in der SBZ/DDR: Dieses Kapitel wird sich umfassend mit dem Kern der Arbeit befassen: der Analyse der Bodenreform und ihrer Auswirkungen auf die Vertriebenen. Es wird detailliert die Beteiligung der Vertriebenen an den Bodenreformkommissionen sowie ihre wirtschaftliche Situation als Neubauer untersuchen. Die Analyse wird aufzeigen, inwieweit die Bodenreform als Integrationsmoment für die Vertriebenen diente und welche Herausforderungen sich aus dem Mangel an Land, Wirtschaftsgütern und Kapital ergaben. Die einzelnen Unterkapitel werden in einer ganzheitlichen Zusammenfassung der Herausforderungen und Chancen der Bodenreform für Vertriebene behandelt.
Schlüsselwörter
Bodenreform, Vertriebene, SBZ, DDR, Neubauer, Integration, Landverteilung, Wirtschaftliche Situation, SMAD, KPD, SED, Ostvertriebene, Flüchtlinge, Umsiedler.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bodenreform und Vertriebenen in der SBZ/DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Benachteiligung von Vertriebenen in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) während der Bodenreform (1945-1950). Der Fokus liegt auf der Berücksichtigung der Interessen der Vertriebenen, ihrer wirtschaftlichen Situation als Neubauer und der Rolle der Bodenreform als Integrationsinstrument.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Benachteiligung der Vertriebenen während der Bodenreform, die Berücksichtigung ihrer Interessen in der Bodenreformpolitik, ihre wirtschaftliche Situation als Neubauer, die Bodenreform als Integrationsinstrument und die unterschiedliche Terminologie bezüglich der Vertriebenen (Flüchtlinge, Umsiedler, Vertriebene) und deren Bedeutung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Vorbemerkungen (inkl. Begriffsbestimmung und der Ausgangssituation in der SBZ), ein Kapitel zur Bodenreform und den Vertriebenen in der SBZ/DDR (inkl. Unterkapitel zur Beteiligung der Vertriebenen an den Bodenreformkommissionen und ihrer wirtschaftlichen Notsituation) und ein Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Begriffe werden verwendet und warum?
Die Arbeit beleuchtet die unterschiedliche Verwendung der Begriffe „Vertriebene“, „Flüchtlinge“ und „Umsiedler“. Es wird argumentiert, warum der Begriff „Vertriebene“ im Kontext der erzwungenen und unumkehrbaren Migration am treffendsten ist, im Gegensatz zum Begriff „Umsiedler“, der von der SBZ/DDR verwendet wurde, um die wahre Dimension der Vertreibung zu verschleiern.
Wie wird die wirtschaftliche Situation der Vertriebenen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die wirtschaftliche Notsituation der Vertriebenen als Neubauer, inklusive des Mangels an Neubauern-Wirtschaften und an lebendem und totem Inventar. Die Analyse untersucht, inwieweit die Bodenreform diese Situation verbessert oder verschärft hat.
Welche Rolle spielte die Bodenreform für die Integration der Vertriebenen?
Die Arbeit untersucht die Bodenreform als potentielles Integrationsinstrument für Vertriebene. Analysiert wird, inwieweit die Landverteilung und die Unterstützung der Neubauer zur Integration beigetragen haben oder ob die Vertriebenen benachteiligt wurden.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Einleitung nennt und bewertet die verwendeten Literaturquellen und ihre Relevanz für die wissenschaftliche Diskussion zum Thema. Die genaue Quellenangabe ist im vollständigen Text enthalten (hier nicht vollständig wiedergegeben).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bodenreform, Vertriebene, SBZ, DDR, Neubauer, Integration, Landverteilung, Wirtschaftliche Situation, SMAD, KPD, SED, Ostvertriebene, Flüchtlinge, Umsiedler.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kürze)?
Das Fazit (detaillierte Ausführungen im vollständigen Text) fasst die Ergebnisse der Untersuchung zur Benachteiligung der Vertriebenen während der Bodenreform zusammen und bewertet die Rolle der Bodenreform als Integrationsinstrument für diese Bevölkerungsgruppe.
- Quote paper
- Magister Artium Patrick Fengler (Author), 2002, Flüchtlinge und Vertriebene in der SBZ/DDR 1945 bis 1950, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26841