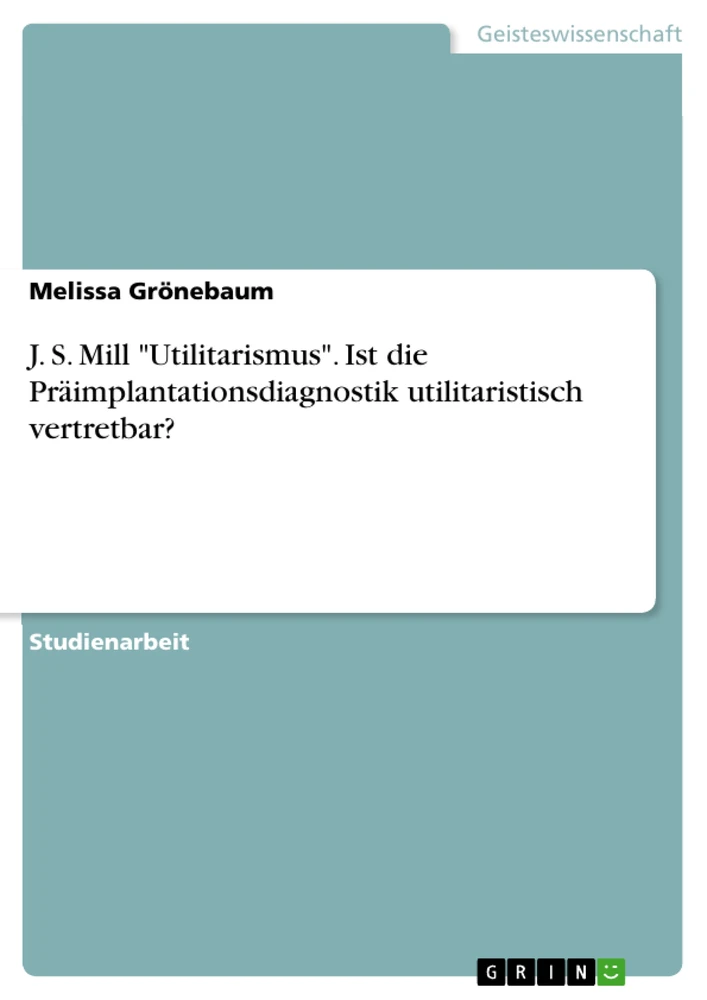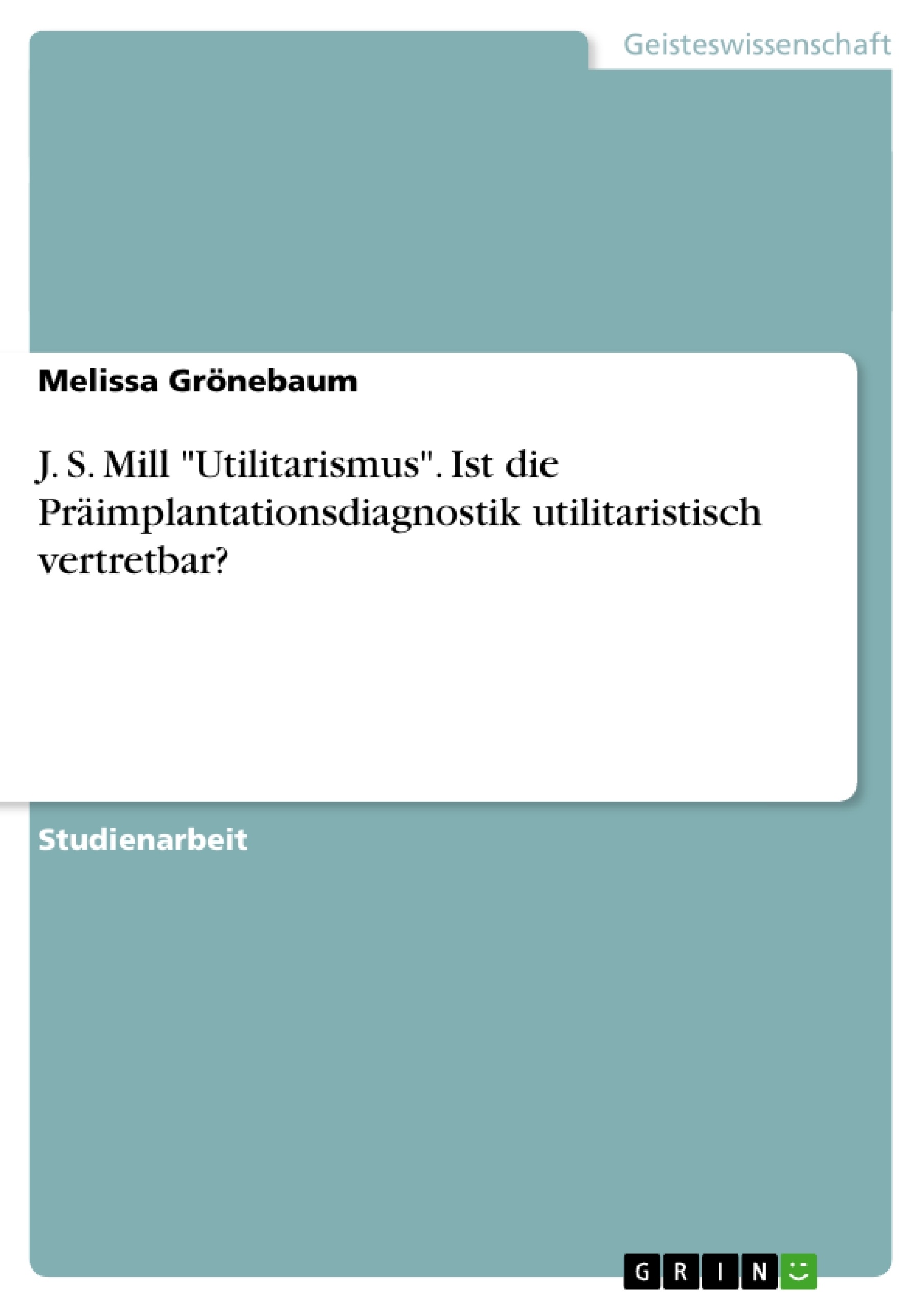Was in den USA schon längst gang und gebe ist, steht spätestens nach dem sogenannten „Lübecker Fall“ auch in Deutschland erneut zur Diskussion: die Legalität der Untersuchungen des Erbgutes von im Reagenzglas gezeugten Embryonen. 1995 hatte ein Lübecker Ehepaar einen Antrag auf die Durchführung einer PID (Präimplantationsdiagnostik) gestellt, da beide Ehepartner Träger eines Gens der Mukoviszidosemutation ΔF508 sind. Das Risiko, diese Genmutation auf Nachkommen zu übertragen, lag hierbei, da beide Elternteile betroffen waren, bei 25%. Einem bereits geborenen Kind des Paares war diese Krankheit, welche ein stark erschwertes Leben und eine niedrige Lebenserwartung bedeutet, schon vererbt worden, bei zwei weiteren Schwangerschaften führte eine pränatale Diagnostik zu Abtreibungen, da bei beiden Föten das mutierte Gen entdeckt wurde. Die zwei Professoren Diedrich und Schwinger der Universitätsklinik zu Lübeck baten daraufhin die Ethikkommission der Universität zu Lübeck „um ein Votum zur Frage der Präimplantationsdiagnostik (PID) bei einer Frau bzw. bei einem Ehepaar“. [Oehmichen, S.16] Diskussionen um die Frage einer „neuen Eugenik“ wurden hierdurch ebenso entfacht wie auch die Frage nach dem Sinn einer erneuten „Schwangerschaft auf Probe“ [Bundesärztekammer, S. 29/30]. Des Weiteren verstoße nach Meinung vieler Kritiker die Forschung an Embryonen klar gegen das Embryonenschutzgesetz (ESchG) von 1990. Zudem wird die Gefahr der Entstehung einer Welt ähnlich der in dem Film „Gattaca“ prognostiziert, in der Menschen natürlichen Ursprungs keine Chancen mehr in Beruf und Gesellschaft haben. Auch von der Erschaffung von „Designer-Babys“ ist die Rede, denn in den USA beispielsweise ist es bereits möglich, sich das Geschlecht des Kindes schon im Vorwege auszusuchen. Zusätzlich befürchten die PID-Gegner eine Abwertung und sinkende Toleranz bezüglich Behinderter. Andererseits haben Studien aus Ländern, in denen die PID bereits erlaubt ist, belegt, dass jegliche befürchteten Folgen der Einführung und Legalisierung der PID völlig unbegründet sind. Es stellt sich daher grundsätzlich die Frage, ob die Menschheit wirklich alles tun darf und tun sollte, was sie könnte. Was wäre, wenn der Mensch zwecks Erhaltung der Art irgendwann sogar dazu gezwungen würde, eben dies zu tun, wie es nach den Reaktorunfällen in Japan nunmehr der Fall sein könnte, um ein absolutes Gen-Chaos zu vermeiden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Präimplantationsdiagnostik
- 2.1. Aktuelle Situation in Deutschland und ethische Problematik
- 2.1.1. Selektion und eine Zukunft nach dem Vorbild „Gattaca“
- 2.1.2. Positive Eugenik
- 2.2. Utilitarismus
- 2.2.1. Glück
- 2.2.2. Anwendung auf PID
- 3. Wann ist ein Mensch ein Mensch?
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die ethische Vertretbarkeit der Präimplantationsdiagnostik (PID) aus utilitaristischer Perspektive. Sie analysiert die aktuelle Situation der PID in Deutschland, die damit verbundenen ethischen Probleme und die Anwendung des Utilitarismus auf diese Thematik. Der Fokus liegt auf der Abwägung von Nutzen und Schaden für die betroffenen Individuen und die Gesellschaft.
- Ethische Implikationen der PID
- Anwendung des Utilitarismus auf bioethische Fragen
- Rechtliche Situation der PID in Deutschland und im internationalen Vergleich
- Der Begriff des "fühlenden Lebens" und der Beginn menschlicher Würde
- Die Gefahr einer "neuen Eugenik"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Präimplantationsdiagnostik (PID) ein und beleuchtet die kontroverse Debatte um deren Legalität in Deutschland anhand des „Lübecker Falls“. Sie stellt die Frage nach dem moralischen und ethischen Umgang mit den Möglichkeiten der PID und der Abwägung von Nutzen und potenziellen Schäden. Der Utilitarismus wird als möglicher Lösungsansatz vorgestellt, der die Abwägung von Glück und Leid in den Mittelpunkt stellt. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit der Frage an, ob die PID nach utilitaristischen Prinzipien vertretbar ist.
2. Präimplantationsdiagnostik: Dieses Kapitel definiert den Begriff der PID und beschreibt das Verfahren. Es erklärt, wie die PID funktioniert und welche Risiken und ethischen Bedenken damit verbunden sind, insbesondere bezüglich der Zerstörung totipotenter Zellen. Der juristische Status quo in Deutschland wird im Kontext mit der Rechtslage in anderen Ländern dargestellt, wobei die Uneinigkeit in der Gesetzgebung deutlich wird. Die verschiedenen Gesetzesvorschläge im Bundestag zum Thema PID werden erläutert.
Schlüsselwörter
Präimplantationsdiagnostik (PID), Utilitarismus, Ethik, Embryonenschutzgesetz (ESchG), Eugenik, Genmutationen, Bioethik, Recht, Deutschland, Internationaler Vergleich, Glück, Leid, Menschliche Würde.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Präimplantationsdiagnostik aus utilitaristischer Perspektive
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die ethische Vertretbarkeit der Präimplantationsdiagnostik (PID) aus utilitaristischer Sicht. Sie analysiert die aktuelle Situation der PID in Deutschland, die damit verbundenen ethischen Probleme und die Anwendung des Utilitarismus auf diese Thematik. Der Fokus liegt auf der Abwägung von Nutzen und Schaden für Individuen und Gesellschaft.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die ethischen Implikationen der PID, die Anwendung des Utilitarismus auf bioethische Fragen, die rechtliche Situation der PID in Deutschland und im internationalen Vergleich, den Begriff des "fühlenden Lebens" und den Beginn menschlicher Würde sowie die Gefahr einer "neuen Eugenik".
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Präimplantationsdiagnostik (einschließlich aktueller Situation in Deutschland, ethischer Problematik, Utilitarismus und dessen Anwendung auf PID), ein Kapitel zur Frage "Wann ist ein Mensch ein Mensch?", und ein Fazit. Sie beinhaltet außerdem ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der PID ein und beleuchtet die kontroverse Debatte um deren Legalität in Deutschland anhand des „Lübecker Falls“. Sie stellt die Frage nach dem moralischen und ethischen Umgang mit den Möglichkeiten der PID und der Abwägung von Nutzen und potenziellen Schäden. Der Utilitarismus wird als möglicher Lösungsansatz vorgestellt.
Was wird im Kapitel zur Präimplantationsdiagnostik behandelt?
Dieses Kapitel definiert die PID, beschreibt das Verfahren, erklärt die damit verbundenen Risiken und ethischen Bedenken (insbesondere bezüglich der Zerstörung totipotenter Zellen), und stellt den juristischen Status quo in Deutschland im Kontext mit der Rechtslage in anderen Ländern dar. Die verschiedenen Gesetzesvorschläge im Bundestag zum Thema PID werden erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Präimplantationsdiagnostik (PID), Utilitarismus, Ethik, Embryonenschutzgesetz (ESchG), Eugenik, Genmutationen, Bioethik, Recht, Deutschland, Internationaler Vergleich, Glück, Leid, Menschliche Würde.
Welche Perspektive wird in der Hausarbeit eingenommen?
Die Hausarbeit nimmt eine utilitaristische Perspektive ein, d.h. sie bewertet die PID anhand der Abwägung von Nutzen und Schaden für die betroffenen Individuen und die Gesellschaft. Die Maximierung von Glück und die Minimierung von Leid stehen im Mittelpunkt der Betrachtung.
Welche Rolle spielt der Utilitarismus in dieser Arbeit?
Der Utilitarismus dient als ethisches Rahmenwerk zur Beurteilung der PID. Es wird untersucht, ob die PID nach utilitaristischen Prinzipien vertretbar ist, indem Nutzen und Schaden gegeneinander abgewogen werden.
- Quote paper
- Melissa Grönebaum (Author), 2010, J. S. Mill "Utilitarismus". Ist die Präimplantationsdiagnostik utilitaristisch vertretbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268369