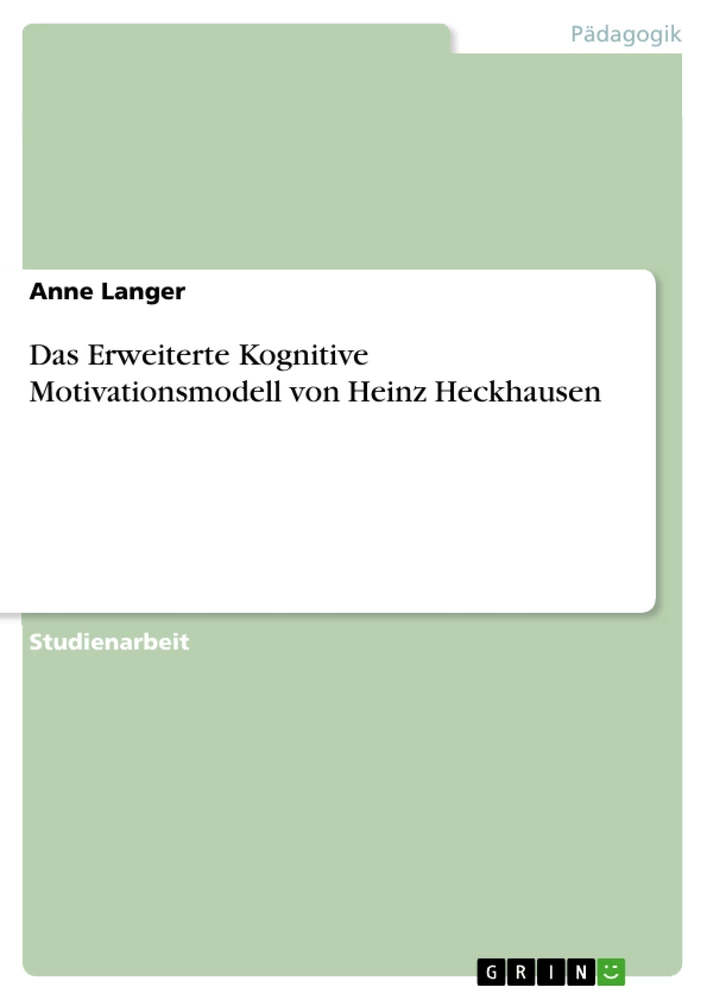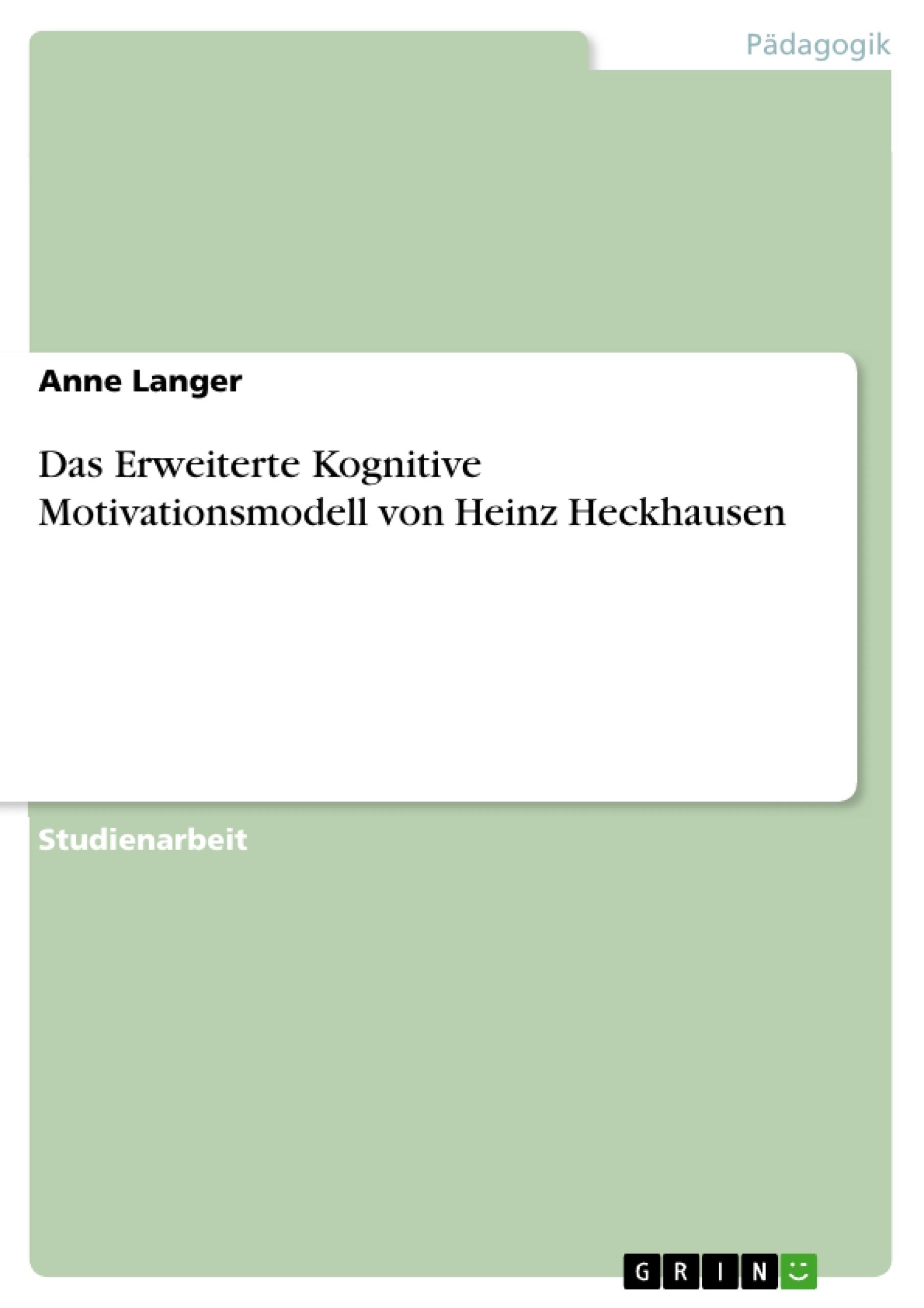Menschen haben unterschiedliche Beweggründe etwas zu lernen und Leistung zu erbringen. Zum Beispiel sind nicht alle Schüler den schulischen Anforderungen gleichermaßen gewachsen. Diejenigen, die die Ansprüche erfüllen und denen es leicht fällt dem Unterricht zu folgen, erleben den Leistungsdruck anders als Lernschwache. Auf ihnen lastet ein hoher psychischer Druck, der großen Einfluss auf die schulische Motivation hat. Diese ist äußerst relevant für den Lernerfolg und den eigenen Kompetenzzuwachs.
Zur Erklärung motivierten Verhaltens gibt es verschiedene Ansätze. Im Unterschied zu anderen Ansätzen, fasst der kognitiv-handlungstheoretische Ansatz den Menschen als planendes, auf die Zukunft gerichtetes und entscheidendes Wesen auf, das sich Ziele setzt und diese zu erreichen versucht. Da ihm mehr oder weniger Handlungsspielräume zur Verfügung stehen, muss er Entscheidungen treffen und diese auch verantworten. Dies gelingt ihm weil er zur Selbstreflexion seines Tuns fähig ist (Gabler, 1986, S. 71). Motivation als Handlung ist zweckrational und durch Bewusstseinsprozesse gekennzeichnet. Es handelt sich um einen Prozess, der zwischen dem Motiv und dem aktiven Handeln steht. Als Beispielmodell ist hier die VIE-Theorie von Vroom zu nennen und auch das erweiterte Motivationsmodell von Heckhausen (1989).
Mit diesem Thema habe ich mich schon während des Seminars zugewandt und möchte es mit dieser Arbeit im Einzelnen genauer vorstellen. Einführend werde ich die grundlegenden Begriffe erläutern und auf die wichtigsten Determinanten des Modells eingehen, um den Inhalt und vor allem den Sinn dieses Verfahrens fassbar und deutlich zu machen. Anschließend möchte ich das Motivationsmodell schrittweise erklären, während ich es anhand von Beispielen veranschauliche.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen und Einführung in die Thematik
- 2.1. Die Leistungsmotivation
- 3. Das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen (1989)
- 3.1. Die Erwartungen
- 3.2. Anreize
- 3.2.1. Selbstbewertung
- 3.2.2. Fremdbewertung
- 3.3. Die aussagenlogische Sequenz des Erweiterten Motivationsmodell
- 3.4. Erkenntnisse
- 4. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem erweiterten kognitiven Motivationsmodell von Heckhausen (1989). Ziel ist es, das Modell detailliert zu erläutern und seine wichtigsten Determinanten zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der verständlichen Darstellung des Modells anhand von Beispielen.
- Das Konzept der Leistungsmotivation
- Das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen
- Die Rolle von Erwartungen und Anreizen
- Intrinsische und extrinsische Motivation
- Der Einfluss von Selbst- und Fremdbewertung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Motivation und Leistungsmotivation ein. Sie betont die unterschiedlichen Beweggründe von Lernenden und den Einfluss des Leistungsdrucks auf die schulische Motivation. Es wird auf den kognitiv-handlungstheoretischen Ansatz verwiesen, der den Menschen als planendes und entscheidendes Wesen darstellt. Als Beispielmodelle werden die VIE-Theorie und das erweiterte Motivationsmodell von Heckhausen genannt. Die Arbeit kündigt die Erläuterung grundlegender Begriffe und die schrittweise Erklärung des Motivationsmodells an.
2. Definitionen und Einführung in die Thematik: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition von Motiven und Motivation. Es wird der interaktive Zusammenhang zwischen Person und Situation hervorgehoben, wobei Motive, Erwartungen und Anreize eine zentrale Rolle spielen. Rheinbergs Definition des Motivs als „spezifisch eingefärbte Brille“ wird erläutert, ebenso wie Heckhausens Beschreibung als „Handlungsur sache bzw. gewünschter Zustand“. Der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation wird klargestellt, wobei die erste auf innerem Antrieb beruht und die zweite von externen Belohnungen angetrieben wird.
2.1. Die Leistungsmotivation: Dieses Kapitel definiert Leistungsmotivation nach Heckhausen als das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit zu steigern oder zu erhalten. Es wird betont, dass nicht jedes Bemühen leistungsmotiviert ist und dass ein stark ausgeprägtes Leistungsmotiv notwendig ist, um auch herausfordernde Aufgaben anzugehen. Die Aufteilung des Leistungsmotivs in Erfolgs- und Misserfolgsmotiv nach Atkinson und Heckhausen wird erwähnt.
3. Das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen (1989): Dieses Kapitel beschreibt das von Heckhausen entwickelte Motivationsmodell für zielgerichtetes Handeln. Basierend auf der Erwartungs-mal-Wert-Theorie, werden Motive, Anreize, Erwartungen und Attributionen als Hauptfaktoren der Motivation betrachtet. Das Modell integriert sowohl die Erwartungs-mal-Wert-Verknüpfung als auch andere Ansätze der Motivationsforschung.
Schlüsselwörter
Motivation, Motivationsförderung, Leistungsmotivation, erweitertes kognitives Motivationsmodell, Heckhausen, Erwartungen, Anreize, Selbstbewertung, Fremdbewertung, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Handlungstheorie.
Häufig gestellte Fragen zum erweiterten kognitiven Motivationsmodell von Heckhausen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen (1989). Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der detaillierten Erklärung des Modells und seiner wichtigsten Determinanten, veranschaulicht durch Beispiele.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Leistungsmotivation, das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen, die Rolle von Erwartungen und Anreizen, intrinsische und extrinsische Motivation sowie den Einfluss von Selbst- und Fremdbewertung. Es werden grundlegende Begriffe der Motivationspsychologie definiert und erklärt.
Was ist das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen?
Das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen (1989) ist ein Modell für zielgerichtetes Handeln. Es basiert auf der Erwartungs-mal-Wert-Theorie und betrachtet Motive, Anreize, Erwartungen und Attributionen als Hauptfaktoren der Motivation. Das Modell integriert verschiedene Ansätze der Motivationsforschung.
Welche Rolle spielen Erwartungen und Anreize im Modell?
Erwartungen und Anreize sind zentrale Bestandteile des Modells. Erwartungen beziehen sich auf die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, während Anreize den Wert oder die Attraktivität des Ziels darstellen. Die Interaktion von Erwartungen und Anreizen bestimmt die Motivation zum Handeln.
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation beschreibt den inneren Antrieb, eine Handlung auszuführen, während extrinsische Motivation durch äußere Belohnungen oder Sanktionen gesteuert wird. Die Arbeit erläutert diesen Unterschied im Detail.
Wie wird die Leistungsmotivation definiert?
Leistungsmotivation wird als das Bestreben definiert, die eigene Tüchtigkeit zu steigern oder zu erhalten. Es wird betont, dass nicht jedes Bemühen leistungsmotiviert ist und dass ein stark ausgeprägtes Leistungsmotiv notwendig ist, um auch herausfordernde Aufgaben anzugehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Definitionen und Einführung in die Thematik (inklusive eines Unterkapitels zur Leistungsmotivation), ein Kapitel zum erweiterten kognitiven Motivationsmodell von Heckhausen und ein Schlusswort. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Motivation, Motivationsförderung, Leistungsmotivation, erweitertes kognitives Motivationsmodell, Heckhausen, Erwartungen, Anreize, Selbstbewertung, Fremdbewertung, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Handlungstheorie.
- Quote paper
- Anne Langer (Author), 2010, Das Erweiterte Kognitive Motivationsmodell von Heinz Heckhausen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268290