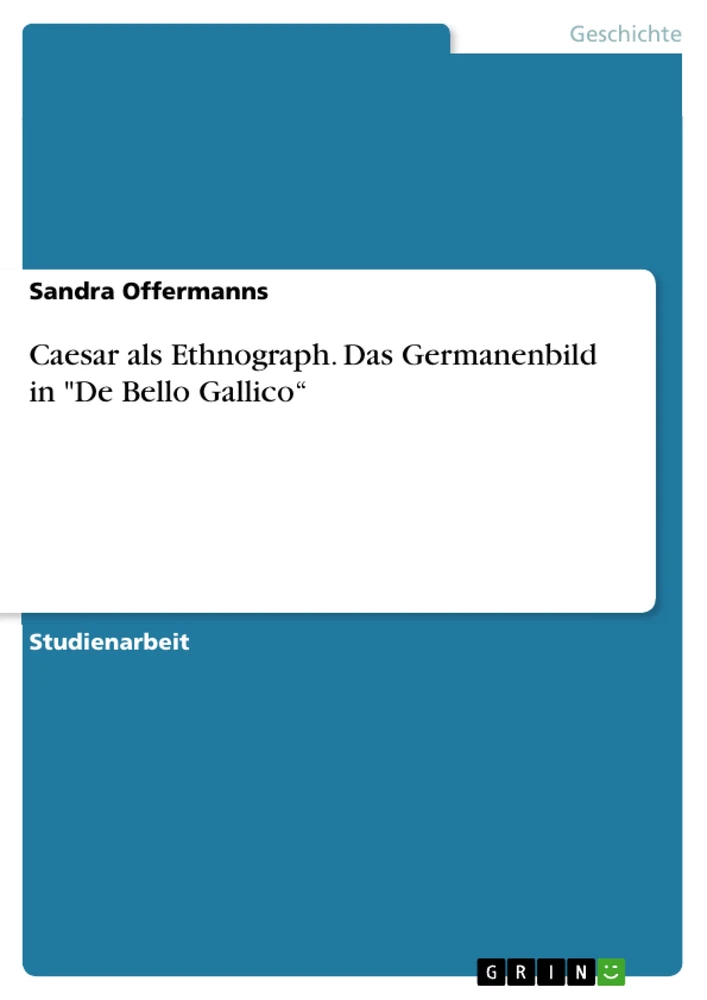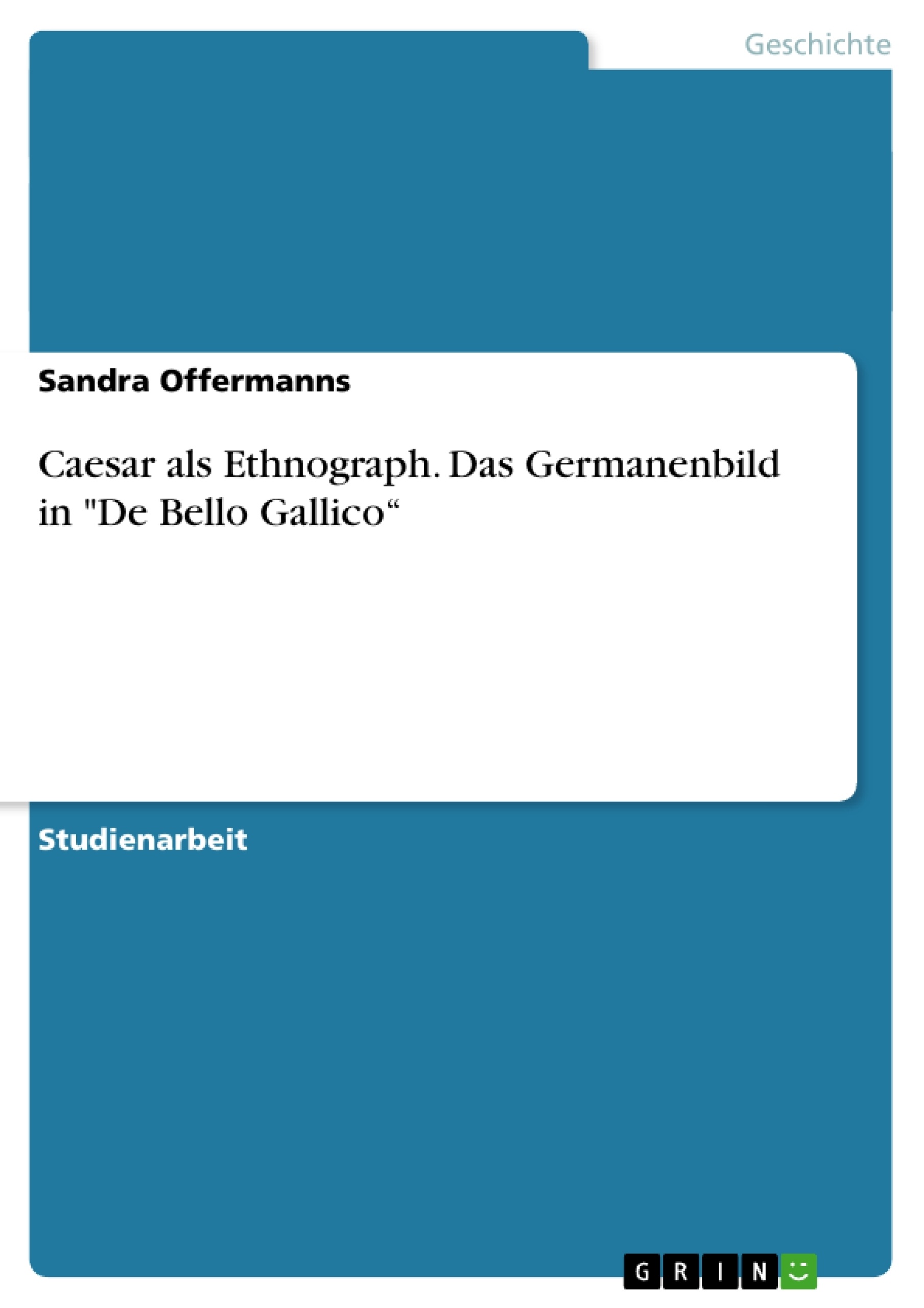Der „De Bello Gallico“ ist ein von Gaius Iulius Caesar verfasster Bericht über den Gallischen Krieg. Bei diesem Bericht handelt es sich nicht nur um einen Kriegsbericht, sondern auch um eine geographische und ethnographische Beschreibung Galliens und seiner unmittelbar umgebenden „Nachbarn“.
Diese Hausarbeit soll sich mit dem Aspekt der Ethnographie im „De Bello Gallico“, am Beispiel des Germanenbildes bei Caesar beschäftigten.
Hierbei soll der Frage nachgegangen werden, welches Bild Caesar von den Germanen in seinem „De Bello Gallico“ festhält und welche Kriterien zu diesem Bild führen. Die These ist hierbei, dass Caesars Blick auf die Germanen ethnozentrisch geprägt ist, was dazu führt, dass Caesar die Germanen als primitive Barbaren und Feinde des Römischen Reiches darstellt.
Der Hauptteil der Hausarbeit gliedert sich dann in vier Teile.
Der erste Teil beschäftigt sich damit, wie Caesar allgemein den Begriff Germanen definiert, da vor Caesar der Germanenbegriff mit dem der Gallier verschwamm. Deswegen soll im direkt folgenden Unterkapitel der Vergleich zwischen Galliern und Germanen hinsichtlich des Bildes der Germanen bei Caesar betrachtet werden.
Der nächste Teil soll sich näher mit Caesars Begegnung mit Ariovist beschäftigen, wofür zuerst die Darstellung Ariovists durch die Haeduer und dann die eigentliche Begegnung zwischen Caesar und Ariovist betrachtet werden soll. Inwieweit bestätigt Caesar mit diesen Darstellungen das römische Germanenbild?
Im dritten Teil soll der Rhein als Grenze betrachtet werden. Es soll den Fragen nachgegangen werden, welche Bedeutung dem Rhein als Grenze zukommt? Ist sie eine ethnische oder auch eine kulturelle Grenze? Außerdem soll betrachtet werden, wie Caesar die Rheinübertretungen von Ariovist, den Usipeter und Tenkterern bewertet, als auch wie die darauffolgenden Reaktion Caesars begründet ist.
Im letzten Teil soll dann, am Beispiel der Suebenskizze, herausgearbeitet werden, wie Caesar die Ethnographie eines Volkes erstellt. Inwieweit er Unterschiede zwischen Römer und Sueben sieht, wie sein Blick für das Innen und Außen ist.
Doch zuerst soll kurz auf die Entstehung des „De Bello Gallico“ und den antiken Barbarenbegriff eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Entstehung des „De Bello Gallico“
- 1.2 Der antike Begriff des Barbaren
- 2. Ethnographie bei Caesar: Definition des Germanenbegriffes
- 3. Caesars Begegnung mit den Barbaren
- 3.1 Das Hilfsgesuch der Haeduer
- 3.2 Begegnung mit Ariovist
- 4. Der Rhein als ethnische Grenze
- 4.1 Der Kampf gegen Ariovist und die Vertreibung der Germanen aus Gallien
- 4.2 Der Kampf gegen die Usipeter und Tenkterer
- 5. Ethnographie eines Volkes: Die Sueben
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Caesars Darstellung der Germanen in seinem „De Bello Gallico“. Ziel ist es, Caesars Germanenbild zu analysieren und die Kriterien zu identifizieren, die dieses Bild prägen. Die These lautet, dass Caesars Perspektive ethnozentrisch geprägt ist und die Germanen als primitive Barbaren und Feinde Roms darstellt.
- Caesars Definition des Germanenbegriffes und seine Abgrenzung zu den Galliern.
- Analyse von Caesars Begegnungen mit germanischen Stämmen (Ariovist, Usipeter, Tenkterer).
- Die Rolle des Rheins als ethnische und kulturelle Grenze.
- Caesars ethnographische Methode anhand der Beschreibung der Sueben.
- Die Frage nach dem ethnozentrischen Charakter von Caesars Germanenbild.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit analysiert die ethnographischen Aspekte des „De Bello Gallico“, insbesondere Caesars Darstellung der Germanen. Sie untersucht, wie Caesar den Germanenbegriff definiert und welche Kriterien zu seinem Bild der Germanen führen. Die These besagt, dass Caesars Sichtweise ethnozentrisch geprägt ist und die Germanen als primitive Barbaren und Feinde des Römischen Reiches präsentiert.
2. Ethnographie bei Caesar: Definition des Germanenbegriffes: Dieses Kapitel befasst sich mit Caesars Definition des Germanenbegriffes, der vor Caesar in der Literatur unscharf und oft mit dem der Gallier vermischt war. Caesar etabliert eine geographische Abgrenzung der Germanen, positioniert sie jenseits des Rheins ("qui trans Rhenum incoulunt"). Die Bezeichnung "Germani" wird jedoch nicht von den Stämmen selbst verwendet, sondern von den Römern, was auf eine römische Kategorisierung hinweist. Das Kapitel betont Caesars Rolle als "Eroberer und Entdecker" durch die Abgrenzung der Germanen von den Galliern.
3. Caesars Begegnung mit den Barbaren: Dieses Kapitel untersucht Caesars Begegnungen mit germanischen Stämmen, beginnend mit dem Hilfsgesuch der Haeduer und der anschließenden Begegnung mit Ariovist. Es analysiert, inwieweit diese Darstellungen Caesars römisches Germanenbild bestätigen. Der Fokus liegt auf der Interpretation von Caesars Berichten und deren Aussagekraft für das Verständnis seines Germanenbildes. Es wird untersucht wie Caesar verschiedene Begegnungen beschreibt und wie diese sein Gesamtbild der Germanen beeinflussen.
4. Der Rhein als ethnische Grenze: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung des Rheins als Grenze. Es wird untersucht, ob es sich um eine ethnische oder auch kulturelle Grenze handelt. Die Rheinübertretungen von Ariovist, den Usipeter und Tenkterern und Caesars Reaktionen darauf werden analysiert. Das Kapitel beleuchtet die strategische und symbolische Bedeutung des Rheins im Kontext des römischen Expansionsbestrebens und wie Caesar diese Grenze in seinen Berichten darstellt.
5. Ethnographie eines Volkes: Die Sueben: Dieses Kapitel analysiert Caesars ethnographische Beschreibung der Sueben als Beispiel für seine Methode. Es untersucht, welche Unterschiede Caesar zwischen Römern und Sueben sieht und wie er den Blick auf das Innere und Äußere des Stammes darstellt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung der Kultur, der Lebensweise und der sozialen Strukturen der Sueben, und wie diese im Kontext des römischen Bildes von den "Barbaren" steht.
Schlüsselwörter
Germanen, Caesar, De Bello Gallico, Ethnographie, Barbaren, Ariovist, Rhein, Sueben, Ethnozentrismus, Gallier, römisches Reich, militärische Expansion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Caesars Darstellung der Germanen im "De Bello Gallico"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Julius Caesars Darstellung der Germanen in seinem Werk „De Bello Gallico“. Der Fokus liegt auf Caesars Germanenbild, den Kriterien, die dieses Bild prägen, und der Frage nach dem ethnozentrischen Charakter dieser Darstellung.
Welche Aspekte von Caesars „De Bello Gallico“ werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die ethnographischen Aspekte des „De Bello Gallico“, insbesondere Caesars Definition des Germanenbegriffes, seine Begegnungen mit verschiedenen germanischen Stämmen (Ariovist, Usipeter, Tenkterer, Sueben), die Rolle des Rheins als Grenze und Caesars ethnographische Methode anhand der Beschreibung der Sueben.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die These lautet, dass Caesars Perspektive ethnozentrisch geprägt ist und die Germanen als primitive Barbaren und Feinde Roms darstellt. Sein Bild der Germanen wird als Ergebnis seiner römischen Perspektive und seiner Rolle als Eroberer interpretiert.
Wie definiert Caesar den Begriff „Germane“?
Caesar etabliert eine geographische Abgrenzung der Germanen, positioniert sie jenseits des Rheins. Die Bezeichnung „Germani“ wird jedoch nicht von den Stämmen selbst verwendet, sondern von den Römern, was auf eine römische Kategorisierung hinweist. Caesar grenzt die Germanen von den Galliern ab, was seine Rolle als "Eroberer und Entdecker" unterstreicht.
Welche Rolle spielt der Rhein in Caesars Darstellung?
Der Rhein wird als ethnische und kulturelle Grenze dargestellt. Die Rheinübertretungen germanischer Stämme und Caesars Reaktionen darauf werden analysiert, um die strategische und symbolische Bedeutung des Rheins im Kontext des römischen Expansionsbestrebens zu beleuchten.
Wie beschreibt Caesar seine Begegnungen mit germanischen Stämmen?
Die Arbeit analysiert Caesars Begegnungen mit verschiedenen germanischen Stämmen, insbesondere mit Ariovist, den Usipeter und Tenkterern. Der Fokus liegt auf der Interpretation von Caesars Berichten und deren Aussagekraft für das Verständnis seines Germanenbildes. Es wird untersucht, wie Caesar verschiedene Begegnungen beschreibt und wie diese sein Gesamtbild der Germanen beeinflussen.
Welche ethnographische Methode verwendet Caesar?
Caesars ethnographische Methode wird anhand der Beschreibung der Sueben analysiert. Es wird untersucht, welche Unterschiede Caesar zwischen Römern und Sueben sieht und wie er den Blick auf das Innere und Äußere des Stammes darstellt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung der Kultur, der Lebensweise und der sozialen Strukturen der Sueben im Kontext des römischen Bildes von den "Barbaren".
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Germanen, Caesar, De Bello Gallico, Ethnographie, Barbaren, Ariovist, Rhein, Sueben, Ethnozentrismus, Gallier, römisches Reich, militärische Expansion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Caesars Definition des Germanenbegriffes, seinen Begegnungen mit den Germanen, dem Rhein als Grenze, einer ethnographischen Analyse der Sueben und einem Fazit.
- Quote paper
- Sandra Offermanns (Author), 2013, Caesar als Ethnograph. Das Germanenbild in "De Bello Gallico“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268207