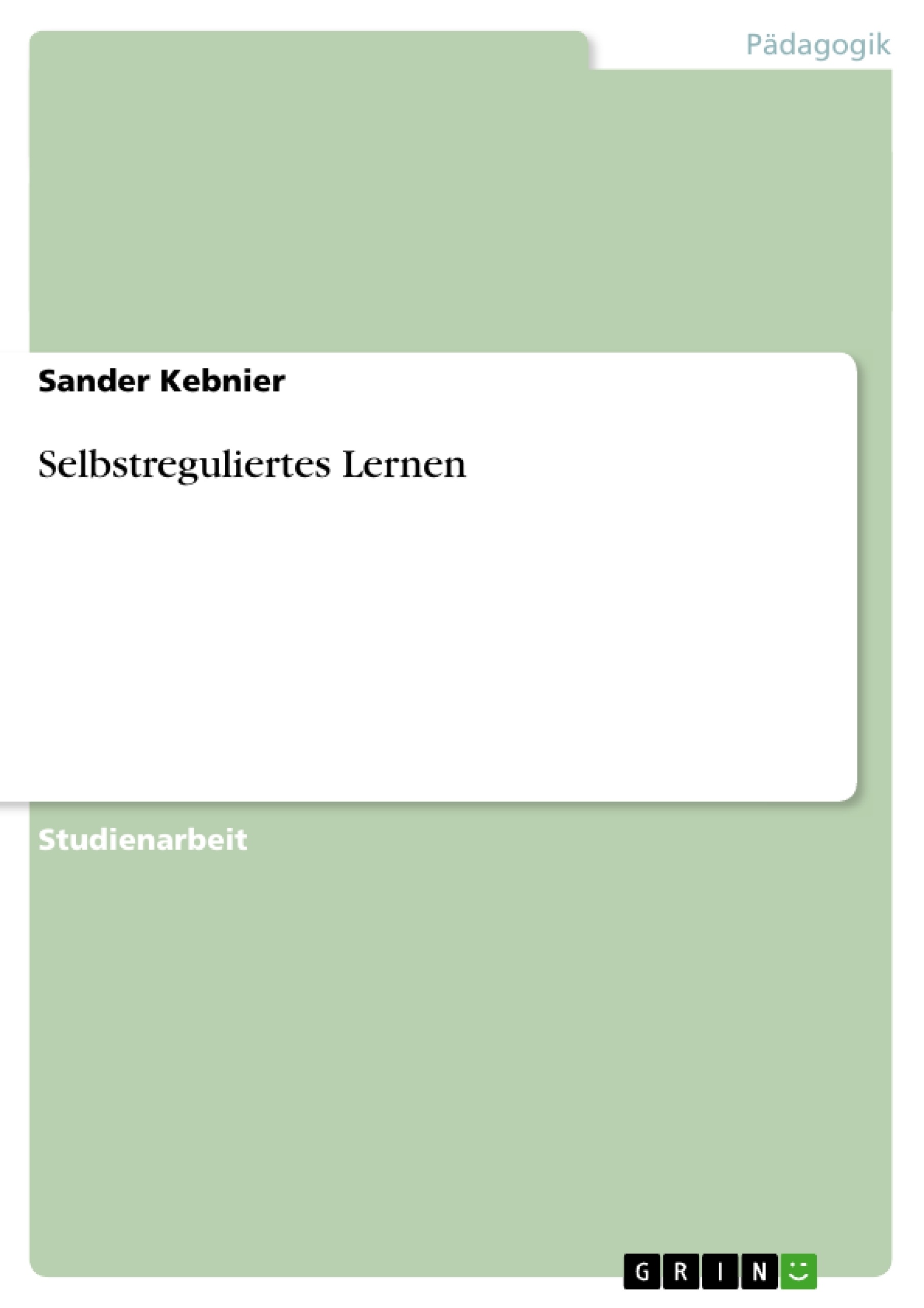In der sich stets wandelnden, sich rasant verändernden modernen Welt ist ein breiter Bestand an kognitiven und vor allem metakognitiven Fertigkeiten und Fähigkeiten obligatorisch. Dem Individuum wird ein Wissens- und Fertigkeitenrepertoire abverlangt, welchem ohne institutionalisierte Bildungsprozesse unmöglich Herr zu werden ist. Diese Aufgabe fällt somit den Schulen, Hochschulen und anderen etwaigen Bildungsstätten, gleichsam den Lehrenden und den Lernenden zu. Selbstregulative Kompetenzen sind somit im schulischen System und im Zusammenhang mit dem lebenslangen Lernen ein unabdingbares Erfordernis. Jene Fähig- und Fertigkeiten können keinesfalls als selbstverständlich oder als »von selbst zutage tretend« bezeichnet werden. Wird demnach, wie häufig üblich, weder im sekundären noch im tertiären Bildungsbereich eine Förderung der Selbstregulation initiiert, so hat dies weitreichende negative Folgen.
Einleitung
In der sich stets wandelnden, sich rasant verändernden modernen Welt ist ein breiter Bestand an kog- nitiven und vor allem metakognitiven Fertigkeiten und Fähigkeiten obligatorisch. Dem Individuum wird ein Wissens- und Fertigkeitenrepertoire abverlangt, welchem ohne institutionalisierte Bildungs- prozesse unmöglich Herr zu werden ist. Diese Aufgabe fällt somit den Schulen, Hochschulen und anderen etwaigen Bildungsstätten, gleichsam den Lehrenden und den Lernenden zu (vgl. KÖL- LER/SCHIEFELE 2003, S. 155). Den Schulen wird somit eine pädagogische Effizienz zugesprochen, einhergehend mit dem sowohl fachlichen als auch dem darüber hinausgehenden Wissenserwerb (vgl. KÖLLER 2012, S. 73). Die Heterogenität der Lerngruppen stellt dabei zum einen für die Bildungsfor- schung und zum anderen für die Praxis eine erhebliche Herausforderung dar (vgl. GROTLÜSCHEN 2004, S. 128f.). Eine Möglichkeit dieser Problematik entgegenzutreten und die Vermittlung von Fachwissen und weiterführenden Kompetenzen zu fördern, bietet das selbstregulierte Lernen. Da das Wissen stetig fluktuiert, muss der Lernende gleichsam vorbereitet sein, neues Wissen eigenständig zu erwerben (vgl. BARTH 1911, S. 20). Selbstregulative Kompetenzen sind somit im schulischen Sys- tem und im Zusammenhang mit dem lebenslangen Lernen ein unabdingbares Erfordernis. Jene Fähig- und Fertigkeiten können keinesfalls als selbstverständlich oder als »von selbst zutage tretend« be- zeichnet werden. Wird demnach, wie häufig üblich, weder im sekundären noch im tertiären Bildungs- bereich eine Förderung der Selbstregulation initiiert, so hat dies weitreichende negative Folgen (vgl. HASSELHORN/GOLD 2013, S. 328). Die Lernprozesse müssen autozentriert strukturiert und vor allem reflektiert werden. Ebendeshalb bildet die Selbstregulation als Schlüsselkompetenz in diversen Lern- situationen und -prozessen einen relevanten Unterbau (vgl. LANDMANN et al. 2009, S. 50).
Begriffbestimmung des Terminus »selbstreguliertes Lernen«
In allen Lernprozessen ist eine Steuerungskomponente auszumachen. Hat der Lernende jene Instanz der Regulation selbst inne, so wird vom selbstregulierten bzw. selbstgesteuerten Lernen gesprochen. Der konträre Fall, liegt die Regulationsinstanz sonach außerhalb des Lernenden, ist als fremdgesteu- ertes Lernen zu bezeichnen. In der Schule oszilliert demnach der Lernprozess zwischen dem eher selbst- oder fremdgesteuerten Lernen. Eine Mischform liegt vor, welche bestenfalls eine Balance zwischen Individualisierung und Zentralität im Unterricht zu schaffen versucht (vgl. HAGENER 2007,S. 13). Das Lernziel, beispielsweise ein bekannt gegebener Klausurtermin, kann von außen an den Lernenden herangetragen werden und somit die eigentliche selbstständige, strategische Lernaktivität auslösen, die einen Wissenserwerb zum Ziel hat. Unterschiedliche Lernsituationen können insofern sowohl fremd- als auch selbstgesteuerte Lernaktivitäten fordern und gleichsam fördern, somit mehr oder minder ausgeprägt zulassen. Das selbstregulierte Lernen ist dabei vielmehr eine Methode des Wissenserwerbs und keine spezifische Lehrmethode. Gleichsam offenbaren sich die normative Kom- ponente, somit die Zielsetzung, dass die Lernenden selbstreguliert lernen und arbeiten können, und die instruktionale Methode, um jenes Ziel zu erreichen (vgl. HASSELHORN/GOLD 2013, S. 325).
„Selbstgesteuertes ist selbstorganisiertes, ist selbstbestimmtes, ist selbstreguliertes Lernen“ (ebd.,S. 328). In der englischsprachigen Literatur wird dabei häufig der Terminus »self-regulated learning« (SRL) verwendet. Dennoch verbirgt sich hinter dem pädagogisch-psychologischen Konzept keine gänzlich einheitliche, allgemeingültige Definition, da sich eine Vielzahl an (Teil-)Disziplinen unter den verschiedensten Blickwinkeln mit jener auseinandersetzt (vgl. REINMANN/MANDL 2006, S. 645). Ein Faktum tritt jedoch deutlich hervor: Im Mittelpunkt steht der Lernende, der selbstreguliert, gleich- sam als Initiator und Organisator seinen Lernprozess steuert, reflektiert und optimiert (vgl. DEITERING 1995, S. 11). Dennoch kann ein Teil der Handlung bzw. Aktivität, wie bereits in der Einleitung er-läutert, fremdbestimmt sein, solange der Lernende nicht vollends in seinem Tun limitiert und kontrolliert ist (vgl. REINMANN/MANDL 2006, S. 645). Der Lernende reguliert demnach seine Lernaktivität eigenständig und setzt sich Lernziele, passt seine Strategien und Techniken dem Inhalt und jenen Zielen an, motiviert, reflektiert und optimiert bzw. korrigiert nach Beendigung der Lernaktivität den Prozess, die Strategie (vgl. ARTELT/DEMMRICH/BAUMERT 2001, S. 271). Die Theorien bzw. Modelle des selbstregulierten Lernens rücken entweder die Komponenten, also die inhaltlichen Ebenen der Selbstregulation (Komponentenmodelle), oder das Charakteristikum und den Hergang der selbstregulativen Aktivität in den Vordergrund (Prozessmodelle).
Die Komponenten selbstregulierten Lernens (Komponentenmodelle)
Die Komponentenmodelle selbstregulierten Lernens explizieren zum einen die Kompetenzen der selbstbestimmt Lernenden und zum anderen die Inhaltskomplexe und Ebenen, auf welche sich die Selbstregulation bezieht. Eine besondere Relevanz kommt dabei den kognitiven, metakognitiven, motivationalen und volitionalen Komponenten zu (vgl. HASSELHORN/GOLD 2013, S. 334). Die kog- nitive Komponente umfasst die Wahrnehmungs- und Denkvorgänge, das (strategische und auch kon- zeptionelle) Wissen, gleichwie die Fertigkeit, die Strategien anzuwenden. Die metakognitive Kom- ponente hingegen beschreibt die Entwicklung, Selbstbeobachtung und Reflexion bzw. die Anpassung und Optimierung in Verbindung zum beabsichtigten Lernziel. Es handelt sich also um das Denken über das Denken, das Wissen über und um das (eigene) Wissen. Die motivationale Komponente um- fasst weiterführend jene Aktivitäten, die der Initiierung (Selbstmotivation, fremdmotivierte Lernziele etc.) des Lernens zugrunde liegen. Darüber hinaus spielt die volitionale Komponente, also das Auf- rechterhalten des Lernens, eine entscheidende Rolle (vgl. ebd., S. 334/LANDMANN et al. 2009, S. 50). „[Self-regulated learning] is the fusion of skill and will. It is informed by metacognition from self and others and is fueled by affect and desire“(PARIS/PARIS 2001, S. 98). Es liegt folglich eine wechsel- seitige Verbindung zwischen der motivationalen und der kognitiven Regulationsebene vor.
So beschreibt MONIQUE BOEKAERTS (1999) ein Drei-Schichten-Modell, dass jene Implikationen des selbstregulierten Lernens umfasst (Abb. 1). Die innere Schicht beinhaltet die kognitiven Prozesse und die damit einhergehenden Primärstrategien der Informationsverarbeitung, die gleichsam als habituelle Lernstile und Vorgehensweisen zu verstehen sind (vgl. HASSELHORN/GOLD 2013, S. 334). In diesem Zusammenhang stellen sich die »Was-Fragen«, welche auf die zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Primärstrategien zurückzuführen sind (vgl. BOEKAERTS 1999, S. 451ff.). Die mittlere Schicht impliziert die Regulation des Lernprozesses und setzt somit eigenes metakognitives Wissen voraus. Der Einsatz der kognitiven Primärstrate-gien wird kontrolliert und optimiert. BOEKAERTS beschreibt dies mit den »Wie-Fragen«. Die äu- ßere Schicht hingegen zeigt, dass der gesamte Lernprozess in ein kognitives, motivationales Selbstkonzept eingebunden und mit der selbst- bezogenen Überzeugung eines Individuums ver- woben ist. In diesem Fall stellen sich die »Wa- rum-Fragen« der emotionalen, motivationalen und volitionalen Haltung des Lernens (vgl. HAS- SELHORN/GOLD 2013, S. 334f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Drei-Schichten-Modell (nach BOEKAERTS 1999, S. 449)
[...]
- Arbeit zitieren
- Sander Kebnier (Autor:in), 2014, Selbstreguliertes Lernen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268014