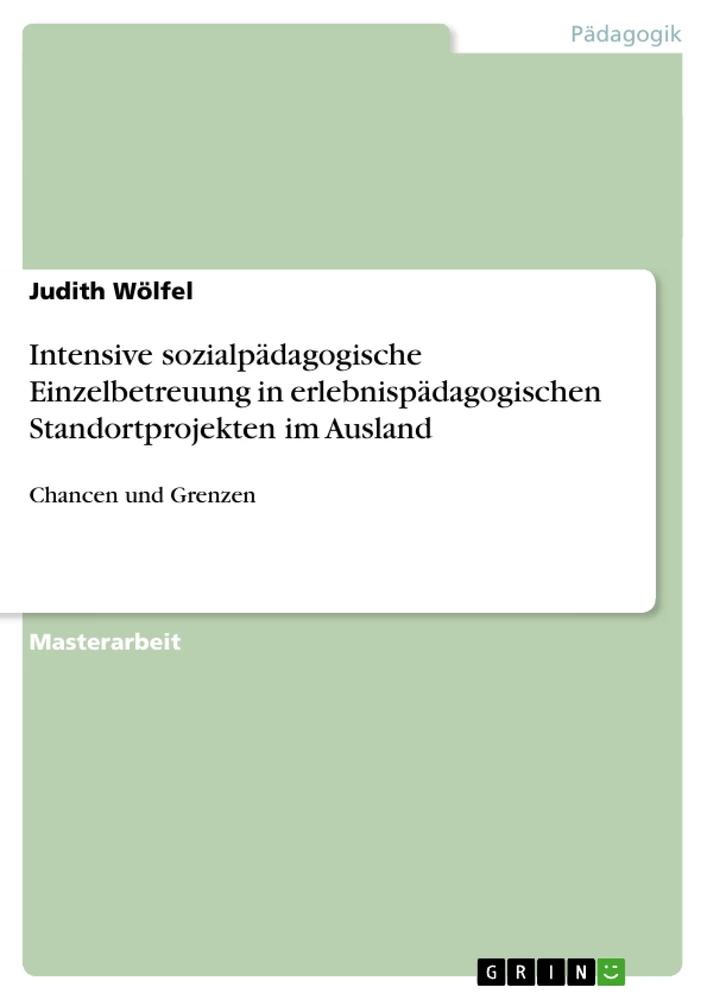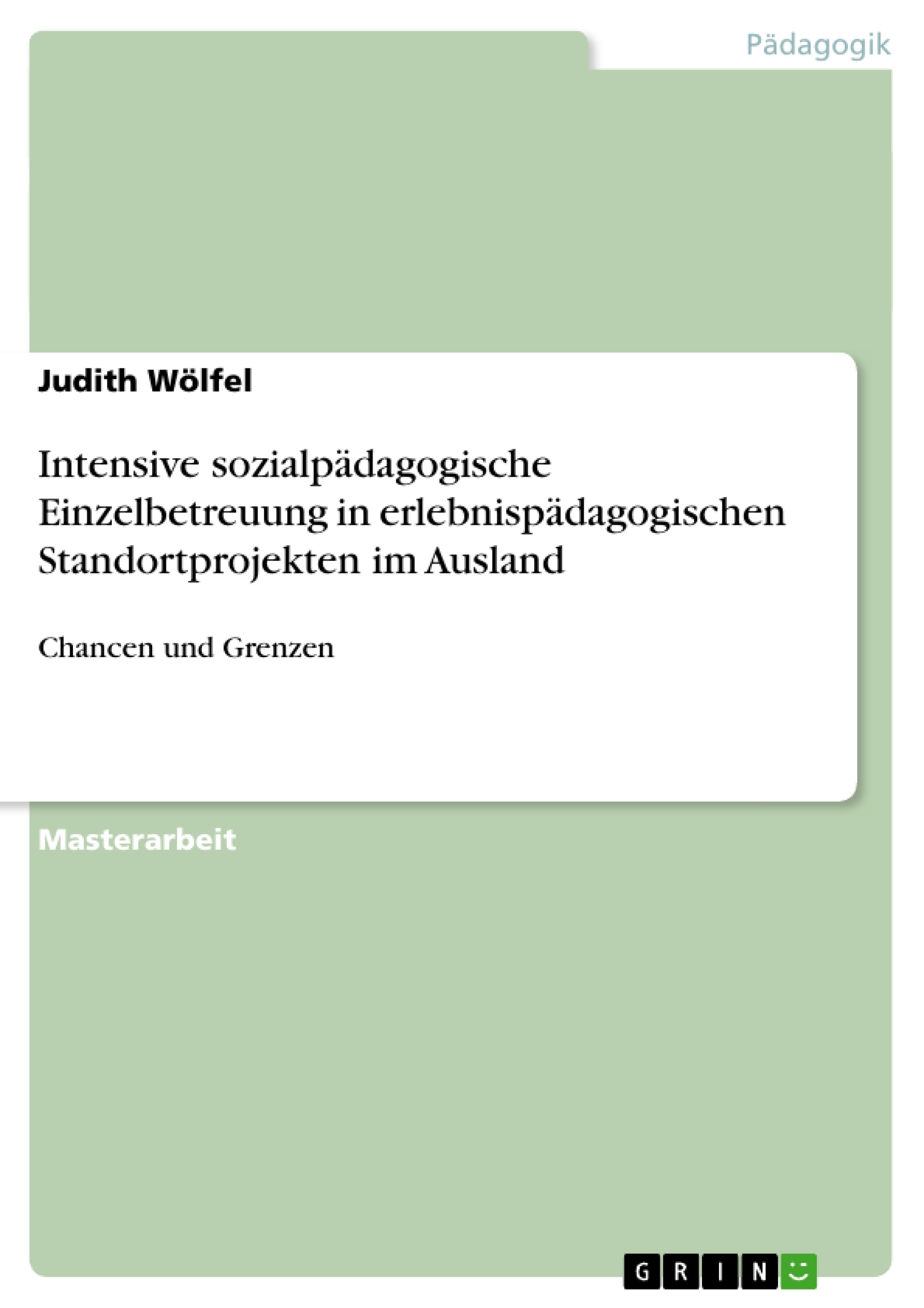Kinder und Jugendliche mit gravierenden Verhaltensauffälligkeiten pendeln oftmals jahrelang zwischen ihrer Herkunftsfamilie, der Jugendhilfe und geschlossenen Unter-bringungen hin und her. Doch nur in seltenen Fällen greifen bei massiven Störungen diese Hilfeangebote und können eine Verhaltensänderung bei dem betroffenen Jugendlichen herbeiführen. Was aber tun mit jugendlichen Serientätern, Drogenabhängigen oder Schulverweigerern, die durch das gesamte Raster von Jugendhilfe-Maßnahmen rauschen?
Als oftmals letzter Versuch kommt die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) zum Einsatz, um die Jugendlichen vor langfristiger Unterbringung in Gefängnis oder Psychiatrie zu bewahren. Diese richtet sich explizit an all diejenigen, die eine individuell auf sie zugeschnittene sozialpädagogisch und therapeutische Hilfemaßnahme benötigen und in diesem Rahmen oftmals einzeln von einem Betreuer über einen längeren Zeitraum, meist im Ausland, betreut werden.
Während eines mehrmonatigen Praktikums beim KAP-Institut in Regensburg im Jahr 2012 lernte die Autorin diese besondere Form der Einzelbetreuung kennen. Sie betreute über einen Zeitraum von über zwei Monaten einen 12-jährigen Jungen. Während dieser Tätigkeit und der damit verbundenden intensiven Beschäftigung mit dem Thema ISE entwickelte sich u.a. die Frage nach den Einsatzmöglichkeiten von erlebnispädagogischen Aktionen zur Unterstützung des therapeutischen Prozesses im Rahmen einer ISE-Maßnahme.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen Standortprojekte im Ausland näher beleuch-tet werden, da es hierzu eine Vielzahl an wissenschaftlichen Untersuchungen gibt, die die Nachhaltigkeit des Auslandes immer wieder betonen, obgleich Auslandsprojekte von den Medien immer als kostenintensive Maßnahmen kritisiert werden.
Die ISE v.a. im Ausland macht nur einen kleinen Anteil des gesamten Spektrums an Jugendhilfemaßnahmen aus. Trotzdem sind Artikel über Vorfälle oder Zweifel am Nutzen dieser Hilfen immer wieder in der Tagespresse zu finden. Darin wird die ISE als überteuerte, einem Urlaub gleichende Maßnahme für jugendliche Straftäter beschrie-ben. Bis heute fehlen aber wissenschaftliche Langzeitstudien, die das Für und Wider dieser Maßnahmen neutral ergründen. Deshalb verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, beide Seiten, d.h. Chancen und Grenzen von ISE-Maßnahmen umfassend zu beleuchten, um somit einen Beitrag zur aktuellen Debatte liefern zu können.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Datensammlung
2.1. Erhebung des Aktuellen Forschungsstandes
2.2. Telefon-Interview
2.2.1. Wahl der Methode
2.2.2. Vorstellung der Interview-Partner
2.2.2.1. KAP-Institut
2.2.2.2. Wellenbrecher e.V
2.2.3. Durchführung der Interviews
3. Allgemeines zur ISE im Ausland
3.1. Grundlagen der ISE
3.2. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen
3.3. Ablauf einer ISE Massnahme im Ausland
3.4. Zielgruppe einer Auslandsmassnahme
3.5. Chancen der ISE im Ausland
3.5.1. Chancen des Standorts im Ausland
3.5.2. Chancen der 1:1 Betreuung
3.5.3. Chancen der individuellen Anpassung
3.5.4. Chancen der Alltagsorientierung
3.5.5. Chancen von Arbeitsprojekten
3.6. Grenzen der ISE im Ausland
3.6.1. Transferproblem
3.6.2. Problem des messbaren Erfolgs
3.6.3. Eingeschränkte Freiwilligkeit und Beteiligungs-möglichkeiten
3.6.4. Qualifiziertes Personal als Mangelware
3.6.5. ISE als unzureichender Therapie-Ersatz
3.6.6. ISE als finales Rettungskonzept
3.6.7. Kostenfrage und Erfolgsquote
3.6.8. Fazit: Chancen und Grenzen der ISE
4. Erlebnispädagogik in der Jugendarbeit
4.1. Definitionsversuche
4.1.1. Kurt Hahn als Begründer der Erlebnispädagogik
4.1.2. Erlebnispädagogik nach Heckmair/Michl
4.1.3. Das Modell des Abenteuers nach Becker
4.2. Zielgruppe der EP
4.3. Rolle der EP in der ISE
5. Chancen der EP in der ISE
5.1. Erhöhung der Motivation
5.2. Erhöhung der Selbstwirksamkeit
5.3. Intensive Beziehung
5.4. Individuelle Anpassung
5.5. Bruch mit Routinen
5.6. Betonung der Reflexion
5.7. Nachhaltiges Lernen
5.8. Zeitersparnis durch Einsatz erlebnispädagogischer Methoden
5.9. Das Fremde als Bildungspotenzial in der ISE
5.10. Fazit: Chancen der EP in der ISE
6. Grenzen der EP in der ISE
6.1. Begrenzte Einsatzmöglichkeiten von EP in der ISE
6.2. Uneinigkeit über Methodik
6.3. Eingeschränkte Zielgruppenkonformität
6.4. Spass-aktionen unter dem Deckmantel der EP
6.5. EP als Gratwanderung in der ISE
6.6. FAzit: Grenzen der EP in der ISE
7. Diskussion
8. Ausblick
9. Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Art der Erzieherischen Hilfen 2011 in Deutschland
Abbildung 2: Entwicklung ISE (Stand 2011)
Abbildung 3: Altersgruppen ISE (Stand 2011)
Abbildung 4: Intensivpädagogische Auslandsbetreuung nach Villany/Witte, 2006, S. 38
Anmerkungen der Autorin
In der vorliegenden Arbeit wurde aufgrund der besseren Lesbarkeit durchgehend nur die männliche Form (z.B. der Betreuer, der Jugendliche) verwendet. Hierbei ist – falls nicht explizit erwähnt – jedoch gleichzeitig immer die weibliche Form mit eingeschlossen.
Zudem wird durchgängig die Bezeichnung „Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“ der Einfachheit halber mit „ISE“, der Begriff der „Erlebnispädagogik“ an manchen Stellen mit „EP“ abgekürzt.
1. Einleitung
Kinder und Jugendliche mit gravierenden Verhaltensauffälligkeiten pendeln oftmals jahrelang zwischen ihrer Herkunftsfamilie, der Jugendhilfe und geschlossenen Unterbringungen hin und her. Doch nur in seltenen Fällen greifen bei massiven Störungen diese Hilfeangebote und können eine Verhaltensänderung bei dem betroffenen Jugendlichen herbeiführen. Was aber tun mit jugendlichen Serientätern, Drogenabhängigen oder Schulverweigerern, die durch das gesamte Raster von Jugendhilfe-Maßnahmen rauschen?
Als oftmals letzter Versuch kommt die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) zum Einsatz, um die Jugendlichen vor langfristiger Unterbringung in Gefängnis oder Psychiatrie zu bewahren. Diese richtet sich explizit an all diejenigen, die eine individuell auf sie zugeschnittene sozialpädagogisch und therapeutische Hilfemaßnahme benötigen und in diesem Rahmen oftmals einzeln von einem Betreuer über einen längeren Zeitraum, meist im Ausland, betreut werden.
Während eines mehrmonatigen Praktikums beim KAP-Institut in Regensburg im Jahr 2012 lernte die Autorin diese besondere Form der Einzelbetreuung kennen. Sie betreute über einen Zeitraum von über zwei Monaten einen 12-jährigen Jungen. Während dieser Tätigkeit und der damit verbundenden intensiven Beschäftigung mit dem Thema ISE entwickelte sich u.a. die Frage nach den Einsatzmöglichkeiten von erlebnispädagogischen Aktionen zur Unterstützung des therapeutischen Prozesses im Rahmen einer ISE-Maßnahme.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen Standortprojekte im Ausland näher beleuchtet werden, da es hierzu eine Vielzahl an wissenschaftlichen Untersuchungen gibt, die die Nachhaltigkeit des Auslandes immer wieder betonen, obgleich Auslandsprojekte von den Medien immer als kostenintensive Maßnahmen kritisiert werden.
Die ISE v.a. im Ausland macht nur einen kleinen Anteil des gesamten Spektrums an Jugendhilfemaßnahmen aus. Trotzdem sind Artikel über Vorfälle oder Zweifel am Nutzen dieser Hilfen immer wieder in der Tagespresse zu finden. Darin wird die ISE als überteuerte, einem Urlaub gleichende Maßnahme für jugendliche Straftäter beschrieben. Bis heute fehlen aber wissenschaftliche Langzeitstudien, die das Für und Wider dieser Maßnahmen neutral ergründen. Deshalb verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, beide Seiten, d.h. Chancen und Grenzen von ISE-Maßnahmen umfassend zu beleuchten, um somit einen Beitrag zur aktuellen Debatte liefern zu können.
Um die Chancen und Grenzen von ISE-Auslandsmaßnahmen analysieren zu können, wurde zunächst der aktuelle Forschungsstand zum Thema ISE im Allgemeinen betrachtet als auch zwei Interviews mit Experten aus der ISE-Praxis ausgewertet. Im Anschluss werden Hintergründe und Methoden der Erlebnispädagogik vorgestellt. Abschließend werden die hieraus gewonnenen Erkenntnisse zusammengeführt und die Chancen und Grenzen von erlebnispädagogischen Aktivitäten im Rahmen der ISE diskutiert.
2. Datensammlung
Der aktuelle Forschungsstand des im Rahmen der vorliegenden Arbeit behandelten Themas wurde verschiedenen Quellen und Meinungen von Experten entnommen. Die Aussagen, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit getroffen werden, erheben jedoch nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit und sollen nur beispielhaft verschiedene Chancen und Grenzen der ISE im Ausland aufzeigen.
Im Folgenden soll nun die Auswahl des in der aktuellen Literatur zu findenden Forschungsstandes begründet werden sowie auf die Durchführung und Auswertung der Telefon-Interviews eingegangen werden, welche im Zuge dieser Arbeit von der Autorin geführt wurden.
2.1. Erhebung des Aktuellen Forschungsstandes
Der aktuelle Forschungsstand wurde Büchern und Zeitschriftenartikel, darunter auch Studien und Zeitungsartikel, die online zur Verfügung standen, entnommen. Artikel, die das Für und Wider der ISE behandeln, fanden sich dabei überwiegend im Internet und sind größtenteils sehr aktuell, was bei Büchern zum Thema ISE nicht immer der Fall war.
Gerade bei statistischen Daten wurde versucht, den aktuellsten Forschungsstand widerzuspiegeln, indem bspw. Daten des Statistischen Bundesamtes, verwendet wurden. Hierbei konnten jedoch keine aktuelleren Daten als aus dem Jahr 2011 gefunden werden. Somit können die unter 3.2. aufgezeigten Daten nicht den Stand von 2013 wiedergeben.
2.2. Telefon-Interview
Aus einer Vielzahl von Interview-Anfragen erhielt die Autorin zwei Zusagen von Mitarbeitern zweier im deutschsprachigen Raum sehr bekannten ISE-Anbietern (KAP-Institut und Wellenbrecher e.V.). Diese beiden Interviews erheben keinesfalls den Anspruch, repräsentativ für alle erlebnispädagogischen Auslandsprojekte im Rahmen einer ISE-Maßnahme zu sein, sollen aber beispielhaft die Durchführung und Erfahrungswerte der jeweiligen Träger, dem KAP Institut mit Sitz in Regensburg und von Wellenbrecher e.V. aus Dortmund, aufzeigen.
Dadurch, dass die beiden Interview-Partner langjährige Mitarbeiter dieser Träger sind, sind diese zwangsläufig Befürworter von ISE-Projekten und lieferten daher im Rahmen der Interviews kaum kritische Ansichten. Die Autorin versuchte daher, einen Vertreter der wissenschaftlichen Perspektive zu gewinnen, um dessen Sichtweise den Erfahrungen der Experten gegenüberzustellen. Dieser stellte sich jedoch nicht für ein Interview zur Verfügung.
Das Interview mit ABC vom KAP-Institut wurde am 06. Mai 2013, das mit Herrn XYZ von Wellenbrecher e.V. am 20. Juni 2013 telefonisch durchgeführt und aufgezeichnet.
Der Schwerpunkt der Interviews wurde gezielt auf Chancen und Grenzen von erlebnispädagogischen Standortprojekten im Ausland gelenkt. Beide Interviewpartner lieferten darüber hinaus noch weitere Informationen zum Thema ISE, die jedoch nicht alle im begrenzten Rahmen der vorliegenden Arbeit behandelt werden konnten.
2.2.1. Wahl der Methode
Die Vorteile des Telefoninterviews und damit die Begründung der Wahl dieser Methode im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen im Folgenden kurz aufgezeigt werden.
Zunächst einmal handelt es sich beim Telefoninterview um eine Methode, die innerhalb kurzer Zeit eine große Menge an Daten produzieren kann. Dies erfolgt mit Hilfe eines Mediums, das so gut wie jeder Person zur Verfügung steht. Desweiteren ist die Akzeptanz traditioneller Methoden wie bspw. „face-to-face“ Befragungen gering, was sich oftmals in Form von geringen Teilnehmerzahlen widerspiegelt. Letztere sind zudem mit höheren Kosten verbunden, bspw. muss ein Raum zur Verfügung gestellt werden und sowohl Interview-Partner als auch Forscher müssen eigens zur Durchführung anreisen (Schnell, Hill & Esser, 2008). Diese Schwierigkeiten erübrigen sich bei Telefon-Interviews.
Das problemzentrierte Interview wurde gewählt, um mit Hilfe von offenen Fragen das vorab erarbeitete wissenschaftliche Konzept ggf. zu modifizieren. Der Befragte soll hierfür seine Sicht der sozialen Realität schildern, was im Anschluss mit den theoretischen Vorstellungen verglichen wird (Lamnek, 2005). Das Gespräch wurde mit Einverständnis der Interviewpartner aufgezeichnet, transkribiert und anschließend ausgewertet und an entsprechenden Stellen der vorliegenden Arbeit eingefügt.
2.2.2. Vorstellung der Interview-Partner
Auf Anfrage stellten sich ABC vom KAP-Institut und XYZ von Wellenbrecher e.V. zur Verfügung. Im Folgenden sollen diese beiden Interview-Partner sowie ihr Trägerverein kurz vorgestellt werden.
2.2.2.1. KAP-Institut
Im Jahr 1994 führte Peter Alberter, der heutige Geschäftsführer und Gründer des KAP Institutes mit Sitz in der Nähe von Regensburg, ein individualpädagogisches, ca. sechs Monate dauerndes Reiseprojekt mit einem schwer erziehbaren Jugendlichen durch. Das Ziel war es, auf dem Mountainbike von Marokko zurück nach Deutschland zu fahren. Ein Projekt[1] dieser Art war bis dato in Europa erst- und einmalig und ein voller Erfolg.
Heute vereint die KAP-Intensivtherapie die Bereiche Clearing, Diagnose und Therapie mit der intensivpädagogischen Einzelbetreuung und führt diese Projekte sowohl als Standort- als auch Reiseprojekte im In- und Ausland durch.
ABC, mit dem das Interview stellvertretend für Herrn Alberter durchgeführt wurde, ist seit vielen Jahren Projektleiter der KAP-Intensivtherapie und hat zuvor selbst eine Vielzahl von ISE-Maßnahmen im In- und Ausland durchgeführt.
2.2.2.2. Wellenbrecher e.V.
Seit 1993 gilt Wellenbrecher e.V. als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe mit Sitz in Dortmund und führte 2001 erstmals ISE-Maßnahmen[2] im Ausland durch. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2013) bietet Wellenbrecher e.V. in Finnland, Polen, Lettland, Ungarn und Russland Auslandsprojekte an. Welches Land für die Auslandsmaßnahme in Frage kommt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Dabei kommen unterschiedliche Faktoren zum Tragen, bspw. welches Projekt in welchem Land für den jeweiligen Jugendlichen förderlich ist.
Für das Interview stellte sich Herr XYZ, zuständig für die Koordination von Auslandsprojekten, zur Verfügung.
2.2.3. Durchführung der Interviews
Ziel der Telefon-Interviews war es, Einsicht in die subjektive Ansicht der Befragten zu erlangen. Daher kam nur eine qualitative Form des Interviews in Frage. Mit Hilfe eines nicht-standardisierten Interviews sollte der Befragte dazu aufgefordert werden, zu dem vorgegebenen Thema möglichst ausführlich in erzählender Art und Weise Stellung zu nehmen. Um das Thema weitestgehend einzugrenzen, d.h. gezielt auf die Chancen und Grenzen der ISE einzugehen und nicht die ISE im Allgemeinen zu betrachten, wurde dem Interview-Partner vorab folgender Interview-Leitfaden zugeschickt.
Interview-Leitfaden
1. Beispielhafter Ablauf der ISE im Rahmen eines Standortprojektes im Ausland?
2. Welche Rolle spielt hierbei die Erlebnispädagogik? Wie wird diese eingesetzt und mit welchem Ziel?
3. Welche Erfahrungen haben Sie mit erlebnispädagogischen Elementen in Standortprojekten im Ausland gesammelt?
a. Welche Aktivitäten wurden eingesetzt? (konkretes Beispiel)
b. Welche Intention stand dahinter? (konkretes Beispiel)
c. Konnten diese Ziele erreicht werden? (konkretes Beispiel)
4. Können erlebnispädagogische Elemente den therapeutischen Prozess unterstützen? Wenn ja, inwiefern?
5. Was kann die Erlebnispädagogik in Standortprojekten im Ausland nicht leisten?
Diese Fragen wurden im Rahmen des Interviews nacheinander beantwortet. Währenddessen versuchte die Autorin sich weitestgehend mit weiteren Fragen zurück zu halten, um dem Interview-Partner das freie Erzählen aus dessen Erfahrungsschatz zu ermöglichen.
Aufgrund technischer Probleme war es bei dem Interview mit ABC vom KAP-Institut leider nicht möglich, die Beantwortung der ersten beiden Fragen auszuwerten, da auf dem Datenträger nur ein Rauschen zu hören ist. Die Antworten auf diese Fragen decken sich aber größtenteils mit den Informationen, die das KAP Institut auf seiner Internetseite präsentiert. Deshalb wird in den dazu passenden Passagen der vorliegenden Arbeit hieraus zitiert. Diese Stellen wurden entsprechend gekennzeichnet.
Um den umfassenden Begriff der Erlebnispädagogik im Rahmen des Interviews etwas einzugrenzen, wurde der Schwerpunkt auf die Durchführung von ISE-Maßnahmen mit Outdoor-Aktivitäten gelegt. Hierbei wurde abgewogen, welche Aktivitäten wann zum Einsatz kommen und was diese bei dem Jugendlichen bewirken können.
Zuvor soll dem Leser ein Einblick in die Hintergründe der Auslandsmaßnahmen in Form von aktuellen Zahlen und Daten gewährt werden, um im Anschluss das Konzept der ISE mit seinen Chancen und Grenzen besser nachvollziehen zu können.
3. Allgemeines zur ISE im Ausland
Maßnahmen der ISE können in verschiedenen Varianten umgesetzt werden. Möglich sind hierbei Segel-, Standort- oder Reiseprojekte, wobei alle Formen sowohl im In- als auch im Ausland stattfinden können. Dabei wird in der Regel ein Jugendlicher über den gesamten Betreuungszeitraum hinweg von ein und demselben Betreuer begleitet.
Im Folgenden soll nun zunächst auf die gesetzliche Verankerung der ISE und der Umstände, die den Einsatz einer ISE im Ausland rechtfertigen, eingegangen werden. Es folgen einige statistische Erhebungen, um aufzuzeigen, welchen Stellenwert ISE im Ausland einnimmt, dazu gehören die Anzahl der Jugendlichen, die in den letzten Jahren an einer ISE im Ausland teilgenommen haben sowie eine Übersicht über die Altersstruktur dieser Jugendlichen. Schließlich wird ein exemplarischer Ablauf einer ISE-Maßnahme im Ausland skizziert sowie die Zielgruppe der ISE näher bestimmt.
3.1. Grundlagen der ISE
Die ISE ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz (kurz: KJHG) verankert und kommt deutschlandweit zum Einsatz (Feuck, 1998). Der §35 des KJHG SGB VIII besagt:
„Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.[3] “
Die Jugendlichen, für die diese Sonderform der Erziehungshilfe in Frage kommt, haben meist eine lange „Jugendhilfekarriere“ (Klawe & Bräuer, 1998, S.181) hinter sich. Oftmals haben die Jugendlichen eine kriminelle Vergangenheit, Drogen konsumiert oder die Schule abgebrochen und wurden daher meist vergeblich von einer Institution zur nächsten geschickt (Klein, 2010). Sie sind aufgrund einer Vielzahl von Entwicklungsdefiziten nicht in der Lage, ihr Leben eigenverantwortlich zu führen und bedürfen daher einer langfristigen pädagogischen Begleitung.
Hier können ISE-Maßnahmen ansetzen und belastende Aspekte der Lebensrealität der Jugendlichen überwinden, indem sie vielfältige Erfahrungsoptionen bieten. Das Ziel dabei ist, den Kompetenzrahmen der Klientel zu erweitern, sodass sie lernen, selbstbestimmt ihren Alltag zu bewältigen.
Nicht selten werden daher ISE-Maßnahmen als „finales Rettungskonzept“ (Fischer & Ziegenspeck, 2009, S.34) bezeichnet. Wenn Heime und Jugendämter alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, steht am Ende einer langen Liste von Erziehungshilfen oft nur noch die ISE als letzter Versuch, bei dem Jugendlichen eine Verhaltensänderung hervorzurufen. Denn es wird angenommen, dass eine Resozialisierung und Reintegration eines besonders schwierigen Jugendlichen nur noch in fernen, von der Alltagswelt getrennten Orten, beginnen kann.
3.2. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen
Im Jahr 2011 befanden sich laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden[4] 3477 Jugendliche in intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungsmaßnahmen der Bundesrepublik, dies entspricht gerade einmal 1,2% aller in Deutschland in Anspruch genommenen Hilfen zur Erziehung (vgl. Abb. 1). Den größten Bereich der Erziehungshilfen außerhalb des Elternhauses stellt mit 44% die Heimerziehung, gefolgt von der Unterbringung bei Pflegefamilien (42%) dar. Nur etwa jeder zehnte Jugendliche wird in einer Tagesgruppe betreut (11,8%).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Art der Erzieherischen Hilfen 2011 in Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Entwicklung ISE (Stand 2011)
20 Jahre zuvor, im Jahr 1991 wurden hingegen 865 junge Menschen intensiv pädagogisch betreut, dies entspricht etwa einem Viertel des aktuellen Standes von 2011 (vgl. Abb. 2). Wie der Abbildung 2 desweiteren zu entnehmen ist, wurden von 1991 bis zum Jahr 2000 ISE-Maßnahmen immer häufiger in Anspruch genommen, bis es im Jahr 2005 zu einem kleinen Einbruch kam. Dieser lässt sich dadurch begründen, dass aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2005 Jugendliche nur noch im Ausland betreut werden dürfen, wenn im Inland die Rahmenbedingungen für eine gelingende Betreuung nicht zur Verfügung gestellt werden können (Buchkremer, Emmerich & Groneick, 2011).
So heißt es in den Hilfen zur Erziehung, §27, Satz 2 (nach Buchkremer, Emmerich & Groneick, 2011):
„(…) Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfeziels im Einzelfall erforderlich ist.“
Ab dem Jahr 2007 stieg die Anzahl der ISE-Maßnahmen wieder stark an – der Bedarf an Auslandsmaßnahmen stieg und pendelte sich seitdem bei etwa 3500 betreuten Jugendlichen pro Jahr ein.
Nach Klawe (2005) wurde der Großteil (40,8%) aller bis dato durchgeführten ISE-Maßnahmen in Form von Standortprojekten umgesetzt. Hierzu werden Betreuungen, die im Inland oder bei deutschen Betreuern im Ausland erfolgen, zusammengefasst. Einer älteren Erhebung aus dem Jahr 1996 zufolge waren etwa 1000 Jugendliche (gerade einmal 1,25% aller deutschen Heimkinder) im Ausland untergebracht (Spiegel, 1996). Daran dürfte sich bis heute wenig geändert haben, denn Schätzungen zufolge wurden im Jahr 2008 zwischen 500 und 1000 Jugendliche im Ausland betreut (Buchkremer, Emmerich & Groneick, 2011; Fischer & Ziegenspeck, 2009).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Altersgruppen ISE (Stand 2011)
Abbildung 3 zeigt, in welche Altersgruppen sich die Jugendlichen, die in Form einer ISE betreut wurden, aufteilen. Die meisten Jugendlichen (60%) waren im Jahr 2011 minderjährig, was sich insofern erklären lässt, dass das Jugendamt die Hilfe der ISE im Regelfall nur für unter 18-jährige vergibt. Im Umkehrschluss ist der Wert von 40% der über 18-jährigen dennoch vergleichsweise groß und zeigt, wie hoch der Bedarf an weiterführender Betreuung auch über das 18. Lebensjahr hinaus ist. Aufgeteilt in den einzelnen Altersklassen ist die Gruppe der 15- bis 18-jährigen am stärksten vertreten. Dies ist wiederum ein Indiz dafür, dass die Jugendlichen, die eine ISE-Maßnahme beginnen, zuvor bereits andere Formen der Erziehungshilfe durchlaufen haben und schließlich im fortgeschrittenen Jugendalter die ISE als letzten Rettungsanker ergreifen. Zahlenmäßig kaum vertreten sind Kinder bis 12 Jahre und junge Erwachsene ab 21 Jahren, was damit erklärt werden kann, dass es für viele Jugendämter nicht vertretbar ist, 9-jährige bereits ins Ausland zu schicken, wenn die Hoffnung besteht, sie mit traditionellen Methoden vor Ort erreichen zu können, zumal in diesem Alter evtl. auch noch keine massive Auffälligkeit erkennbar ist, die eine Auslandsmaßnahme rechtfertigen könnte.
Mädchen stellten rund ein Drittel der mit Hilfe der ISE zu betreuenden Jugendlichen (Buchkremer, Emmerich & Groneick, 2011; Macsenaere & Klein, 2011). Mehr als jeder dritte Jugendliche (34,9%) kommt aus einer Familie mit ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils, in jedem vierten Haushalt (19,5%) wird nicht vorranging Deutsch gesprochen[5].
3.3. Ablauf einer ISE Massnahme im Ausland
Villany und Witte (2006) beschreiben sechs Phasen intensivpädagogischer Auslandsbetreuung; dieses Modell soll nun im Folgenden beispielhaft für alle ISE-Maßnahmen dargestellt werden und zeigt den theoretischen Verlauf eines solchen Projektes auf.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Intensivpädagogische Auslandsbetreuung nach Villany/Witte, 2006, S. 38
In der ersten Phase (Diagnostizieren) wird zunächst darüber entschieden, ob ein Auslandsprojekt für den Jugendlichen aufgrund seiner Merkmale sinnvoll erscheint. Falls dies zutrifft, werden im Rahmen eines Hilfeplangesprächs[6] zusammen mit dem Jugendamt, dem Träger, dem Jugendlichen selbst und dessen Eltern die Rahmenbedingungen eines passenden Settings entwickelt.
In der darauffolgenden Phase, dem Delegitimieren, die bereits im Ausland stattfindet, erfährt der Jugendliche im Rahmen seiner neuen Umwelt sowie der damit verbundenen Faktoren der fremden Sprache oder Kultur, dass seine bisherigen, verfestigten und bis dato zum Ziel führenden Handlungsroutinen, nun wirkungslos sind. Dies führt zum ersten Strukturbruch, der im Laufe dieser Arbeit näher erläutert wird (vgl. 5.5.).
Darauf aufbauend folgt Phase drei, das Neustrukturieren. Mit Hilfe seines Betreuers soll der Jugendliche nun lernen, neue Verhaltensmuster zu erlernen. Damit einhergehend wird die Beziehung zum Betreuer intensiviert und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut.
Um den Transfer des Gelernten in den Alltag in Deutschland vorzubereiten, werden in der vierten Phase, dem Konsolidieren, noch im Ausland die neu erlernten Kompetenzen eingeübt und weiter entwickelt, bis sich die neuen Verhaltensweisen bei dem Jugendlichen verfestigt haben.
Zurück in Deutschland soll in der fünften Phase (Transfer) das neu Erlernte in den Alltag übertragen und angewendet werden.
Schließlich werden diese neuen Handlungsstrategien verfestigt, um neue, selbstverständliche Routinen im Alltag zu etablieren (Phase 6: Normalisieren).
Die ISE ist also mit der Rückkehr nach Deutschland noch nicht abgeschlossen. Im in der Praxis selten realisierbaren Fall begleitet ein und derselbe Betreuer den Jugendlichen durch alle sechs Phasen hindurch. Die Dauer der für notwendig erachteten Betreuung schwankt dabei erheblich und wird flexibel auf den Bedarf des Jugendlichen angepasst. Laut Günder (2011) sollte jedoch ein Zeitraum von sechs Monaten nicht unterschritten werden. Im Regelfall liegt die Dauer einer ISE bei etwa einem Jahr, kann jedoch in sehr schwierigen Fällen auch über ein Jahr hinaus fortgeführt werden.
3.4. Zielgruppe einer Auslandsmassnahme
Laut Alberter (2008) werden verhaltensauffällige Jugendliche
„(…) von ihrer Umwelt hauptsächlich als Störenfriede, von der Politik als Kostenfaktor, vom Arbeitsmarkt als unbrauchbare Restgruppe und von der Gesellschaft allgemein als Kostenverursacher, für die die Steuergelder verschwendet werden, wahrgenommen.“ (S.181)
Was also tun mit diesen Jugendlichen? Laufen lassen oder wegsperren? Aufgeben, bevor sie überhaupt begonnen haben, eigenverantwortlich ihr Leben zu leben (Alberter, 2008)?
Genau diese Zielgruppe versucht die ISE aufzufangen. Meist haben sie einen langen Weg quer durch alle Bereiche der Erziehungshilfe hinter sich und können von Heimen nicht mehr getragen werden; diese Jugendlichen können und wollen ohnehin oftmals keine weiteren Hilfen annehmen. In der Regel kommen sie aufgrund ihrer Sozialisation und ihrer Biografie nicht mit sich selbst und anderen zurecht, ecken wegen ihrer Verhaltenswesen oftmals an, sind in vielerlei Hinsichten bereits gescheitert, weisen eine geringe Frustrationstoleranz auf und es fehlt ihnen an persönlichen Perspektiven (Günder, 2011).
Die Gründe für diese Entwicklungsdefizite sind vielfältig. So können zum einen schwierige Familienverhältnisse, Erlebnisarmut oder fehlende Entwicklungs- und Selbstentfaltungsmöglichkeiten zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Andererseits können durch gleichzeitige Reizüberflutung z.B. der Medien und materielle Überversorgung diese Entwicklungsdefizite zusätzlich verstärkt werden (Heckner & Scheiwe, 1993). Dies kann abweichende Verhaltensweisen (v.a. Aggressivität), ausgeprägte Beziehungsunfähigkeit, Weglaufen vor Aufgabenstellungen und Versagen in der Schul- und späteren Arbeitswelt zur Folge haben (Günder, 2011).
Nicht selten kommen die meist männlichen Jugendlichen (vgl. 3.2.) aus schwierigen Familienverhältnissen, tragen unbearbeitete traumatische Erfahrungen mit sich herum und weisen große Erziehungs- und Erfahrungsdefizite auf.
Die Herkunftsfamilie kann in vielen Fällen der Unterschicht zugeordnet werden (mit damit verbundenem geringen Ausbildungsgrad und niedrigen beruflichen Status der Eltern). Aufgrund von häufig auftretenden Alkohol- oder anderen Suchterkrankungen innerhalb der Herkunftsfamilie erleben viele Jugendliche nicht selten Gewalt oder werden Opfer von sexuellem Missbrauch (Günder, 2011).
Diese Jugendlichen, die dadurch oft jahrelang zwischen Familie, Jugendhilfe, Heimbetreuung, Straße, Psychiatrie und Gefängnis hin- und herpendeln, benötigen ein individuelles, auf sie zugeschnittenes, professionelles pädagogisches Setting (Buchkremer, Emmerich & Groneick, 2011), verbunden mit einer personell kontinuierlichen Begleitung, um ihre Persönlichkeitsentwicklung voran zu treiben (Münder, 2006). Welche Chancen die ISE für diese Jugendliche konkret bieten kann, soll im Folgenden aufgedeckt werden.
3.5. Chancen der ISE im Ausland
Neben anderen zahlreichen Autoren nennen Fischer und Ziegenspeck (2009) verschiedene Faktoren, die zum Erfolg einer ISE-Maßnahme beitragen können: Dazu zählen u.a. individuelle Betreuungsformen, die gezielt auf die Ressourcen des Jugendlichen eingehen und Möglichkeiten bieten, diese weiter zu entfalten und zu stärken. Ebenso entscheidend ist die Freiwilligkeit des Jugendlichen an der Teilnahme und seine Beteiligung am Hilfeplangespräch, die personelle Kontinuität und damit verbundene Stärken der intensiven Beziehung zwischen Jugendlichem und Betreuer sowie Individualität und flexible Anpassung. Auch die Betonung alltäglicher Strukturen und die – trotz Auslandsaufenthaltes – weiterführende Beschulung des Jugendlichen stellen große Chancen der ISE gegenüber traditionellen Formen der Erziehungshilfe dar. Auf diese Faktoren, die maßgeblich zum Erfolg einer ISE-Maßnahme beitragen, wird im Folgenden einzeln ausführlicher eingegangen. Zu Beginn soll aufgezeigt werden, warum gerade Maßnahmen im Ausland das größtmögliche Wirkungspotenzial haben können.
3.5.1. Chancen des Standorts im Ausland
Da manche Jugendliche mit langer „Jugendhilfekarriere“, wie bereits unter 3.4. beschrieben, mit Hilfe von klassischen Erziehungshilfen nur schwer erreicht werden können, erscheint es in vielen Fällen sinnvoll, sie aus den gewohnten Strukturen ihres Umfeldes herauszulösen und im Rahmen einer ISE-Maßnahme im Ausland zu betreuen.
Auslandsprojekte sollen als Alternative zu freiheitsentziehenden Maßnahmen (Strafvollzug, Psychiatrie oder geschlossene Unterbringung) zum Einsatz kommen, mit dem Ziel, eine Distanz zum Herkunftsmilieu der Jugendlichen zu schaffen, um neue Lernprozesse zu ermöglichen. In der Ferne kann auf alte Lösungsmuster nicht mehr zurück gegriffen werden und infolgedessen soll die Bereitschaft geweckt werden, Neues auszuprobieren. Die fremde Kultur, meist verbunden mit einer unbekannten Sprache, die eine zusätzliche Barriere schafft, macht es dem Jugendlichen nahezu unmöglich und vor allem unattraktiv, den Standort zu verlassen (Witte, 2009).
[...]
[1] Ein ausführlicher Reisebericht findet sich unter folgender Web-Adresse: http://www.kap-outdoor.de/1997-Agadir-Atlas-Aussenwohngruppe.519.0.html
[2] Ein beispielhafter Erfahrungsbericht findet sich unter folgender Web-Adresse: http://www.wellenbrecher.de/pdf/OnlineInfo37.pdf
[3] http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/08/index.php?norm_ID=0803500
[4] https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/ Sozialleistungen/KinderJugendhilfe/Tabellen/HilfenErziehungAusElternhaus.mhtml
[5] https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Kinder Jugendhilfe/Tabellen/HilfenErziehungAusElternhausMerkmale2011.html
[6] näheres zum Hilfeplangespräch unter http://www.sgbviii.de/S57.html
- Citation du texte
- Judith Wölfel (Auteur), 2013, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in erlebnispädagogischen Standortprojekten im Ausland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267926