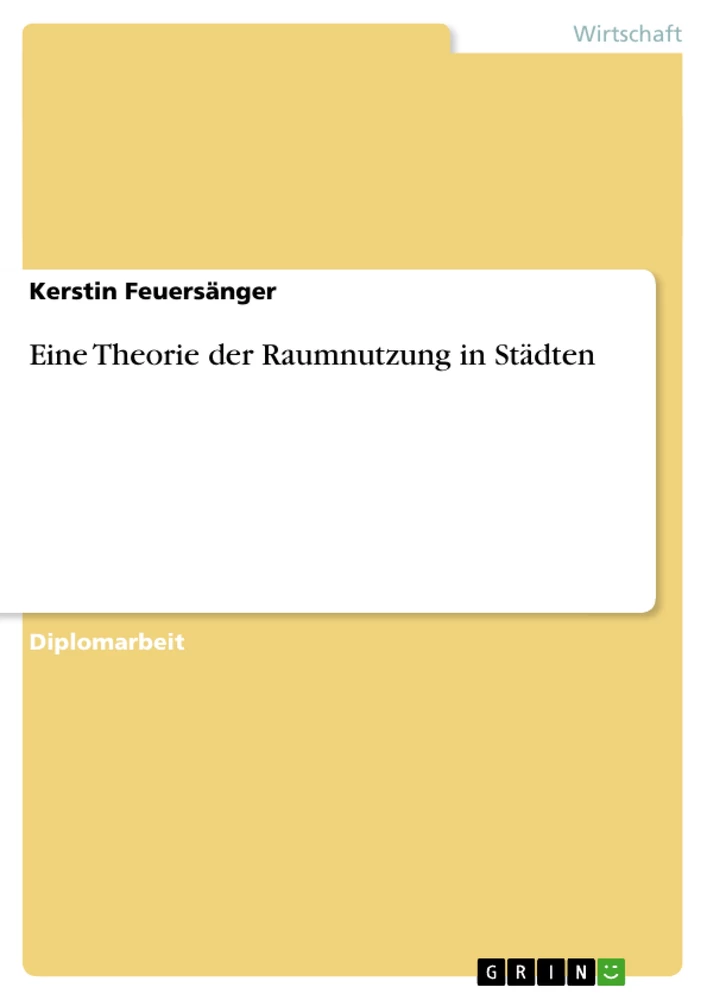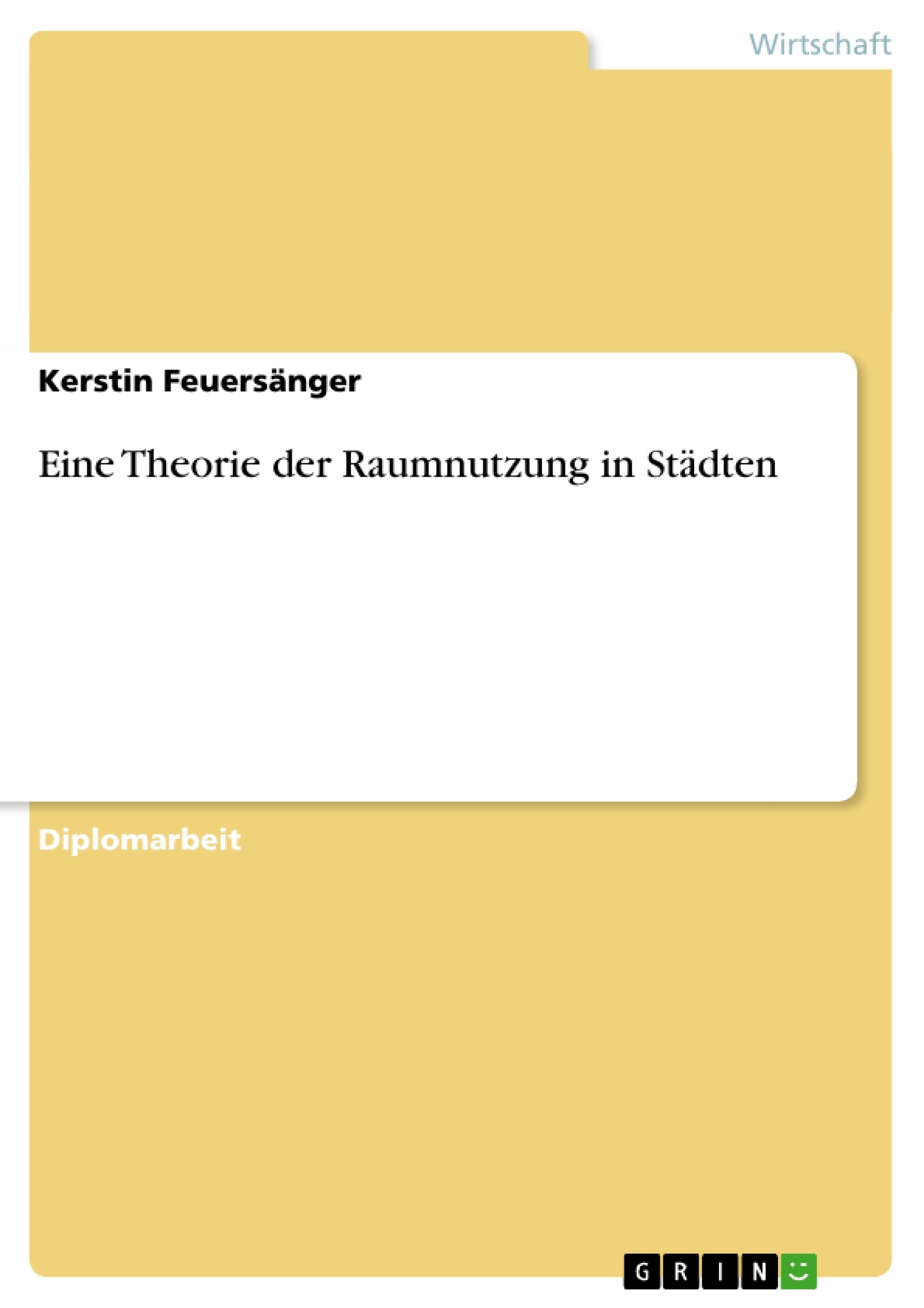Seit vielen Jahren wird versucht, die Struktur von Städten zu erklären. Doch Stadtbilder verändern
sich von Jahr zu Jahr, und lange Zeit gab es keinen Erklärungsansatz, der dem schnellen
Wachstum und der stetigen Veränderung gerecht wurde. Die monozentrische Stadt wurde
lange als das Maß aller städtischen Dinge betrachtet – was sie eine zeitlang auch war. Doch
das hat sich geändert.
Um den Aufbau einer Stadt vollständig und in all ihrer Komplexität – mit Einwohnern,
gewerblichen Aktivitäten, öffentlichen Einrichtungen, Grünflächen, Transportwegen, externen
Effekten und vielem mehr – zu verstehen, bedarf es mathematischer Modelle, die viel zu
aufwendig sind als dass sie je nützlich wären: hätte man alle Aspekte der Situation erfasst,
wäre wahrscheinlich so viel Zeit vergangen, dass der zu erklärende Zustand nicht mehr aktuell
ist.
Gut durchdachte Vereinfachungen sind vonnöten. Fragestellungen müssen zwar mathematisch
ohne zu hohen Anspruch modelliert werden können, gleichzeitig aber dennoch genügend
Aspekte der Realität wiederspiegeln um als Erklärung dieser behilflich zu sein.
In dieser Arbeit sollen drei Artikel vorgestellt werden, die sich mit der Raumaufteilung in
Städten befassen.
In Kapitel 3 geht es zunächst um eine gleichgewichtige Raumaufteilung: angenommen,
Unternehmen und Haushalte könnten über ihren Standort frei entscheiden – unter der Voraussetzung,
dass sie ihren individuellen Nutzen maximieren, wie sähe das resultierende Stadtbild
aus?
Kapitel 4 beschäftigt sich mit einer Erweiterung des in Kapitel 3 vorgestellten Modells,
um es anpassungsfähiger an die Realität zu machen.
Zuletzt wird in Kapitel 5 der Vergleich zwischen gleichgewichtiger und optimaler Raumnutzung
angestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, beide miteinander zu vereinbaren.
Die Ergebnisse der in dieser Arbeit dargestellten Untersuchungen sollen neue Erklärungsansätze
für die Form und Entstehung urbaner Lebensräume liefern. Außerdem könnten
sie dabei helfen, öffentliche Eingriffe und Maßnahmen zur Steuerung der wirtschaftlichen
Aktivitäten in Städten zielgerichtet zu konzipieren – wenn nicht als Handlungsanweisung, so
doch als Denkanstoß für Stadtplaner und solche, die es werden wollen.
Zunächst folgt eine kurze Entstehungsgeschichte von Städten, eine Erläuterung der bis
vor kurzem aktuellen Sichtweise der Raumaufteilung, und dann folgt der Übergang zu den
moderneren Modellen.
Inhaltsverzeichnis
- VERZEICHNIS DER BENUTZTEN VARIABLEN UND FUNKTIONSBEZEICHNER
- 1. Einleitung
- 2. Die Monozentrische Stadt
- 2.1 HISTORISCHE BELEGE
- 2.2 WARUM GIBT ES STÄDTE?
- 2.3 DAS MODELL
- 3. Die Theorie eines symmetrischen Gleichgewichts
- 3.1 VORHERGEHENDE BEMERKUNGEN
- 3.2 PRÄMISSEN UND DIE EIGENSCHAFTEN DER STADTFLÄCHE
- 3.3 DER PRODUKTIONSSEKTOR
- 3.4 DIE BESCHÄFTIGTEN
- 3.5 DIE LOHN-ARBITRAGE-BEDINGUNG
- 3.6 DIE ZAHLUNGSBEREITSCHAFT VON HAUSHALTEN UND UNTERNEHMEN
- 3.7 DEFINITION EINES GLEICHGEWICHTS
- 3.8 DAS DREI-SCHRITTE-PROGRAMM
- 3.9 DIE, GEMISCHTE' LOHNKURVE
- 3.10 DER GLEICHGEWICHTIGE LOHNSATZ
- 3.11 DER EXTERNE EFFEKT: DIE PRODUKTIVITÄTSFUNKTION Z
- 3.12 BEISPIELE
- 3.13 ERGEBNISSE
- 4. Eine Erweiterung der Gleichgewichtstheorie
- 4.1 DIE UNTERSCHIEDE ZU LUCAS/ROSSI-HANSBERGS MODELL
- 4.2 PRÄMISSEN
- 4.3 VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN GLEICHGEWICHT (MIT 0 < 0<1)
- 4.4 KONSTRUKTION EINES GLEICHGEWICHTS
- 4.5 EIN GLEICHGEWICHT OHNE NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
- 4.6 PRODUKTION VON MEHR ALS EINEM GUT
- 5. Zum Vergleich: optimale Raumnutzung
- 5.1 AUFBAU DES MODELLS
- 5.2 DIE VORGEHENSWEISE ZUR OPTIMIERUNG
- 5.3 MABNAHMEN ZUR EFFIZIENZERHÖHUNG
- 5.4 DER VERGLEICH
- 6. Schlussbemerkungen und Ausblick
- ANHANG
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Erklärung der Struktur von Städten und analysiert die Entstehung urbaner Lebensräume. Die Arbeit untersucht, wie sich Unternehmen und Haushalte in Städten räumlich verteilen, wenn sie unter der Annahme ihres individuellen Nutzens maximieren frei über ihren Standort entscheiden können. Es wird ein Gleichgewichtsmodell entwickelt und erweitert, um die komplexe Raumnutzung in Städten besser zu verstehen.
- Gleichgewichtige Raumnutzung in Städten
- Modellierung der räumlichen Verteilung von Unternehmen und Haushalten
- Erweiterung des Gleichgewichtsmodells zur besseren Anpassung an die Realität
- Vergleich zwischen gleichgewichtiger und optimaler Raumnutzung
- Öffentliche Eingriffe und Maßnahmen zur Steuerung der wirtschaftlichen Aktivitäten in Städten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung und beschreibt die Relevanz der Arbeit im Kontext der Erklärung von Stadtstrukturen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Modellierung der komplexen städtischen Entwicklung verbunden sind, und verdeutlicht die Notwendigkeit von vereinfachten Modellen, die dennoch relevante Aspekte der Realität widerspiegeln. Kapitel 2 führt in das Konzept der monozentrischen Stadt ein und diskutiert historische Entwicklungen sowie die traditionellen Erklärungsansätze für die räumliche Struktur von Städten.
Kapitel 3 stellt ein Modell der gleichgewichtigen Raumnutzung in Städten vor. Es untersucht die Entscheidungsprozesse von Unternehmen und Haushalten bei der Wahl ihres Standortes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Arbeitsmarktbedingungen, Transportkosten und der Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen. Dieses Kapitel analysiert die Entstehung des Gleichgewichts und dessen Auswirkungen auf die Stadtstruktur.
Kapitel 4 erweitert das in Kapitel 3 vorgestellte Modell, um die Realität besser abzubilden. Es berücksichtigt zusätzliche Faktoren, die die Entscheidungen von Unternehmen und Haushalten beeinflussen, wie z.B. externalitäten und die Entwicklung von neuen Technologien.
Kapitel 5 widmet sich dem Vergleich zwischen gleichgewichtiger und optimaler Raumnutzung. Es untersucht die Unterschiede zwischen den beiden Konzepten und diskutiert die Möglichkeit, optimale Raumnutzung durch gezielte politische Maßnahmen zu erreichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Stadtökonomie und der Raumnutzung. Wichtige Schlüsselwörter sind: städtische Strukturen, Gleichgewichtsmodelle, Raumnutzung, externe Effekte, Transportkosten, Produktivität, Nutzenmaximierung, optimale Raumnutzung, Stadtplanung und politische Interventionen. Die Arbeit basiert auf der Anwendung mathematischer Modelle und analytischer Methoden.
- Quote paper
- Kerstin Feuersänger (Author), 2003, Eine Theorie der Raumnutzung in Städten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26782