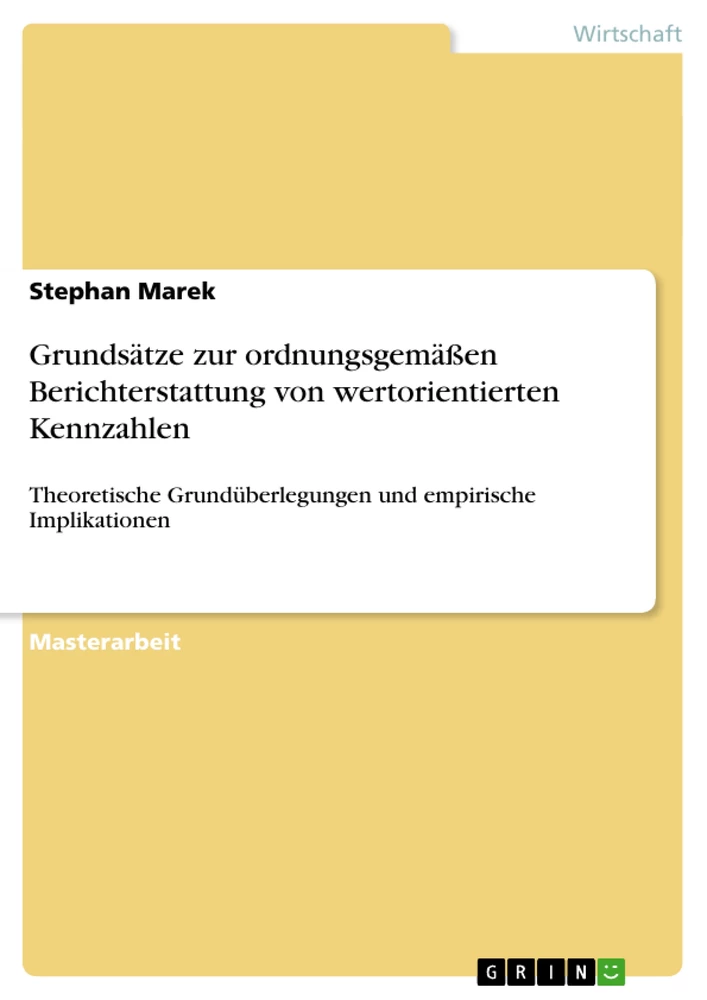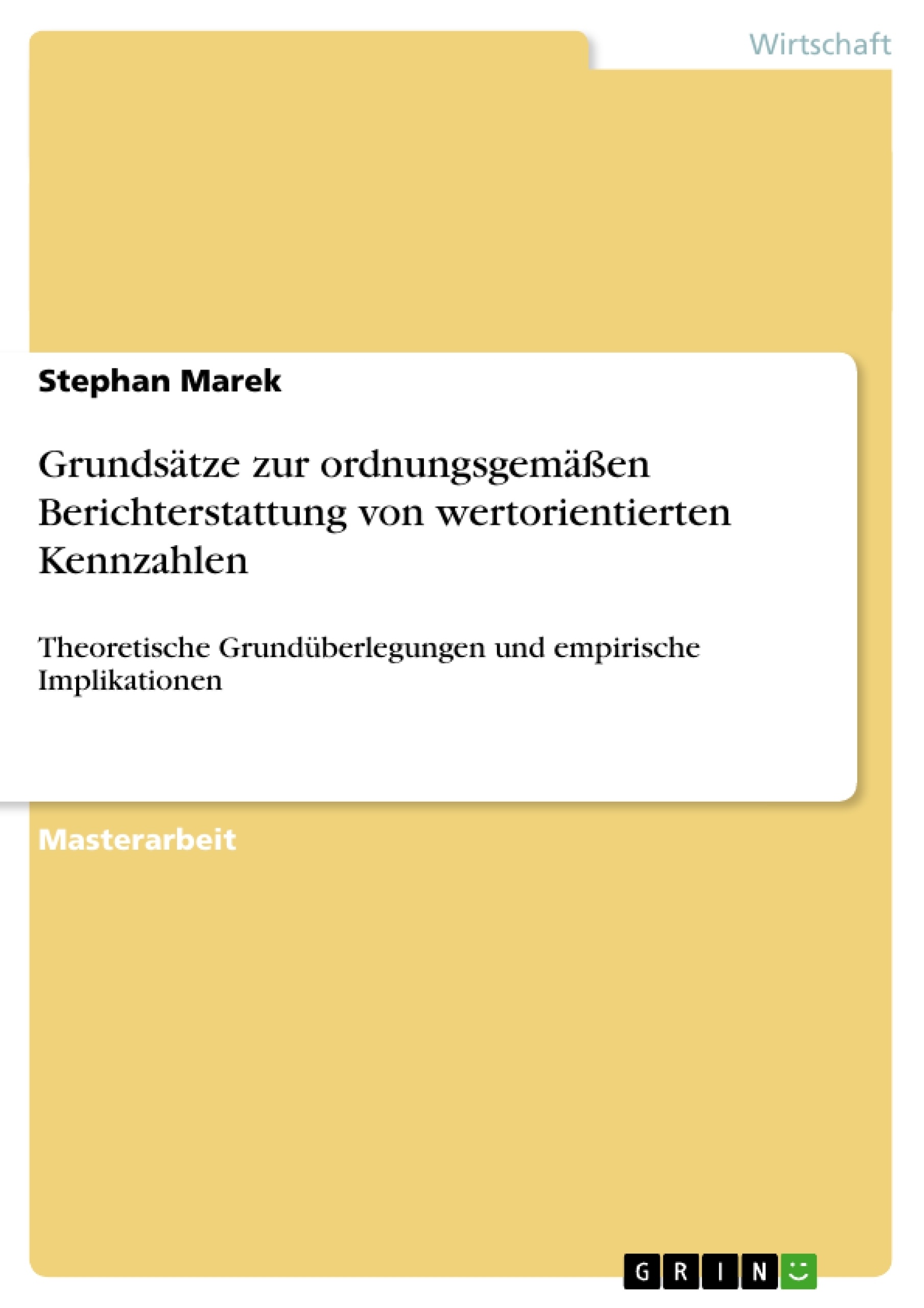Mit diesem Bewusstsein erfolgt eine entsprechende Einführung in die Thematik, in der primär die Bedeutsamkeit dieser kennzahlengestützten Informationsbereitstellung betrachtet und eine zeitliche Einordnung vorgenommen wird. Im zweiten Kapital wird die Bedeutung der Konzernlageberichterstattung für das Value Reporting fokussiert. Zu diesem Zweck werden zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen und die daraus abgeleiteten Grundsätze der Lageberichterstellung eines Konzerns erläutert. Daraus resultierend ergeben sich Konsequenzen für das Value Reporting und für die Verwendung wertorientierter Kennzahlen. Hinsichtlich der wertorientierten Berichterstattung werden nun wiederum deren Grundsätze, Funktionen, vorgeschlagene Berichtsteile innerhalb des Lageberichts und mögliche Bewertungsverfahren vorgestellt. Dabei ist zu beachten, dass sämtliche theoretischen Grundüberlegungen darauf ausgerichtet sind, die Interessen der (potentiellen) Investoren bzw. Anteilseigner zu befriedigen, wobei zweifelsfrei die Minimierung der Abweichungen zwischen Werten im Jahresabschluss und der tatsächlichen Lage des Unternehmens als zentrale Funktionen der kennzahlengstützten Informationsbereitstellung im Vordergrund steht. Dem Schließen dieser Wertlücke zwischen dem rechnerischen Unternehmenswert und dem Börsenwert und der Minderung von Informationsasymmetrien bei gleichzeitiger Verfolgung des Ziels der Maximierung des Shareholder Values soll im Folgenden Rechnung getragen werden.
Im dritten Kapitel werden die von den Unternehmen verwendeten wesentlichen Kennzahlen vorgestellt und deren theoretische Berechnung erläutert. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den einperiodischen Instrumenten des Economic Value Added (EVA), dem Cash Value Added (CVA), dem Return on Capital Employed (ROCE) und der mehrperiodischen Kennzahl des Discounted Cashflow (DCF). In diesem Zusammenhang erfolgt weiterhin eine grundlegende Unterscheidung zwischen Konzepten auf Basis von Cashflows und auf Basis von Buchwerten einschließlich der Anforderungen, Annahmen und Anpassungen, welche mit diesen Ansätzen verbunden sind.
Das vierte Kapitel bildet die Darstellung eines konzeptionellen Rahmens der wertorientierten Publizität, bestehend aus der realisierten Entwicklung des Unternehmenswertes (Value Added Reporting), der erzielten Wertschaffung aus Sicht der Kapitalgeber (Total Return Reporting) und der Entwicklung nachhaltiger Wertpotentiale (Strategic Advantage Reporting). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung dieser Arbeit
- Verlauf der Untersuchung
- Bedeutung der Lageberichterstattung für das Value Reporting
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Grundsätze der Konzernlageberichterstattung
- Konsequenzen für das Value Reporting
- Grundsätze des Value Reporting
- Begriff des Value Reporting und dessen Funktionen
- Berichtsteile im Value Reporting
- Bewertungsverfahren im Hinblick auf die Informationsbedürfnisse der Adressaten
- Konsequenzen für wertorientierte Kennzahlen
- Einperiodische Kennzahlen
- Mehrperiodische Kennzahlen
- Anpassungen der Komponenten
- Konzeptioneller Rahmen der wertorientierten Publizität
- Entwicklung des Unternehmenswertes
- Wertschaffung aus Sicht der Kapitalgeber
- Entwicklung nachhaltiger Wertsteigerungspotentiale
- Grundprobleme einer wertorientierten Performancemessung
- Problematik der durchschnittlich gewichteten Kapitalkosten (WACC)
- Problematik des operativen Ergebnisses
- Problematik des investierten Vermögens/Kapitals
- Formulieren der Hypothesen
- Empirische Implikationen
- Verfahrensweise und Zielsetzung
- Häufigkeit der Verwendung von Wertkennzahlen
- Darstellung und Berechnung der wertorientierten Kennzahlen
- Value Reporting in der Unternehmenspraxis — Darstellung anhand ausgewählter Beispiele
- Schlussbetrachtung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Value Reporting, einer Form der wertorientierten Berichterstattung, die Unternehmen gegenüber Kapitalgebern einsetzen. Ziel ist es, die Qualität der Implementierung von wertorientierten Steuerungssystemen zu beurteilen, indem untersucht wird, wie Unternehmen wertorientierte Kennzahlen zur Ermittlung ihrer Zielerreichung verwenden und inwieweit diese Anwendung vom theoretischen Soll-Zustand abweicht. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen des Value Reporting, die Grundsätze dieser Berichterstattungsform und die Funktionen, die sie im Geschäftsbericht erfüllen kann. Darüber hinaus werden die wichtigsten Kennzahlen des Value Reporting, wie Economic Value Added (EVA), Cash Value Added (CVA), Discounted Cashflow (DCF) und Return on Capital Employed (ROCE), vorgestellt und ihre Anwendung in der Praxis analysiert. Die Arbeit betrachtet auch die Problematik der wertorientierten Performancemessung und untersucht, inwieweit die Anwendung dieser Kennzahlen mit Willkür oder anderen Problemen verbunden sein kann.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Value Reporting
- Grundsätze und Funktionen des Value Reporting
- Wertorientierte Kennzahlen und ihre Berechnung
- Problematik der wertorientierten Performancemessung
- Empirische Analyse des Value Reporting in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung einer wertorientierten Unternehmensführung und die Notwendigkeit einer transparenten Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Zielerreichung gemessen wird und ob Diskrepanzen zwischen dem theoretischen Soll-Zustand des Value Reporting und dessen praktischer Umsetzung bestehen.
Kapitel 2 befasst sich mit der Bedeutung der Konzernlageberichterstattung für das Value Reporting. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Grundsätze der Konzernlageberichterstattung und deren Konsequenzen für das Value Reporting erläutert. Die Grundsätze des Value Reporting, dessen Funktionen im Geschäftsbericht und die verschiedenen Berichtsteile werden vorgestellt. Abschließend werden die beiden wesentlichen Konzepte zur Unternehmensbewertung und der inhaltliche und strukturelle Aufbau der wertorientierten Berichterstattung im Lagebericht dargestellt.
Kapitel 3 widmet sich den Konsequenzen für wertorientierte Kennzahlen. Es werden die von Unternehmen verwendeten wesentlichen Kennzahlen vorgestellt und deren theoretische Berechnung erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf den einperiodischen Konzepten des Economic Value Added (EVA), dem Cash Value Added (CVA), dem Return on Capital Employed (ROCE) und der mehrperiodischen Kennzahl des Discounted Cashflow (DCF). Es erfolgt eine grundlegende Unterscheidung zwischen Konzepten auf Basis von Cashflows und auf Basis von Buchwerten, einschließlich der Anforderungen, Annahmen und Anpassungen, welche mit diesen Ansätzen verbunden sind.
Kapitel 4 bildet die Darstellung eines konzeptionellen Rahmens der wertorientierten Publizität, bestehend aus der realisierten Entwicklung des Unternehmenswertes (Value Added Reporting), der erzielten Wertschaffung aus Sicht der Kapitalgeber (Total Return Reporting) und der Entwicklung nachhaltiger Wertpotentiale (Strategic Advantage Reporting).
Kapitel 5 legt den Fokus auf die Grundprobleme einer wertorientierten Performancemessung. Schwerpunkte werden dabei bei der Bestimmung der durchschnittlich gewichteten Kapitalkosten, des operativen Ergebnisses und des investierten Kapitals bzw. Vermögens herausgestellt.
Kapitel 6 formuliert die Hypothesen, auf deren Grundlage sich im siebten Kapitel eine empirische Analyse anschließt. Die Auswertung der empirischen Erkenntnisse stellt zugleich den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit dar. Zu diesem Zweck wird zunächst die Vorgehensweise und Zielsetzung der Analyse beschrieben. Darauf aufbauend wird untersucht, mit welcher Häufigkeit die einzelnen dargestellten Wertkennzahlen in den jeweiligen Berichterstattungen der betrachteten Unternehmen verwendet werden und in welchem Ausmaß die Unternehmen auf wertorientierte Kennzahlen zurückgreifen. Weiterhin wird analysiert, ob und mit welcher Reichweite die Berechnung der Steuerungsgrößen in den Geschäftsberichten erläutert wird. Folglich soll festgestellt werden, ob diese Konzepte dem theoretischen Soll-Zustand entsprechen oder ob sie unternehmensspezifisch erstellt wurden. Unterschiede in der Berechnung werden mithilfe von Anpassungen ermittelt, welche die Unternehmen individuell vorgenommen haben. Zuletzt werden der Umfang des Value Reporting und die Bezugnahme auf die gegenwärtige und zukünftige Geschäftsentwicklung durch das Management im Konzernlagebericht untersucht und anhand ausgewählter Beispiele verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Value Reporting, Konzernlageberichterstattung, wertorientierte Kennzahlen, Economic Value Added (EVA), Cash Value Added (CVA), Discounted Cashflow (DCF), Return on Capital Employed (ROCE), Unternehmenswert, Shareholder Value, Kapitalkosten, Kapitalgeber, Geschäftsbericht, Unternehmenssteuerung, Performancemessung, Informationsasymmetrie, Transparenz, Vergleichbarkeit, Nachprüfbarkeit, Geschäftsentwicklung, Nachhaltigkeit, Chancen, Risiken, Aktienindizes, DAX, MDAX, SDAX, empirische Analyse.
- Quote paper
- Stephan Marek (Author), 2013, Grundsätze zur ordnungsgemäßen Berichterstattung von wertorientierten Kennzahlen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267826