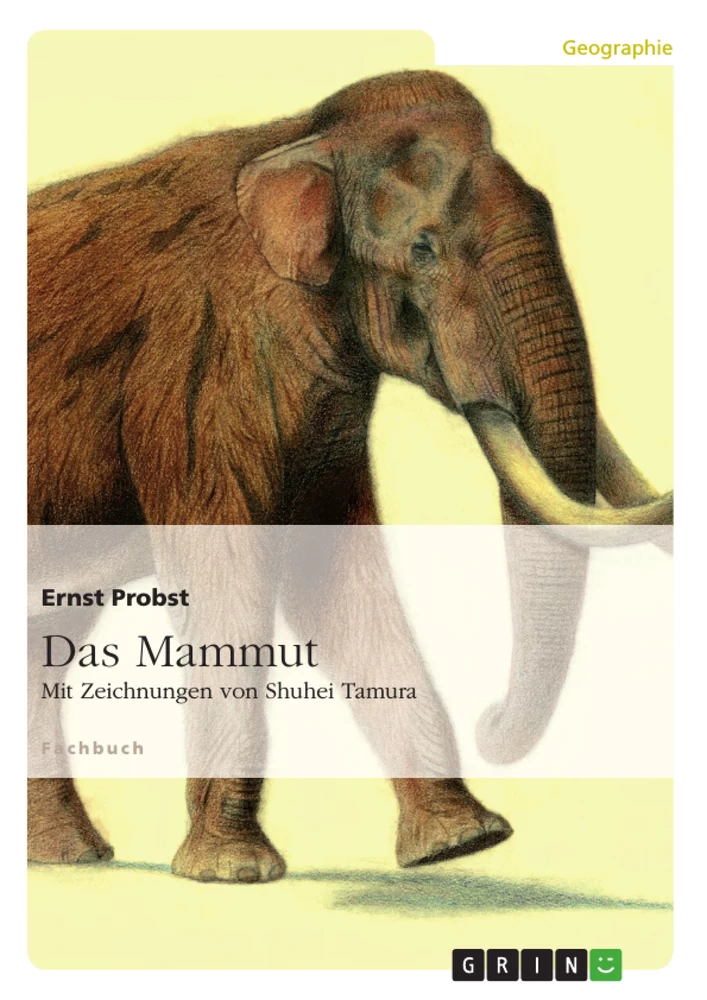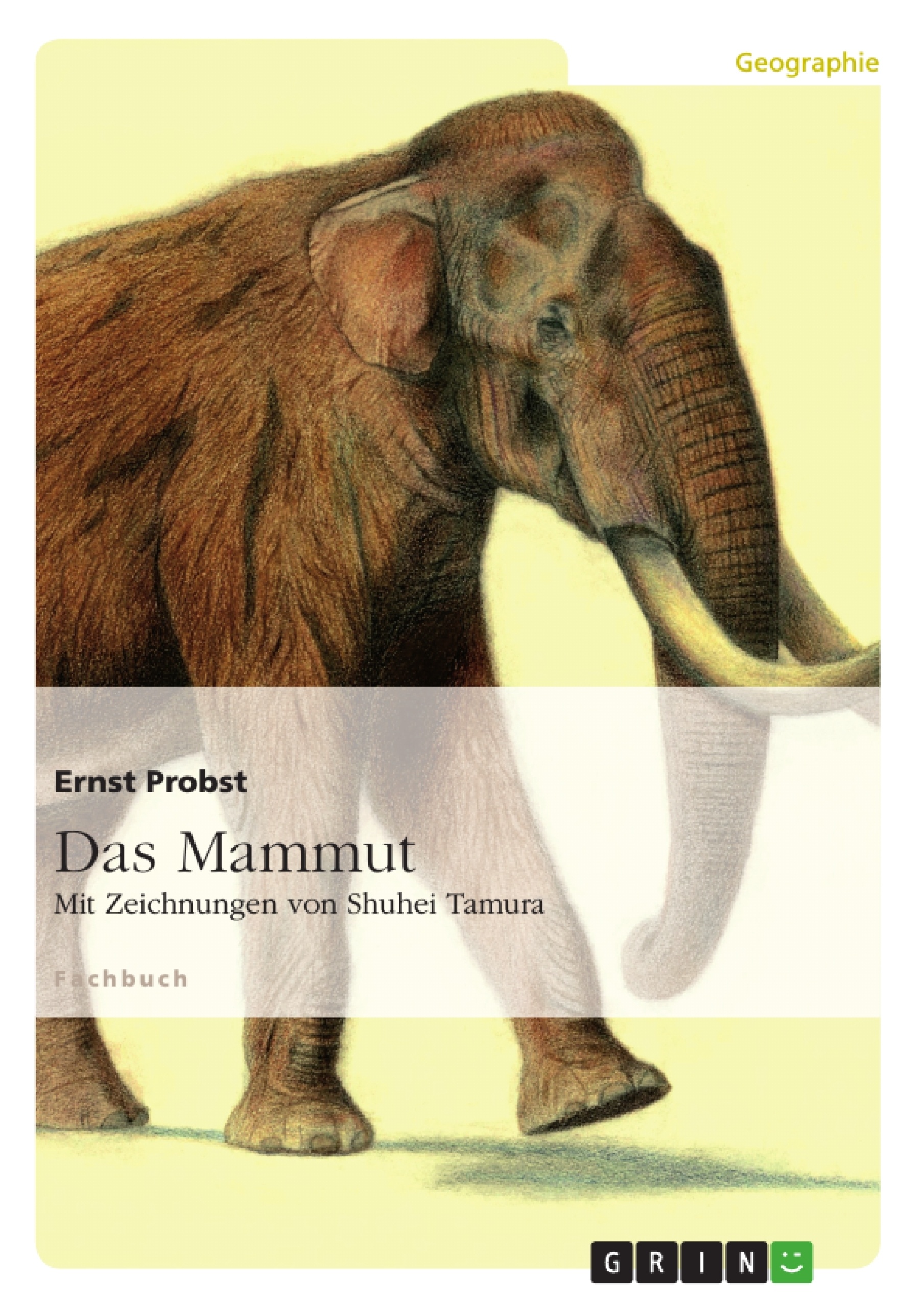Das Mammut mit dem wissenschaftlichen Artnamen Mammuthus primigenius ist das bekannteste Tier aus dem Eiszeitalter. Nach Funden zu schließen, erschienen die ersten Wollhaar-Mammute zwischen etwa 300.000 und 250.000 Jahren in Mitteleuropa. Am Ende des Eiszeitalters vor rund 10.000 Jahren starben sie in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebietes aus. Die letzten von ihnen verschwanden erst in der Nacheiszeit vor rund 4.000 oder 3.700 Jahren. Mit diesen bis zu 3,75 Meter großen sowie 5 bis maximal 8 Tonnen schweren Rüsseltieren befasst sich das Buch „Das Mammut“ des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Geschildert werden die Herkunft des Mammuts, seine Verbreitung, sein Aussehen, sein Körperbau, seine Größe, sein Gewicht, wichtige Funde, kuriose Irrtümer, seine Rolle im Leben der eiszeitlichen Jäger und Sammler sowie sein Aussterben. Es hat lange gedauert, bis die wahre Natur des Mammuts als eiszeitlicher Elefant erkannt wurde. Man schrieb seine Reste irrtümlich Fabeltieren wie Drachen, Einhörnern, Greifen, riesigen Erdratten oder Maulwürfen, Riesen, Helden und Heiligen zu. Das Buch enthält Zeichnungen des japanischen Künstlers Shuhei Tamura aus Kanagawa. Gewidmet ist es dem niederländischen Mammut-Experten Dick Mol aus Hoofddorp. Aus der Feder von Probst stammen auch die Werke „Deutschland im Eiszeitalter“, „Löwenfunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, „Der Mosbacher Löwe“, „Höhlenlöwen“, „Der Amerikanische Höhlenlöwe“ , „Der Ostsibirische Höhlenlöwe“; „Säbelzahnkatzen“, „Die Säbelzahnkatze Homotherium“, „Die Dolchzahnkatze Megantereon“, „Die Dolchzahnkatze Smilodon“, „Der Europäische Jaguar“, „Eiszeitliche Leoparden in Deutschland“, „Eiszeitliche Geparde in Deutschland“ und „Der Höhlenbär“.
Inhalt
Vorwort Das bekannteste Eiszeittier
Der „Erstgeborene Elefant“
Der Mammuth und der Elephant
Die Urheimat des Mammuts
Frühe Mammute in Afrika
Das Südmammut
Das Steppenmammut
Das Amerikanische Präriemammut
Die Steppenmammute von Mosbach und Süßenborn
Das Sungari-Mammut
Der „Steinheimer Steppenelefant“
Das Wollhaar-Mammut
Arten des Mammuts
Frühe Funde und Irrtümer
Das Schulterblatt von Pelops
Die Sage von einäugigen Riesen
Die Kniescheiben von Ajax
Mammutfunde in Wien
Die Riesen von Worms
Die Greifenklaue im Straßburger Münster
Der „Luzerner Riese“
Das „Einhorn bei Neubronn“
Riesenmenschen in England
Der Schwindel des Barbiers Mazurier
Die Riesen von Oppenheim
Der Backenzahn aus Salzgitter-Thiede
Das „Einhorn von Quedlinburg“
Der „Kremser Riese“
Der „Sizilianische Riese“
Der verkannte Londoner Elefant
Der Elefant von Solothurn
Ein Tier, das vor- und rückwärts geht
Der Waldelefant von Burgtonna
Riesiger Maulwurf
Unterirdisches Ungeheuer
Der erste Mammutforscher in Russland
Erste wissenschaftliche Artikel
Riesenknochen im Kloster von Jaroslawl
Das Einhorn aus Südbaden
Die Irrtümer von US-Präsident Jefferson
Der Zahn des heiligen Christophorus
Tiere mit vier Hörnern
Erkenntnisse von Georges Cuvier
Das Mammut von Vendenheim
Die Maus „Tienschu“
Elfenbein-Handel und -Schnitzerei
Zähne von „Eisratten“
Mammutreste auf dem Nordsee-Grund
Meerestier oder Riesenratte
Surikosar und Kwolikosar
Mammutfunde auf dem „Hundssteig“ von Krems
Der Mammut-Friedhof am Berelekh
Der Mammut-Friedhof bei Sevsk
Mammutskelette in Deutschland
Die Mammutfunde von Niederweningen
Das Muirkirk-Mammut
Der Mammut-Friedhof von Kostolac
Präriemammute in Rancho La Brea
Mammutdung in der Bechan Cave
Mammutkadaver im Dauerfrost-Boden
Das „Mammutland“ Jakutien
Der Dauerfrost-Boden
Mammutkadaver aus dem 17. Jahrhundert
Das Jerlow-Mammut
Das Alaseaj-Mammut
Das Adams-Mammut
Ein Mammutkadaver im Tschuktschen-Land
Das Schangin-Mammut
Das Tas-Mammut oder Trofimow-Mammut
Das Middendorf-Mammut
Das Indigirka-Mammut
Das Mammutbein des Erzbischofs Nil
Das Mammut am Nelgato-See
Das Mammut auf der Lena-Insel
Das Wiljui-Mammut
Das Mammut in der Awanskaja Tundra
Mammute am Alschigi-Chomos-Jurjach und Schandron
Das Mammut am Mesenkin
Das junge Mammut bei Maloje Simoweje
Mammutreste am Bor-Jurach
Das Antonow-Mammut
Das junge Mammut am Sanga-Jurjach
Das große Mammut am Purunado
Das Beresowka-Mammut
Ein Rüsselrest bei der Himmelfahrts-Bucht
Ein Mammut am Chatanga
Das Ljachowskij-Mammut
Das Mammut von Elephant Point
Das Starunia-Mammut
Das Sanga-Jurjach-Mammut oder Wollosowitsch-Mammut
Das Kutomanow-Mammut
Ein Mammutschädel mit Fleischresten an der Polarmeer-Küste
Das Wilkizki-Mammut
Ein Mammutkopf im „Natural History Museum“
Der Rüssel am Bolschaja Baranicha
Das Stschelkanow-Mammut
Das Mammut Effie
Das Taimyr-Mammut
Das Mammut vom Kap Baranow
Das Mammut am Rywejem
Das Berelekh-Mammut
Das Schandrin-Mammut
Das Mammut am Juribei
Das Chatanga-Mammut
Das Magadan-Mammut oder Mammutbaby Dima
Das Mammut von Colorado Creek
Das Mammutbaby Mascha
Das Fishhook-Mammut
Das Abyi-Mammut
Der Vorderfuß von Bolschoj Ljachowskij
Das Maksunuokha-Mammut
Das Jarkow-Mammut
Der Mammut-Experte Dick Mol
Das Jukagir-Mammut
Das Oimiakon-Mammutkalb
Das Mammutbaby Ljuba
Das Kastykhtakh-Mammut
Das Khroma-Mammut
Das Mammut Jukka
Das Mammutbaby bei Mys Kammennyi
Das Sopkarga-Mammut Zhenya
Das Ljachow-Mammut
Woher das Wollhaar-Mammut kam
Zwergmammute auf Inseln
Das Kreta-Zwergmammut
Das Sardinien-Zwergmammut
Das Kanalinseln-Zwergmammut
Wie ein Mammut aussah
Größe
Falsche Begriffe
Das Gewicht
Der Schädel
Die Ohren
Der Rüssel
Die Stoßzähne
Die Zähne
Das Skelett
Die Beine und Füße
Der Penis
Der Schwanz
Die Haut und das Fell
So lebte das Mammut
Das Höchstalter
Das Sozialverhalten
Feinde und Gefahren
Körpertemperatur
Krankheiten
Tod
Was das Mammut fraß
Die Mammutsteppe
Grasfresser
Magen- und Darminhalt
Nahrungsbedarf
Trinkwasserbedarf
Nahrungs- und Rohstofflieferant
Die Wurfspeere von Schöningen
Der Waldelefant von Lehringen
Mammutjäger in der Höhle Kiik-Koba
Ein Faustkeil aus Mammutknochen
Die Mammute von Königsaue
Der Schlachtplatz von Salzgitter-Lebenstedt
Speerspitzen aus Mammut-Elfenbein
Die Funde aus der Vogelherd-Höhle
Elfenbein-Schnitzer in der Geißenklösterle-Höhle
Mammut-Stoßzähne am Cannstatter Seelberg
Mammutjäger im Pavlovien
Wildwechsel auf dem „Hundssteig“ von Krems
1000 Mammute in Predmosti
Werkzeuge aus Elfenbein
„Schwirrholz“ aus Elfenbein
Armringe aus Elfenbein
Eine neue Erfindung: die Speerschleuder
Speerschleudern aus dem Kesslerloch
Angelhaken aus Elfenbein
Der Lagerplatz von Gönnersdorf
Mammutknochen-Hütten in der Ukraine
Das Mammut in der Kunst
Mammutmotive in der Grotte Chauvet
Frühe Kunstwerke aus Mammut-Elfenbein
Der Löwenmensch im Hohlenstein-Stadel
Venusfiguren aus Willendorf in der Wachau
Mammutfiguren aus Ton
Mammutschädel als Trommel
Landkarte auf Mammut-Elfenbein
Mammut-Schulterblätter als Grabplatten
Schmuckstücke aus Elfenbein
Perlen aus Elfenbein in Sungir
Speere aus Elfenbein
Versöhnungszeremonien für erlegte Mammute
Mammut-Heiligtümer aus dem Magdalenien
Mammutbilder in der Kapowa-Höhle
Mammutmotive auf Schieferplatten in Gönnersdorf
Opfer für die „Mutter der Tiere“
Mammutgravierung aus Florida
Warum das Mammut ausstarb
Letzte Mammute auf der Wrangel-Insel
Die Sintflut-Theorie
Die Theorie von Peter Simon Pallas
Die Theorie von Georges-Louis Leclerc de Buffon
Historische Erklärungen
Die Katastrophen-Theorie
Der Brocchismus
Vitalistische und mechanistische Theorien
Die Ausrottungs-Theorie
Die Klima-Theorie
Die Impakt-Theorie
Letzte lebende Mammute?
Wiedergeburt des Mammuts?
Zeitgenossen der Mammute
Das Amerikanische Mastodon
Das Stegomastodon
Der Celebes-Zwergelefant
Cuvieronius
Der Europäische Waldelefant
Der Sizilianische Zwergelefant
Der Zypern-Zwergelefant
Der Tylos-Zwergelefant
Die Radiokarbon-Datierung
African Elephant Years
DNS-Untersuchungen
Literatur
Bildquellen
Register
Der Autor
Bücher von Ernst Probst
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lebensbild eines Wollhaar-Mammuts
eines unbekannten Künstlers aus dem Jahre 1872
Vorwort Das bekannteste Eiszeittier
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Mammut mit dem wissenschaftlichen Artnamen Mammuthus primigenius ist das bekannteste Tier aus dem Eiszeitalter. Nach Funden zu schließen, erschienen die ersten Wollhaar-Mammute zwischen etwa 300.000 und 250.000 Jahren in Mitteleuropa. Am Ende des Eiszeitalters vor rund 10.000 Jahren starben sie in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebietes aus. Die letzten von ihnen verschwanden erst in der Nacheiszeit vor rund 4.000 oder 3.700 Jahren. Mit diesen bis zu 3,75 Meter großen sowie 5 bis maximal 8 Tonnen schweren Rüsseltieren befasst sich das Buch „Das Mammut“ des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Geschildert werden die Herkunft des Mammuts, seine Verbreitung, sein Aussehen, sein Körperbau, seine Größe, sein Gewicht, wichtige Funde, kuriose Irrtümer, seine Rolle im Leben der eiszeitlichen Jäger und Sammler sowie sein Aussterben. Es hat lange gedauert, bis die wahre Natur des Mammuts als eiszeitlicher Elefant erkannt wurde. Man schrieb seine Reste irrtümlich Fabeltieren wie Drachen, Einhörnern, Greifen, riesigen Erdratten oder Maulwürfen, Riesen, Helden und Heiligen zu. Das Buch enthält Zeichnungen des japanischen Künstlers Shuhei Tamura. Gewidmet ist es dem niederländischen Mammut-Experten Dick Mol. Aus der Feder von Probst stammen auch die Werke „Deutschland im Eiszeitalter“, „Löwenfunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, „Der Mosbacher Löwe“, „Höhlenlöwen“, „Der Amerikanische Höhlenlöwe“ , „Der Ostsibirische Höhlenlöwe“; „Säbelzahnkatzen“, „Die Säbelzahnkatze Homotherium“, „Die Dolchzahnkatze Megantereon“, „Die Dolchzahnkatze Smilodon“, „Der Europäische Jaguar“, „Eiszeitliche Leoparden in Deutschland“, „Eiszeitliche Geparde in Deutschland“ und „Der Höhlenbär“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anatom, Zoologe und Anthropologe Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840)
Der „Erstgeborene Elefant“
Wenn man hierzulande vom Mammut spricht, meint man das während der letzten Eiszeit des Eiszeitalters (Pleistozän) in Europa und Nordasien vorkommende Wollhaar-Mammut (Mammuthus primigenius), auch Wollmammut oder Fellmammut genannt. Jene Tierart wurde 1799 von dem deutschen Anatom, Zoologen und Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) aus Göttingen in der 6. Ausgabe des „Handbuch für Naturgeschichte“ erstmals wissenschaftlich beschrieben. Dabei hatten ihm fossile Funde aus Sibirien und Osterode am Harz vorgelegen, denen er den Artnamen Elephas primigenius („Erstgeborener Elefant“) gab. Er ahnte nicht, dass es sich in Wirklichkeit um einen späten Abkömmling der Rüsseltiere handelte.
Außer dem Wollhaar-Mammut beschrieb Blumenbach als Erster 1797 den heutigen „Afrikanischen Elefanten“ (Loxodonta africana) und 1799 das ausgestorbene Wollnashorn (Coelodonta antiquitatis), das auch Fellnashorn heißt. Einige Monate nach der Erstbeschreibung des Mammuts durch Blumenbach schlug 1799 der Pariser Paläontologe Georges Cuvier (1769-1832) den Artnamen Elephas mammonteus vor, der sich aber nicht durchsetzte.
Blumenbach kam am 11. Mai 1752 als Sohn des Gymnasialprofessors Heinrich Blumenbach (1707-1787) und dessen Ehefrau Charlotte Eleonore Hedwig Buddeus (1727-1794), einer Tochter des gothaischen Vizekanzlers Karl Franz Buddeus (1695-1753), in Gotha zur Welt. 1775 promovierte er mit der Arbeit „De generis humani varietate nativa“ (deutsch: „Über die natürlichen Verschiedenheiten im Menschengeschlecht“). Ab 1776 war er außerordentlicher Professor der Medizin in Göttingen, seit 1778 ordentlicher Professor und Unter-Aufseher (später Ober-Aufseher) des „Königlich Academischen Museums“ in Göttingen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Afrikanischer Elefant“ (Loxodonta africana) in Tansania
Günstig für die Forschungen von Blumenbach über Elefanten wirkte sich aus, dass bei seinem Amtsantritt in Göttingen bereits reichlich Sammlungsmaterial vorhanden war. Weitere Mammutreste konnte er dank eigener Aufsammlungen und durch sein großes wissenschaftliches Netzwerk zusammentragen. Zur Göttinger Sammlung gehörten Mammutknochen des bekannten „Riesen von Reiden“ aus der Schweiz von 1577 sowie ein Mammut-Milchbackenzahn von Quedlinburg in Sachsen-Anhalt von 1663, der zu den Resten zählte, aus denen das berühmte „Einhorn von Quedlinburg“ rekonstruiert wurde. Außerdem befanden sich in dieser Sammlung ein Mammutzahn aus Thiede bei Salzgitter und Mammutreste aus Sibirien. Der Zahn von Thiede hatte zum Naturalienkabinett des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) gehört und war 1777 durch eine Sammlungsübernahme aus der „Königlichen Bibliothek“ in Hannover in die Göttinger Sammlung gelangt. Die Mammutreste aus Sibirien waren ein Geschenk des russischen Barons Georg Thomas von Asch (1729-1807). Darunter befand sich ein Backenzahn, den Blumenbach 1797 fälschlicherweise einem „Asiatischen Elefanten“ zuordnete. Asch war Generalstabsarzt der russischen Armee und ab 1777 Staatsraat unter Zarin Katharina II. die Große (1729-1796). Aus Dank für seine von 1748 bis 1750 in Göttingen absolvierte medizinische Ausbildung unter Albrecht von Haller (1708-1777) schenkte er mehr als 30 Jahre lang der „Universität Göttingen“ zahlreiche Materialien zur Geschichte, Geologie und Kultur aus Russland.
Anfang des 19. Jahrhunderts galt Blumenbach bereits als einer der führenden Elefanten-Experten in Europa. Nachdem man 1799 im Lena-Delta in Sibirien das „Adams-Mammut“ (auch „Lena-Mammut“ genannt) entdeckt und 1806 geborgen hatte, schickte man Blumenbach eine der ersten Rekonstruktionszeichnungen dieses Tieres sowie Proben von Haut und Haaren für seine Sammlung. Weitere Reste fossiler Elefanten bekam er von zahlreichen anderen Fundstellen, vor allem aus Deutschland.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Russischer Arzt und Politiker,
Baron Georg Thomas von Asch (1729-1807),
Porträt des russischen Malers
Kirill Golowatschewski (1735-1823) von 1780.
Zusätzliches Material des Wollhaar-Mammuts erhielt Blumenbach, nachdem man im Frühjahr 1808 zwischen Osterode und Dorste am Harz zahlreiche Knochen eiszeitlicher Säugetiere entdeckt hatte. Darunter waren auch Fossilien vom Wollnashorn (Coelodonta antiquitatis) und von der Höhlenhyäne (Crocuta crocuta spelaea). Über die Funde zwischen Osterode und Dorste am Harz informierte Blumenbach im November 1808 brieflich Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
Blumenbach gilt als wesentlicher Begründer der Zoologie und der Anthropologie als wissenschaftliche Disziplinen. 1835 trat er in den Ruhestand. Am 21. Januar 1840 starb er im Alter von 87 Jahren in Göttingen und wurde auf dem „Alten Friedhof“ begraben.
Noch zu Lebzeiten von Blumenbach hat 1828 der englische Biologe und Anatom Joshua Brookes (1761-1833) in seinem Werk „A catalogue of the anatomical & zoological museum of Joshua Brookes“ den heute für das Wollhaar-Mammut gebräuchlichen Gattungsnamen Mammuthus eingeführt. Brookes lehrte Anatomie, Physiologie und Chirurgie in London und bildete innerhalb von 40 Jahren etwa 7.000 Studenten aus. Außer Humanmedizin interessierte er sich auch für die Naturgeschichte und die Anatomie der Tiere. In seinem Haus in Blenheim Street errichtete er das „Brookesian Museum“, dessen Sammlung später unter den Hammer eines Auktionators kam. Gute Beziehungen pflegte Brookes zu Edward Cross, dem Inhaber einer Londoner Menagerie in dem vierstöckigen Haus „Exeter Change“. Dies führte dazu, dass Brookes 1826 an der Obduktion des Elefanten „Chunee“ beteiligt war. Jener männliche „Indische Elefant“ trat zunächst auf der Bühne auf und wurde später im 1. Stock des „Exeter Change“ zu einer Zooattraktion. Man erschoss ihn in seinem Käfig, als er nicht mehr zu kontrollieren war.
Als Johann Friedrich Blumenbach 1799 erstmals das Wollhaar- Mammut wissenschaftlich beschrieb, existierten die „Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur“ („ICZN“) noch nicht. Deswegen hat er keinen der ihm vorliegenden Mammutreste als namentragenden Holotypus bestimmt und abgebildet. Unter einem Holotypus versteht man das Exemplar, das vom ursprünglichen Autor in der ursprünglichen Veröffentlichung zum namentragenden Typus einer Art bestimmt worden ist. 1942 wurden in der großen Monographie über Proboscidea (Rüsseltiere) des amerikanischen Wirbeltier-Paläontologen Henry Fairfield Osborn (1857-1935), die erst nach seinem Tod erschien, zwei Backenzähne aus Deutschland und Sibirien als Lectotpyen für die Art Mammuthus primigenius bestimmt und abgebildet. Ein Lectotypus wird nachträglich als namentragender Typus ausgewählt. Bei den von Osborn bestimmten Lectotypen für das Wollhaar-Mammut handelte es sich um einen im Frühjahr 1808 zwischen Osterode und Dorste am Harz geborgenen linken oberen Backenzahn und um einen Backenzahn aus Sibirien. Von diesen Originalfunden hatte Osborn naturgetreue Gipskopien erhalten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Englischer Biologe und Anatom Joshua Brookes (1761–1833),Gemälde von Thomas Phillips (1770–1845) aus dem Jahre 1821,
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erschießung des Elefanten „Chunee“ 1826in einer Londoner Menagerie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Amerikanischer Wirbeltier-PaläontologeHenry Fairfield Osborn (1857–1935)
In den 1980-er Jahren waren die beiden Originalfunde, die als Lectotypen für das Wollhaar-Mammut galten, nicht mehr auffindbar. Man glaubte, sie seien während des „Zweiten Weltkrieges“ (19391945) verloren gegangen oder zerstört worden. Deswegen haben 1990 der russische Paläontologe Vadim Evgenievic Garutt (1917-2002) und andere Autoren das im Herbst 1948 auf der Halbinsel Taimyr in Sibrien entdeckte „Taimyr-Mammut“ als namentragenden Neotypus vorgeschlagen. Ein Neotypus wird nach Verlust des Holotypus oder Lectotypus in einer späteren Veröffentlichung als dessen Ersatz bestimmt.
Im Herbst 2005 hat man bei der Aufarbeitung der Göttinger Sammlungsbestände zahlreiche unettikettierte Mammutfossilien entdeckt. Darunter befand sich der verschollene Backenzahn, der im Frühjahr 1808 zwischen Osterode und Dorste am Harz geborgen und 1942 von Henry Fairfield Osborn gezeichnet worden war. Eine Radiokarbon-Datierung für dieses Fossil an der „Universität Groningen“ ergab ein geologisches Alter von 34.340 Jahren.
In Sibirien heimische Völker haben dem Mammut unterschiedliche Namen gegeben. Die Ewenken (Tungusen) sagen „cheli“, die Tschuktschen „kamagrita“, die „Mansen“ (Wogulen) „wetkes“, die Ostjaken (Chentych) „wesj“, die Jakuten „uuklyla“ und die Nenzen „jachora“ (ja = Erde, chora = Tier, also „Erdtier“).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Amsterdamer Bürgermeister und Regent Nicolaas Witsen
(1641-1717),
Porträt von Peter Schenk der Ältere (1660-1711)
Die Herkunft der Begriffe Mammut, Mamantu oder Maimanto ist noch nicht abschließend geklärt. Vielfach vermutet man einen Ursprung im nenzischen oder estnischen Sprachraum. Der estnische Begriff „maa“ beispielsweise bedeutet zu deutsch „Erde“ und das Wort „mutt“ zu deutsch „Maulwurf“. Wenn dies zuträfe, könnte man Mammute als riesige „Erdmaulwürfe“ fehlgedeutet haben. Allerdings wird gelegentlich auch eine Verbindung zum arabischen Ausdruck „Behemot“ für ein gewaltiges Ungeheuer mit gekrümmten Hörnern und Stoßzähnen in Erwägung gezogen und mit dem seit dem 9. Jahrhundert nachgewiesenen Handel von sibirischem Elfenbein durch Araber erklärt.
Den Begriff Mammut kennt man seit dem 17. Jahrhundert in Europa. Dieser Name wurde hier vermutlich durch den Amsterdamer Bürgermeister und Regenten Nicolaas Witsen (1641-1717) eingeführt, der 1666 mit einer niederländischen Gesandtschaft nach Moskau gekommen war. Er veröffentlichte 1692 einen Bericht mit dem Titel „Noord een Oost Tartarije“ über seine Reise nach Nord-Sibirien und erwähnte bereits in der ersten Auflage das „Mammout“ oder „Mammut“.
Vom „Mammotovoi kost“ sprach 1696 der deutsche Gelehrte und Diplomat Heinrich Wilhelm Ludolf (1655-1712) in seinem Werk „Grammatica Russica“ (1696) in lateinischer Sprache. Diesen Begriff verwendete er auch in der deutschsprachigen Ausgabe mit dem Titel „Curieuse Beschreibung der natürlichen Dinge Russlands“ (1698). Darin liest man: „Gar curieuse aber ist das Mammotovoi kost, welches man in Siberien aus der Erden gräbet“. Ludolf hatte von 1692 bis 1694 eine Reise in Russland mit einem Geheimauftrag unternommen. Oft wird er fälschlicherweise als „Russe Ludloff“ bezeichnet.
Ein früher Bericht über sibirische Mammutfunde ist in der ab 1704 in verschiedenen Sprachen veröffentlichten Reisebeschreibung des dänischen Diplomaten Eberhard Isbrand Ides (1657-1708), nach anderer Schreibweise auch Evert Ysbrants Ides, enthalten. Dieser hatte als Gesandter des russischen Zaren Peter I. der Große (1672-1725) vom 14. März 1692 bis zum 1. Januar 1695 eine Reise von Moskau durch Sibirien an den chinesischen Kaiserhof in Peking und wieder zurück unternommen. Einer der Begleiter von Ides war der deutsche Kaufmann und Forschungsreisende Adam Brand (vor 1692-1746). Dessen „Beschreibung der Chinesischen Reise“ erschien 1697 zuerst in Frankfurt am Main, erlebte mehrere Auflagen und wurde ins Niederländische, Französische und Englische übersetzt. 1704 folgte die erste Ausgabe der Reisebeschreibung von Ides in Amsterdam in niederländischer Sprache mit dem Titel „Driejaarige Reize naar China te Lande gedaan door den Moskowischen Afgezant E. Ysbrants Ides von Moskou af over Groot Ustiga, Siriana, Permia, Sibirien, Daour, Groot Tartaryen tot in China.“ Die erste deutsche Ausgabe kam 1707 in Frankfurt am Main heraus und war dem russischen Zaren gewidmet. Im 6. Kapitel erwähnte Ides im Eis steckende und durch die Kälte erhaltene „Mammuths“. Der in seinem Reisetagebuch verwen dete Name „Mammuth“ bürgerte sich bald in der wissenschaftlichen Literatur ein. In Russland ist heute vom „Mamont“, in englischsprachigen Ländern vom „Mammoth“, in Frankreich vom „Mammouth“ und in Deutschland vom „Mammut“ die Rede.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Titel der Reisebeschreibung des dänischen Diplomaten EberhardIsbrandIdes (1657-1708)
In der zoologischen Systematik gehört das Wollhaar-Mammut zur Unterklasse der Höheren Säugetiere (Eutheria), zur Überordnung der Afrotheria, zur Ordnung der Rüsseltiere (Proboscidea), zur Familie der Eigentlichen Elefanten (Elephantidae), zur Gattung Mammuts (Mammuthus) und zur Art Wollhaar-Mammut (Mammuthus primigenius). Da alle Pflanzen und Tiere einen wissenschaftlichen lateinischen Namen haben, der die Gattung großgeschrieben und die Art kleingeschrieben bezeichnet, sowie den Namen des Erstbeschreibers und das Jahr der Erstbeschreibung erwähnt, heißt das Wollhaar- Mammut in der Fachliteratur korrekt „Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799)“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Größenvergleich zwischen einem Steppenmammut (Mammuthus trogontherii) und einem Menschen, Zeichnung des russischen Künstlers Dmitry Bogdanov und des Users „Kurzon“ bei „ Wikipedia “
Angeblich ist das Mammut das erste ausgestorbene Tier, das einen wissenschaftlichen Namen und eine wissenschaftliche Beschreibung in lateinischer Sprache erhielt. Der Elsässer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer Gottlieb Conrad Pfeffel (1736-1809), der viele Fabeln über Tiere schrieb, widmete diesem Eiszeittier 1806 das Gedicht „Der Mammuth und der Elephant“.
Im ukrainischen Dorf Kuleschowka (Kuleshovke) im Bezirk Sumy ehrte man das Mammut 1841 mit einem 3 Meter hohen Denkmal. Auf einer Seite jenes Denkmals ist zu lesen: „An dieser Stelle wurde 1839 das Skelett eines vorsintflutlichen Mammuts Elephas mammonteus entdeckt.“ Die erwähnte Ausgrabung stand unter der Leitung des Professors I. O. Kalinitschenko an der „Universität Charkow“. Das Denkmal wurde auf Anregung des Ausgräbers und des Grafen Golovkinyo, auf dessen Grundstück die Mammutreste entdeckt worden waren, errichtet.
Der Begriff Mammut wird heute in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien oft fälschlicherweise für etwas besonders Großes oder kaum zu Bewältigendes verwendet. So spricht man beispielsweise von einer Mammutaufgabe oder von einem Mammutprojekt, obwohl es merklich größere Rüsseltiere als das bis zu 3,75 Meter hohe Wollhaar-Mammut gab. Letzteres wurde beispielsweise vom Steppenmammut (Mammuthus trogontherii) merklich übertroffen. Ein weibliches Tier dieser Art erreichte eine Schulterhöhe von 4,70 Meter. Männliche Tiere könnten noch imposanter gewesen sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Elsässer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer
Gottlieb ConradPfeffel (1736-1809),
Porträt von Georg Friedrich Adolph Schöner (1774-1841)
[...]
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2014, Das Mammut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267615