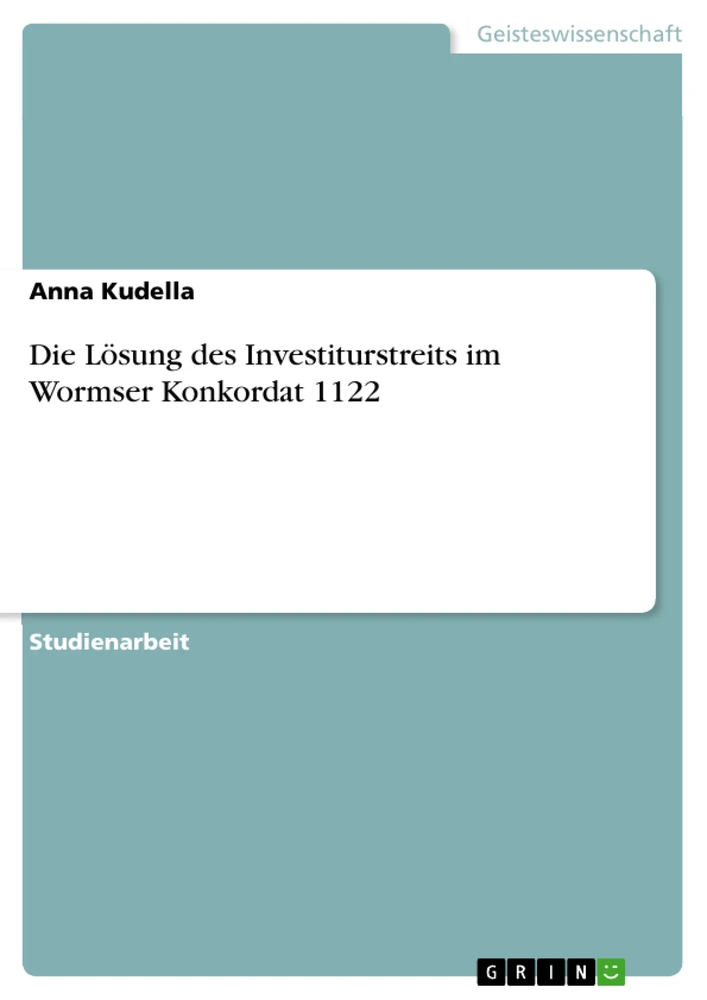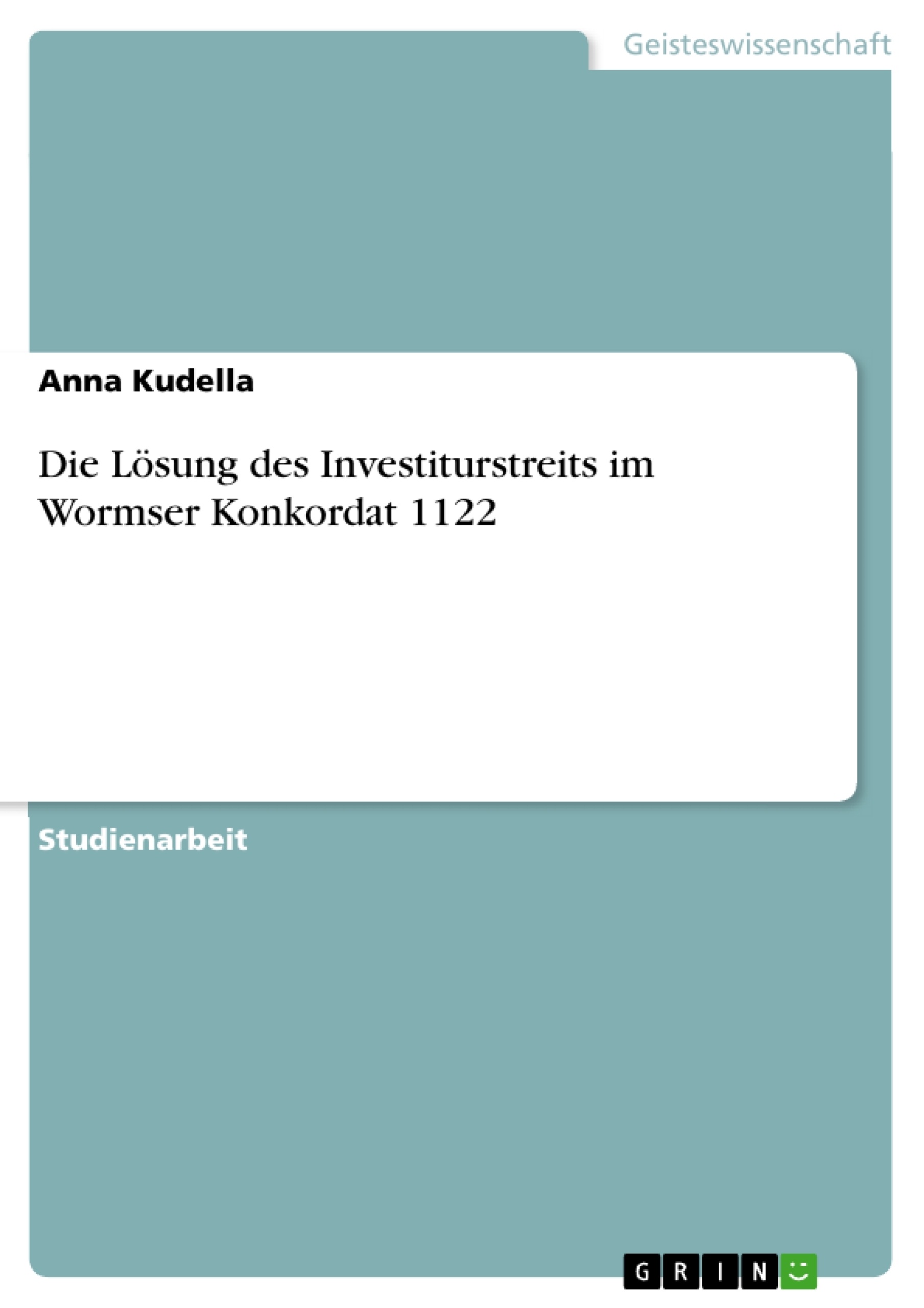Die Wurzeln der Entstehung unserer Katholischen Kirche reichen tief in die Geschichte hinein und um das zu werden, was diese Kirche heute bedeutet, darstellt und repräsentiert, musste sie einen langen Weg voller Höhen und Tiefen durchlaufen. Ein Problem, das sie zu bewältigen hatte, war der Investiturstreit im Hochmittelalter und dessen Lösung mit einem ganz bestimmten Konkordat – dem Wormser Konkordat.
Die Frage um die Investitur, also das Einweisen einer Person in ein kirchliches Amt mit den dazugehörigen Symbolen, stand im Mittelpunkt und kennzeichnete im 11. und 12. Jahrhundert eine langwierige Streitphase. Der Hauptgrund hierbei war das Einmischen der weltlichen Mächte in geistliche Belange.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Derzeitiger Forschungsstand
- 3. Quellenkritik
- 3.1 Äußere und formale Kritik
- 3.1.1 Quellentyp
- 3.1.2 Herkunft
- 3.1.3 Überlieferung und Echtheitskritik
- 3.2 Innere Quellenkritik
- 3.2.1 Wahrheitsgehalt und Glaubwürdigkeit
- 3.2.2 Tendenzen der Verfasser
- 3.1 Äußere und formale Kritik
- 4. Quelleninterpretation
- 4.1 Der Inhalt der Urkunden
- 4.2 Interpretation
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Wormser Konkordat von 1122 als Quelle und untersucht dessen Bedeutung für die Lösung des Investiturstreits. Sie analysiert die Urkunden des Konkordats unter Berücksichtigung der historischen und politischen Bedingungen und hinterfragt dessen tatsächliche Wirksamkeit.
- Das Wormser Konkordat als historisches Dokument
- Der Investiturstreit und seine Ursachen
- Die Analyse der Urkunden des Konkordats
- Das Verhältnis von weltlicher und geistlicher Macht im Hochmittelalter
- Die Auswirkungen des Wormser Konkordats auf die Entwicklung der Kirche und des Reiches
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung bietet eine Einführung in den Investiturstreit und den historischen Hintergrund des Wormser Konkordats. Sie stellt die Problematik der Investitur und die Rolle des Papstes Gregor VII. dar. Außerdem werden die wichtigsten Akteure des Streits wie Heinrich IV. und Heinrich V. vorgestellt.
2. Derzeitiger Forschungsstand
In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema Investiturstreit und Wormser Konkordat zusammengefasst. Es werden verschiedene Ansätze und Interpretationen des Konkordats diskutiert. Darüber hinaus werden wichtige Quellenmaterialien wie das "Dictatus Papae" von Gregor VII. erwähnt.
3. Quellenkritik
Das Kapitel widmet sich der kritischen Analyse des Wormser Konkordats als Quelle. Es werden die äußere und formale Kritik sowie die innere Quellenkritik behandelt. Die Urkunden werden in ihren historischen Kontext eingeordnet und die Überlieferung des Konkordats wird untersucht.
4. Quelleninterpretation
In diesem Kapitel erfolgt die inhaltliche Interpretation der Urkunden des Wormser Konkordats. Es werden die wichtigsten Punkte des Vertrags festgehalten und deren Bedeutung für das Verhältnis zwischen Kirche und Reich analysiert.
5. Fazit
(Inhalt des Kapitels "5. Fazit" wird aus Spoilergründen nicht angezeigt.)
Schlüsselwörter
Investiturstreit, Wormser Konkordat, Papst Gregor VII., Heinrich IV., Heinrich V., Calixtus II., Dictatus Papae, Staatskirchenvertrag, Urkunden, Quellenkritik, Quelleninterpretation, mittelalterliche Vertragstechnik, weltliche Macht, geistliche Macht, Kirchenherrschaft.
- Quote paper
- Anna Kudella (Author), 2011, Die Lösung des Investiturstreits im Wormser Konkordat 1122, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267357