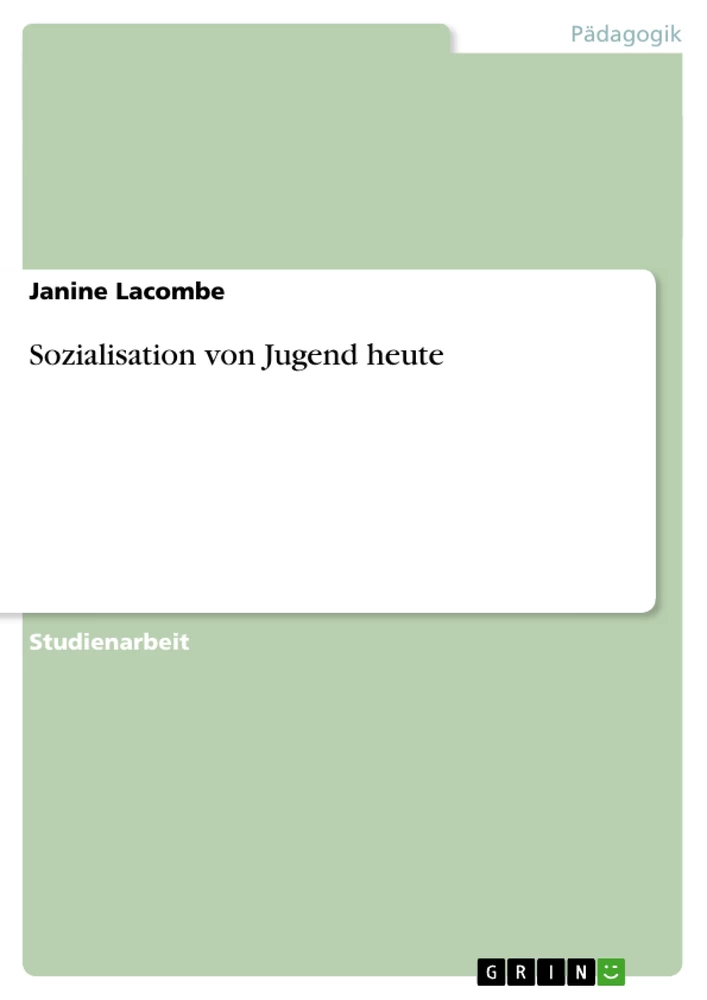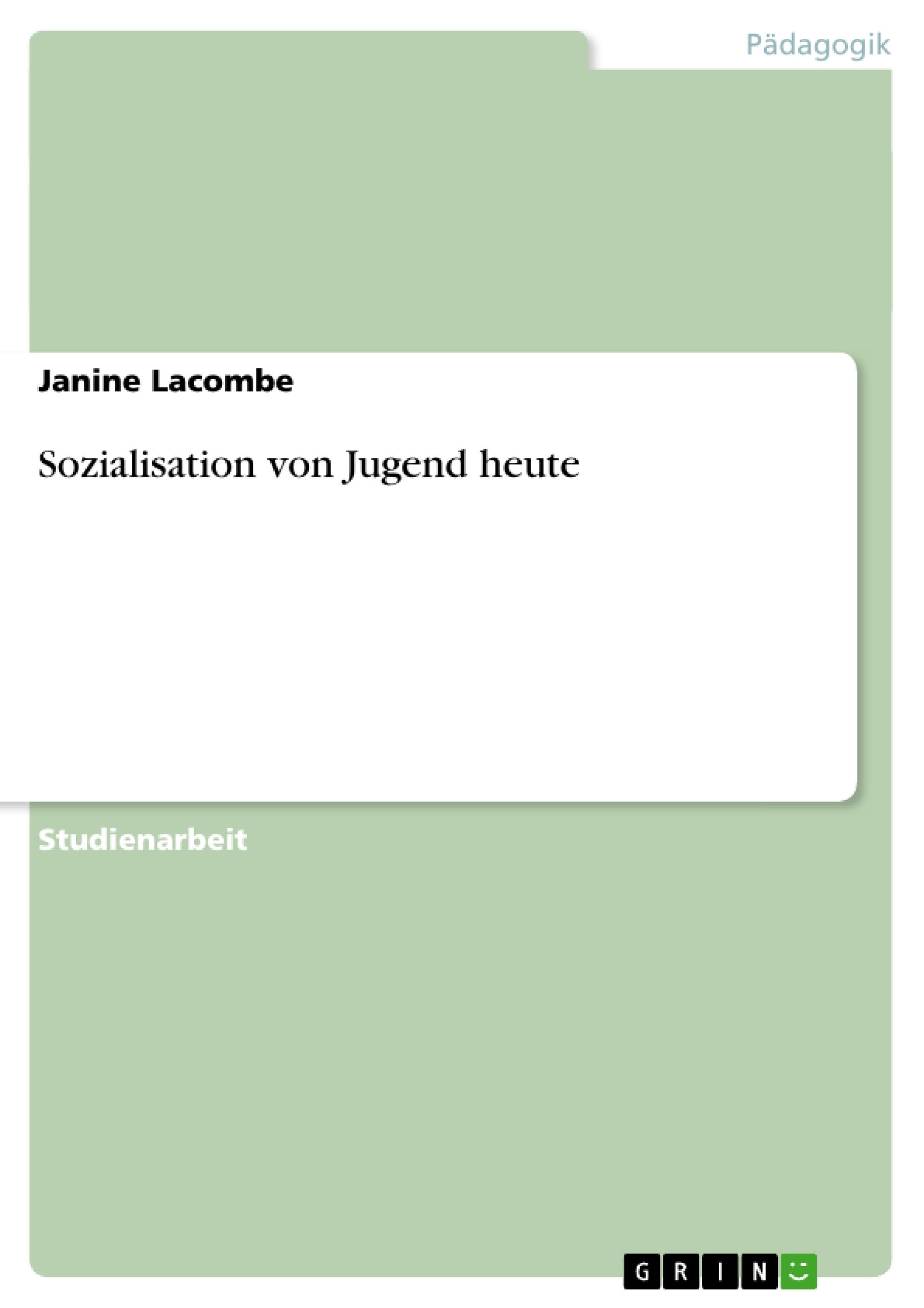Der griechische Philosoph Sokrates (470-399 v.Chr.) schrieb: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“
Und auch Platon (427-347 v.Chr.) schließt sich dieser Äußerung Sokrates‘ in seinem Werk »Der Staat« an und schreibt: „...die Schüler achten Lehrer und Erzieher gering. Überhaupt, die Jüngeren stellen sich den Älteren gleich und treten gegen sie auf, in Wort und Tat.“
Im »Dietrich von Bern«, einer anonymen mittelhochdeutschen Heldendichtung, entstanden im 13. Jahrhundert, wird die Klage Walther von Wasgensteins, eines Neffen des Kaisers, laut, ob denn die Jugend von heute noch etwas anderes könne als „den Becher schwingen.“ (Vgl. Benner/ Oelkers, 2004: 175-179).
Fragt man ältere Menschen, was sie von der Jugend in unserer heutigen Zeit halten, so löst dies oftmals einen nicht enden wollenden Schwall von Klageliedern aus. Die Jugend hat keinen Respekt vor dem Alter, sie hat zu viel Geld, ist verantwortungslos, ist nur auf Spaß aus und will unentwegt Party machen, nimmt Drogen, ist markenfixiert und schmeißt das Geld zum Fenster hinaus. Früher aber, ja früher, da war alles anders. Da hatten die Jugendlichen angeblich noch den nötigen Respekt vor den Erwachsenen, was aber im direkten Widerspruch zu den oben genannten Zitaten steht. Das „Phänomen“ der Jugend gibt es also nicht erst seit dem 19. oder 20. Jahrhundert. Und so wie es Jugendliche schon immer gab, gab es auch Konflikte und Diskussionen über die Generationsunterschiede. Allerdings sind diese immer im Kontext historischer und gesellschaftspolitischer Gegebenheiten zu sehen. Es gibt also einen engen Zusammenhang zwischen sozialer und kultureller Umwelt und der Entwicklung der sich darin befindenden Gesellschaft, zu der ja auch die Jugend zählt. Sicherlich hatten Jugendliche zur Zeit der Antike oder während des ersten und zweiten Weltkrieges ganz andere Erwartungen zu erfüllen und mit ganz anderen Problemen zu kämpfen als die Jugend von heute. Gleich geblieben aber ist die Verantwortung der jeweiligen Gesellschaft, die Jugend ins Erwachsenenalter zu „führen“, sie durch Regeln und Normen zu leiten und zu sozial-integrierten, verantwortungsvollen und fähigen Mitgliedern ihrer Selbst zu erziehen. Die Jugend ist also auch ein Spiegelbild der Gesellschaft in der sie lebt. Welche Entwicklungsaufgaben und Merkmale die Lebensphase Jugend heute hat und warum sie als ein
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sozialisation nach Klaus Hurrelmann
- 2.1 Definition: Sozialisation
- 2.2 „Modell der produktiven Realitätsverarbeitung“
- 2.2.1 „Sozialisation vollzieht sich aus einem Wechselspiel von Anlage und Umwelt“
- 2.2.2 „Sozialisation ist der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in wechselseitiger Abhängigkeit von den körperlichen und psychischen Grundstrukturen und den sozialen und physikalischen Umweltbedingungen.“
- 2.2.3 „Sozialisation ist der Prozess der dynamischen und produktiven Verarbeitung der inneren und äußeren Realität.“
- 2.2.4 „Eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung setzt eine den individuellen Anlagen angemessene soziale und materielle Umwelt voraus. Die wichtigsten Vermittler hierfür sind Familien, Kindergärten und Schulen als Sozialisationsinstanzen.“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sozialisation von Jugendlichen in der heutigen Zeit. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Merkmale dieser Lebensphase im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und institutioneller Einflüsse. Die Arbeit analysiert insbesondere die Theorien von Klaus Hurrelmann zur Sozialisation und deren Relevanz für das Verständnis jugendlicher Entwicklung.
- Die Definition und Bedeutung von Sozialisation im Jugendalter
- Klaus Hurrelmanns Modell der produktiven Realitätsverarbeitung
- Der Einfluss gesellschaftlicher und institutioneller Faktoren auf die Jugendsozialisation
- Die Rolle von Familie, Schule und Peergroups in der Sozialisation
- Die Auseinandersetzung mit gängigen Vorurteilen über Jugendliche
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit historischen Zitaten, die die Kontinuität von Generationenkonflikten aufzeigen. Sie betont, dass die Jugend immer ein Spiegelbild ihrer Gesellschaft war und ist, und dass die Gesellschaft die Verantwortung für die Sozialisation der Jugendlichen trägt. Die Einleitung führt in die Thematik ein und formuliert zentrale Fragen nach den Entwicklungsaufgaben und Merkmalen der Jugendphase heute, sowie nach dem Einfluss von Institutionen wie der Schule. Die Arbeit von Klaus Hurrelmann wird als wichtiger Bezugsrahmen eingeführt.
2. Sozialisation nach Klaus Hurrelmann: Dieses Kapitel beginnt mit einer Definition von Sozialisation als lebenslanger Prozess der Auseinandersetzung mit innerer und äußerer Realität. Es wird darauf eingegangen, dass Sozialisation ein komplexer und individueller Vorgang ist, der schwer pauschal zu definieren ist. Im Mittelpunkt steht die Darstellung von Klaus Hurrelmanns „Modell der produktiven Realitätsverarbeitung“ mit seinen sieben Thesen. Diese Thesen werden im Detail erläutert, beispielsweise die These vom Wechselspiel von Anlage und Umwelt, die These von der dynamischen Verarbeitung innerer und äußerer Realität, und die Bedeutung von Sozialisationsinstanzen wie Familie und Schule für eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung. Das Kapitel verdeutlicht, wie Jugendliche aktiv an ihrer eigenen Entwicklung mitwirken und wie wichtig ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen innerer und äußerer Realität ist.
Schlüsselwörter
Sozialisation, Jugend, Klaus Hurrelmann, produktive Realitätsverarbeitung, Generationenkonflikt, Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisationsinstanzen, Familie, Schule, gesellschaftliche Einflüsse, Entwicklungsaufgaben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sozialisation im Jugendalter nach Klaus Hurrelmann
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über die Sozialisation von Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf die Theorien von Klaus Hurrelmann. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der behandelten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Sozialisation von Jugendlichen in der heutigen Zeit, beleuchtet die Herausforderungen und Merkmale dieser Lebensphase und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen und institutioneller Faktoren. Ein zentraler Fokus liegt auf Klaus Hurrelmanns Modell der produktiven Realitätsverarbeitung und dessen Relevanz für das Verständnis jugendlicher Entwicklung. Weitere Themen sind die Definition von Sozialisation, die Rolle von Familie, Schule und Peergroups, sowie die Auseinandersetzung mit gängigen Vorurteilen über Jugendliche.
Was ist das zentrale Modell, das in der Arbeit untersucht wird?
Das zentrale Modell ist Klaus Hurrelmanns „Modell der produktiven Realitätsverarbeitung“. Die Arbeit erläutert die sieben Thesen dieses Modells im Detail, beispielsweise die These vom Wechselspiel von Anlage und Umwelt und die Bedeutung von Sozialisationsinstanzen für eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung.
Welche Sozialisationsinstanzen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Rolle verschiedener Sozialisationsinstanzen, darunter Familie, Schule und Peergroups, und untersucht deren Einfluss auf die Entwicklung von Jugendlichen.
Wie wird die Einleitung der Arbeit beschrieben?
Die Einleitung verwendet historische Zitate, um die Kontinuität von Generationenkonflikten zu verdeutlichen. Sie betont die Verantwortung der Gesellschaft für die Sozialisation Jugendlicher und führt in die zentrale Fragestellung nach den Entwicklungsaufgaben und Merkmalen der Jugendphase heute ein. Die Arbeit von Klaus Hurrelmann wird als wichtiger Bezugsrahmen eingeführt.
Wie wird Kapitel 2 (Sozialisation nach Klaus Hurrelmann) zusammengefasst?
Kapitel 2 definiert Sozialisation als lebenslangen Prozess der Auseinandersetzung mit innerer und äußerer Realität. Es beschreibt Sozialisation als komplexen und individuellen Vorgang und stellt detailliert Klaus Hurrelmanns „Modell der produktiven Realitätsverarbeitung“ mit seinen sieben Thesen vor. Der aktive Beitrag Jugendlicher an ihrer eigenen Entwicklung und die Bedeutung eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen innerer und äußerer Realität werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sozialisation, Jugend, Klaus Hurrelmann, produktive Realitätsverarbeitung, Generationenkonflikt, Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisationsinstanzen, Familie, Schule, gesellschaftliche Einflüsse, Entwicklungsaufgaben.
- Quote paper
- Janine Lacombe (Author), 2011, Sozialisation von Jugend heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267177