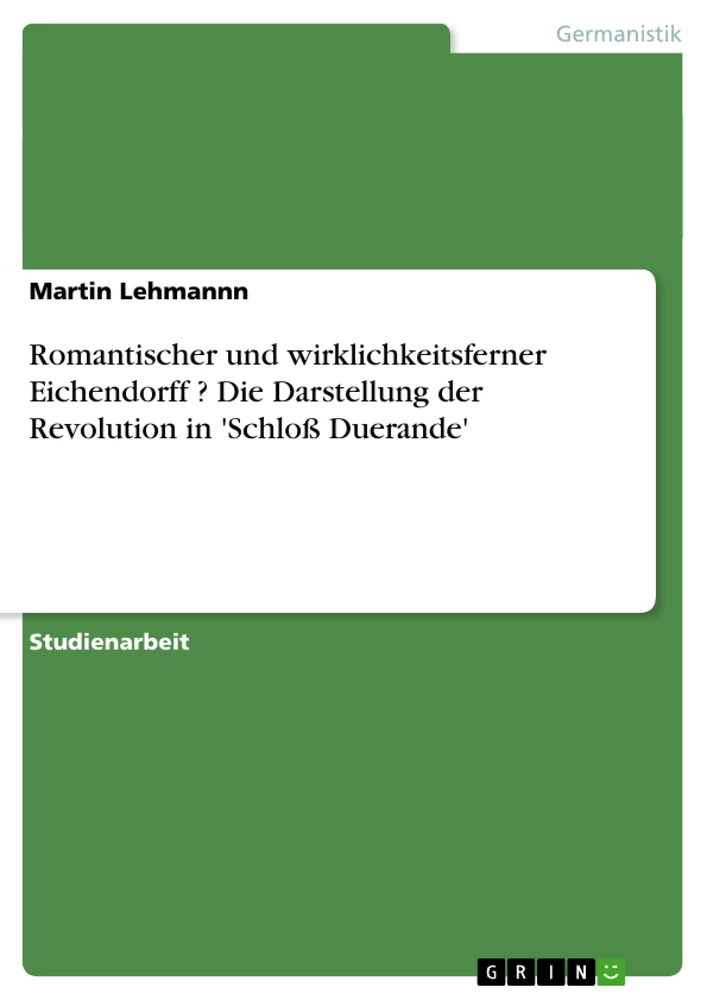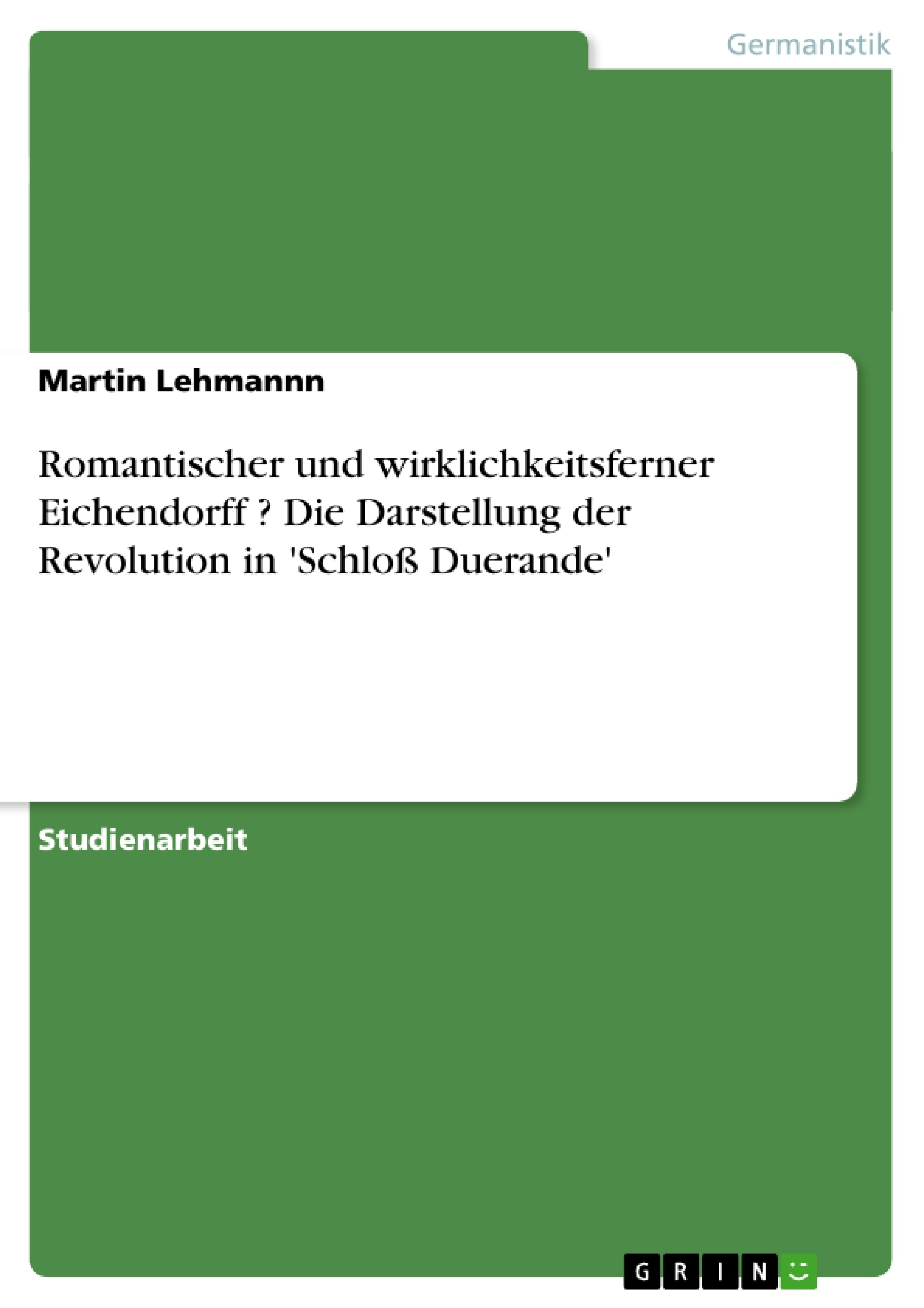Das Werk Joseph von Eichendorffs wurde und wird häufig mit bestimmten romantischen
Gemeinplätzen in Verbindung gebracht. Gedichte wie ‚Mondnacht’, ‚Nachtzauber’ oder die
Erzählung ‚Aus dem Leben eines Taugenichts’ erscheinen Vielen für sein literarisches
Schaffen besonders charakteristisch zu sein. Daraus werden oftmals einige vermeintlich
prototypische Eigenschaften des Dichters Eichendorff abgeleitet. Hierzu kommentiert Helmut
KOOPMANN1:
Auf das „Romantische“ hat man Eichendorff schon sehr früh festgelegt; Heine hat
ihn bereits in seiner „Romantischen Schule“ nahe an Uhland herangerückt und den
Unterschied zu diesem nur in der „grüneren Waldesfrische und der kristallhafteren
Wahrheit der Eichendorffschen Gedichte“ gesehen. Fontane hat bekannt, wie hoch
auch er den Taugenichts stelle[.] […] Und so zieht sich das Loblied auf den
romantischen Eichendorff weiter durch die Jahrzehnte bis hin in die Gegenwart.
Auch die zeitgenössische Rezension von ‚Schloss Dürande’, das als Auftragsarbeit für das
jährlich erscheinende Taschenbuch ‚Urania’ des Leipziger Buchhändlers Brockhaus 1835/36
entstand, knüpft an Eichendorffsche Klischeevorstellungen an. Die folgenden Auszüge dreier
Rezensionen aus dem Jahre 1836 belegen dies2. Der Autor der Novelle sei nicht nur
romantisch und vor allem poetisch statt inhaltlich ausdrucksstark, sondern auch noch
wirklichkeitsfern und weltfremd:
Eben im Vortrage, nicht im Inhalt, der an allerlei schon Verbrauchtes erinnert, beruht
der eigenthümliche poetische Wert dieser Novelle.
Eichendorff gleicht einem vortrefflichen Landschafter, in so fern er Sonnenauf- und
Niedergang, Mondschein, Waldeinsamkeit, jagende Wolkenbilder, dunkle Nacht,
blauen Himmel recht gut zu malen weiß.
Auch in dieser (Novelle) ist Alles absonderlich, wie bei Eichendorff immer. Liebe,
Leben, Tod, Sprache, Charakteristik, Alles ist seltsam und in seiner Seltsamkeit
poetisch. […] Eichendorff stammt noch aus der Zeit der Brentano und Arnim; die
Lebenswirklichkeit gilt ihm nichts[!]
Ziel dieser Untersuchung ist es, die genannten Stereotype in Bezug auf ‚Schloß Dürande’ zu
widerlegen. Wie noch zu zeigen sein wird, vernachlässigen die zitierten Rezensenten einige
zentrale Aspekte der Novelle. [...]
1 KOOPMANN 1970: 181.
2 Zitiert nach LINDEMANN 1980: 137.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewitter- und Feuermetapher als vernichtende Revolutionskritik
- Revolutionskritik auf der Ebene der Figuren
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widerlegt die gängige Vorstellung von Eichendorffs „Schloß Dürande“ als rein romantische und wirklichkeitsferne Erzählung. Sie konzentriert sich auf die detaillierte Darstellung der Revolutionskritik in der Novelle und zeigt auf, wie Eichendorff auf vielschichtige Weise eine extrem negative Wertung revolutionären Handelns zum Ausdruck bringt. Die Analyse beschränkt sich auf die politische Aussage der Novelle, ohne die heutige Relevanz dieser Kritik zu bewerten.
- Darstellung der französischen Revolution in „Schloß Dürande“
- Analyse der verwendeten Metaphorik (Gewitter und Feuer) als Symbol für die Revolution
- Charakterisierung der Figuren und ihre Beziehung zur Revolution
- Zusammenhang zwischen individuellem Schicksal und dem geschichtlichen Kontext der Revolution
- Widerlegung romantischer Klischees in Bezug auf Eichendorffs Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die gängige Rezeption von Eichendorffs Werk als romantisch und wirklichkeitsfern dar und führt die These ein, dass in „Schloß Dürande“ eine explizite Kritik an revolutionärem Streben verborgen ist. Die Arbeit zielt darauf ab, diese Kritik detailliert zu analysieren und die vermeintlich nebensächlichen Aspekte der Novelle, wie die politische Dimension, in den Mittelpunkt zu stellen. Die Analyse erfolgt zweigleisig: durch die Untersuchung der Figuren und der verwendeten Bildsprache, insbesondere der Gewitter- und Feuermetapher, die die zerstörerische Kraft der Revolution symbolisieren.
Gewitter- und Feuermetapher als vernichtende Revolutionskritik: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Gewitter- und Feuermetaphern in „Schloß Dürande“ als Chiffre für die verheerende Wirkung der Revolution. Der Text verweist auf literarische Vorbilder wie Schiller und Goethe, die ähnliche Bilder zur Darstellung der Revolution nutzten. Eichendorff verwendet die Naturbeschreibung nicht nur als ästhetisches Element, sondern gezielt, um die zerstörerische Kraft der revolutionären Umwälzungen zu verdeutlichen. Die Kapitel stellt die These auf, dass die Naturbeschreibung funktional ist und nicht als bloßes Beiwerk betrachtet werden kann. Es hinterfragt somit die gängige Sichtweise, die den poetischen Wert der Novelle nur im "Vortrag" sieht.
Schlüsselwörter
Joseph von Eichendorff, Schloß Dürande, Französische Revolution, Revolutionskritik, Romantismus, Gewittermetapher, Feuermetapher, politische Dimension, Figurenanalyse, Symbolsprache.
Häufig gestellte Fragen zu Eichendorffs "Schloß Dürande"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die in Eichendorffs Novelle "Schloß Dürande" verborgene Revolutionskritik. Sie widerlegt die gängige Vorstellung des Werks als rein romantische und wirklichkeitsferne Erzählung und konzentriert sich auf die detaillierte Darstellung der extrem negativen Wertung revolutionären Handelns.
Welche Methoden werden zur Analyse verwendet?
Die Analyse erfolgt zweigleisig: durch die Untersuchung der Figuren und ihrer Beziehung zur Revolution und durch die Interpretation der verwendeten Bildsprache, insbesondere der Gewitter- und Feuermetapher als Symbole für die zerstörerische Kraft der Revolution. Dabei werden literarische Vorbilder wie Schiller und Goethe herangezogen.
Welche Rolle spielen die Metaphern "Gewitter" und "Feuer"?
Die Gewitter- und Feuermetaphern werden als Chiffre für die verheerende Wirkung der französischen Revolution interpretiert. Die Naturbeschreibung wird nicht als bloßes ästhetisches Element, sondern als funktionaler Bestandteil der Revolutionskritik verstanden, der die zerstörerische Kraft der revolutionären Umwälzungen verdeutlicht.
Wie wird die französische Revolution in der Novelle dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Darstellung der französischen Revolution in "Schloß Dürande" und zeigt auf, wie Eichendorff auf vielschichtige Weise eine extrem negative Wertung revolutionären Handelns zum Ausdruck bringt. Die Analyse konzentriert sich auf die politische Aussage der Novelle, ohne die heutige Relevanz dieser Kritik zu bewerten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse der Gewitter- und Feuermetapher als Revolutionskritik, ein Kapitel zur Revolutionskritik auf der Ebene der Figuren und eine Zusammenfassung mit Ausblick. Die Einleitung stellt die These der expliziten Revolutionskritik in der Novelle vor. Das Kapitel zu den Metaphern analysiert deren symbolische Bedeutung im Kontext der Revolution. Das Kapitel zur Figurenanalyse untersucht die Beziehungen der Figuren zur Revolution. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Joseph von Eichendorff, Schloß Dürande, Französische Revolution, Revolutionskritik, Romantismus, Gewittermetapher, Feuermetapher, politische Dimension, Figurenanalyse, Symbolsprache.
Welche gängige Rezeption von Eichendorffs Werk wird in Frage gestellt?
Die Arbeit widerlegt die gängige Rezeption von Eichendorffs "Schloß Dürande" als rein romantische und wirklichkeitsferne Erzählung. Sie betont stattdessen die politische Dimension und die explizite Kritik an revolutionärem Handeln, die in der Novelle verborgen ist.
- Quote paper
- Martin Lehmannn (Author), 2004, Romantischer und wirklichkeitsferner Eichendorff ? Die Darstellung der Revolution in 'Schloß Duerande', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26709