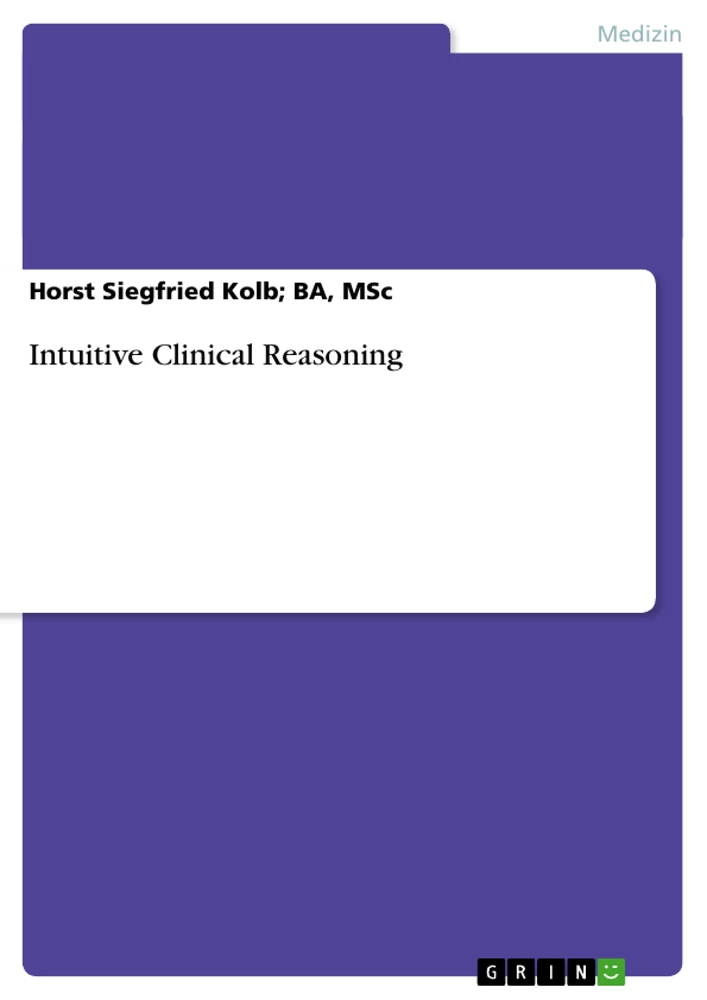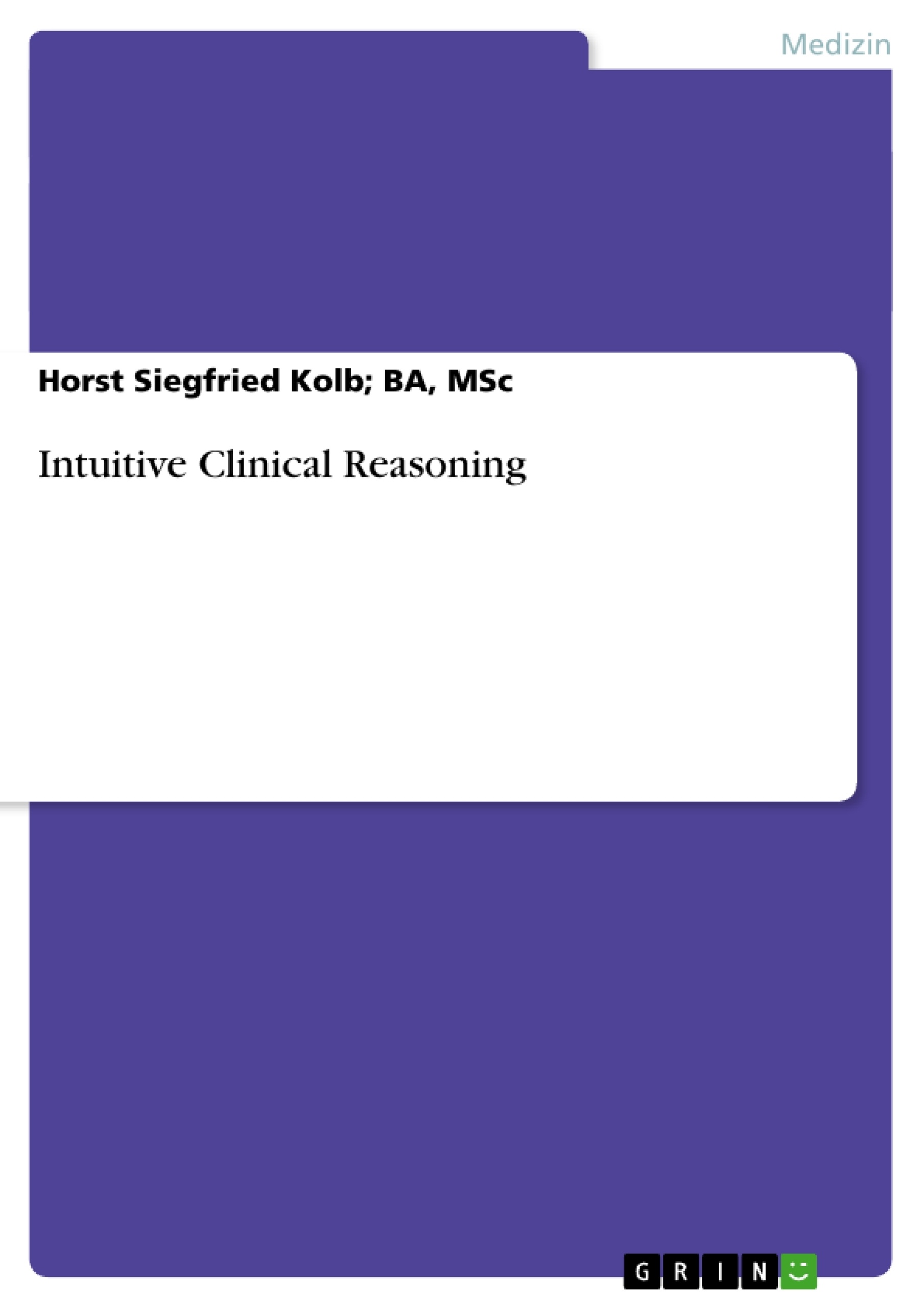Clinical Reasoning wird gemeinhin als ein rationaler Prozess angesehen, der analytisches Denken voraussetzt und beinhaltet. Neuerdings werden zunehmend Beweise dafür veröffentlicht, dass Clinical Reasoning eher als von zwei Prozessen gesteuert anzusehen ist: Einem rational-deliberaten als auch einem intuitiven Denken.
In dieser Publikation werden zunächst die Grundzüge des rationalen Clinical Reasoning vorgestellt und beschrieben. Anschließend wird auf die Parallelen, aber auch die Unterschiede zum Intuitive Clinical Reasoning eingegangen.
Der zweite Teil beinhaltet eine empirische Studie, die die Präferenz für Intuition und deren Messung an Pflegefachkräften in drei Alten- und Pflegeheimen untersuchte. Angelehnt an den Erkenntnissen von Patricia Benner wurden Beweise gesucht, ob Pflegefachkräfte eher Intuition nutzen als ihre weniger erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
Die Studienergebnisse belegen eine generelle starke Nutzung der Intuition im Entscheidungsverhalten, eine Korrelation mit der vorhandenen Expertise konnte allerdings aufgrund eines Plafond-Effektes nicht dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung und Problemdarstellung
- Theoretischer Teil
- 2 Clinical Reasoning
- 2.1 Elemente des Clinical Reasoning
- 2.1.1 CR-Element Kognition
- 2.1.2 CR-Element Wissen
- 2.1.3 CR-Element Metakognition
- 2.1.4 CR-Element Umfeld
- 2.1.5 CR-Element Patienteninput
- 2.1.6 CR-Element Problem
- 2.2 Prozess des Clinical Reasoning in der Pflege
- 2.2.1 Pflegeprozess als Metaprozess
- 2.2.2 Pflegeprozess als evolutionäre Helix
- 2.2.3 Einfluss des CR-Prozesses auf den Pflegeprozess
- 2.3 Prozess-Schritte des Clinical Reasoning
- 2.3.1 Pre-Assessment Image
- 2.3.2 Cue Acquisition
- 2.3.3 Hypothesis Generation
- 2.3.4 Cue Interpretation
- 2.3.5 Hypothesis Evaluation
- 2.3.6 Diagnosis
- 2.4 Ebenen des Clinical Reasoning
- 2.4.1 Mikro-Ebene des Clinical Reasoningrd
- 2.4.2 Meso-Ebene des Clinical Reasoningrd
- 2.4.3 Makro-Ebene des Clinical Reasoningrd
- 2.4.4 Exo-Ebene des Clinical Reasoningrd
- 2.5 Ökosysteme des Clinical Reasoning
- 2.5.1 Mikrosystem des Clinical Reasoning
- 2.5.2 Mesosystem des Clinical Reasoning
- 2.5.3 Exosystem des Clinical Reasoning
- 2.5.4 Chronosystem des Clinical Reasoning
- 2.5.5 Makrosystem des Clinical Reasoning
- 2.6 Rational-deliberate Formen des Clinical Reasoning
- 3 Clinical Reasoning innerhalb der Dual-Process-Theory
- 3.1 Gesetze des Clinical Reasoning
- 3.1.1 Gesetze des rational-deliberaten Clinical Reasoning
- 3.1.2 Gesetze des holistischen Clinical Reasoning
- 3.1.3 Gegenüberstellung der Gesetzmäßigkeiten
- 3.2 Dual Process Theory
- 3.2.1 Konzeptualisierung der Interaktion
- 3.2.2 System 1
- 3.2.3 System 2
- 3.2.4 System 3
- 4 Intuitive Clinical Reasoning (ICR)
- 4.1 Intuition im Intuitive Clinical Reasoning
- 4.1.1 Schülerbefragung zum Begriff der Intuition
- 4.1.2 Versuch einer Definition
- 4.1.3 Funktionsebenen der Intuition im ICR
- 4.1.4 Formen der Intuition
- 4.1.5 Wahrnehmungsebenen der Intuition
- 4.1.6 Komponenten der Intuition und deren Schnittmengen
- 4.1.7 Funktionsmodelle der Intuition
- 4.2 Wissen als Voraussetzung zur Intuition
- 4.2.1 Gedächtnissysteme nach Inhalt
- 4.2.2 Gedächtnissysteme nach Prozess
- 4.3 Expertise
- 4.4 Cognitive Continuum Theory (CCT)
- 4.4.1 Cognitive Continuum Modes
- 4.4.2 Kontextueller Determinismus im Cognitive Continuum
- 4.5 Intuitionsmessung
- 4.5.1 Typenlehre nach Carl Gustav Jung
- 4.5.2 Intuition im Wirklichkeitskonstruktivismus
- 4.5.3 Jungian Personality Profil (JPP)
- 4.5.4 Persönlichkeitstest-Instrument Jungsche Typenlehre (jtl)
- 4.5.5 Myers-Briggs-Typindikator (MBTI)
- 4.5.6 Keirsey Temperament Sorter (KTS)
- 4.5.7 Miller Intuitiveness Instrument (MII)
- 4.5.8 Smith Intuition Instrument (SII)
- 4.5.9 Himaya Intuition Semantic Scale (HINTS)
- 4.5.10 Rational-Experiential Inventory (REI)
- 4.5.11 Information-Processing Style Inventory (IPSI)
- 4.5.12 Präferenz für Intuition und Deliberation (PID)
- 4.5.13 Intuitionstests im Alltag
- 4.6 Ebenen des Intuitive Clinical Reasoning
- Empirischer Teil
- 5 Literaturanalyse
- 6 Fragestellung
- 6.1 Nutzen der Fragestellung und Relevanz
- 6.2 Verwendung der Ergebnisse in der Praxis
- 7 Hypothesen, Vermutungen und Operationalisierung
- 7.1 Hypothesenbildung
- 7.2 Operationalisierung
- 8 Methodik
- 8.1 Praxisforschungsfeld
- 8.2 Studiendesign
- 8.3 Sampling
- 8.4 Erhebungsmethode
- 8.5 Triangulation
- 9 Ethische Überlegungen
- 10 Durchführungsphase und Datenerhebung
- 11 Auswertung und Ergebnisdarstellung
- 11.1 Stichprobenbeschreibung
- 11.2 Neutrales Element
- 11.3 Spezielle Elemente
- 11.4 Ergebnisdarstellung des speziellen Fragebogenteils
- 11.5 Explorative Ergebnisauswertung
- 12 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 12.1 Rücklaufquote und Antwortausfall
- 12.2 Altersverteilung
- 12.3 Expertise
- 12.4 Steigerung der Expertise durch Vorerfahrung
- 12.5 Berufe
- 12.6 Ausreißerwerte
- 12.7 Basale Entscheidungspräferenzen
- 12.8 Expertisierte Entscheidungspräferenzen
- 12.9 Beeinflussung der Präferenz durch das Lebensalter
- 13 Erkenntnisgewinn der empirischen Untersuchung
- 14 Schlussfolgerung und Bedeutung
- 14.1 Bedeutung für die Pflegewissenschaft
- 14.2 Bedeutung für die Pflegepädagogik
- 14.3 Bedeutung für die Pflegepraxis
- 14.4 Bedeutung für das Pflegemanagement
- 15 Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
- Anhang
- Verzeichnisse
- Der Einfluss von Intuition auf pflegerische Entscheidungen
- Der Zusammenhang zwischen Expertise und der Nutzung von Intuition im Clinical Reasoning
- Die verschiedenen Formen und Ebenen des Clinical Reasoning (rational und intuitiv)
- Die Rolle von implizitem Wissen und Erfahrung in der intuitiven Entscheidungsfindung
- Methoden zur Erfassung und Messung von Intuition in der Pflege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Intuition auf pflegerische Entscheidungen. Die Zielsetzung besteht darin, den Zusammenhang zwischen Expertise (Berufserfahrung) und der Nutzung von intuitivem Clinical Reasoning (ICR) bei Pflegefachkräften zu analysieren. Dabei wird untersucht, ob erfahrene Pflegekräfte Intuition stärker in ihre Entscheidungsfindung integrieren als weniger erfahrene Kollegen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung und Problemdarstellung: Die Einleitung stellt den Begriff "Clinical Reasoning" (CR) vor und verdeutlicht dessen wachsende Bedeutung in verschiedenen medizinischen und pflegerischen Bereichen. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, den oft vernachlässigten intuitiven Aspekt des CR genauer zu betrachten und zu untersuchen.
2 Clinical Reasoning: Dieses Kapitel definiert CR und betont die Notwendigkeit, den Prozess sowohl unter unipersonal-psychologischen als auch multipersonal-soziologischen Aspekten zu betrachten, um die Teamkomponente in der Pflege zu berücksichtigen. Es werden die sechs Elemente des CR nach Higgs und Jones (Kognition, Wissen, Metakognition, Umfeld, Patienteninput, Problem) detailliert beschrieben und deren Interaktion im „integrierten patientenzentrierten Modell des Clinical Reasoning“ erläutert.
3 Clinical Reasoning innerhalb der Dual-Process-Theory: Dieses Kapitel beschreibt, wie die Dual-Process-Theory das bisherige Paradigma eines rein rationalen CR erweitert. Es werden die Gesetzmäßigkeiten des rational-deliberativen und holistischen CR gegenübergestellt und die Konzepte der Zwei-Prozess-Theorien (System 1/Intuition und System 2/Deliberation) sowie deren Interaktion im Entscheidungsprozess vorgestellt.
4 Intuitive Clinical Reasoning (ICR): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Intuition im CR-Prozess. Es präsentiert Ergebnisse einer Schülerbefragung zum Begriff "Intuition", verschiedene Definitionen und Funktionsebenen der Intuition, sowie unterschiedliche Formen und Wahrnehmungsebenen. Weiterhin werden Methoden zur Intuitionsmessung (Jungsche Typologie, JPP, jtl, MBTI, KTS, MII, SII, HINTS, REI, PID) diskutiert.
5 Literaturanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die angewandte Literaturrecherche mit den Schritten: Suche in Suchmaschinen (Google), Datenbanken (PubMed) und Literatur (Monographien, Artikel, Abschlussarbeiten). Es zeigt die Schwierigkeiten auf, Literatur zum Thema Intuitive Clinical Reasoning zu finden.
6 Fragestellung: Hier wird die Forschungsfrage formuliert: Welchen Einfluss hat Intuition auf die pflegerischen Entscheidungen erfahrener Pflegefachkräfte im Gegensatz zu denen weniger erfahrener Pflegefachkräfte? Der Nutzen und die Relevanz der Fragestellung für die Pflegewissenschaft und Praxis werden erläutert.
7 Hypothesen, Vermutungen und Operationalisierung: Die Nullhypothese (H0) und die Alternativhypothese (H1) werden formuliert, und die Operationalisierung der unabhängigen Variablen (Erfahrung) und der abhängigen Variablen (Intuitionsnutzung) wird detailliert beschrieben.
8 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie. Es wird ein quantitatives Studiendesign mit Fragebogenbefragungen in drei Alten- und Pflegeheimen verwendet. Die Stichprobenbildung, die Erhebungsmethode und die Triangulation zur Absicherung der Ergebnisse werden erläutert.
Schlüsselwörter
Clinical Reasoning, Intuitives Clinical Reasoning, Intuition, Expertise, Pflege, Dual-Process-Theory, Gedächtnis, Entscheidungsfindung, Implizites Wissen, Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik, Pflegepraxis, Pflegemanagement, Jungsche Typologie, Messinstrumente (PID, REI).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einfluss von Intuition auf pflegerische Entscheidungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Intuition auf pflegerische Entscheidungen und den Zusammenhang zwischen Expertise (Berufserfahrung) und der Nutzung intuitiven Clinical Reasoning (ICR) bei Pflegefachkräften. Das Hauptziel ist die Analyse, ob erfahrene Pflegekräfte Intuition stärker in ihre Entscheidungsfindung integrieren als weniger erfahrene Kollegen.
Was ist Clinical Reasoning (CR)?
Clinical Reasoning wird als der Prozess der Entscheidungsfindung in medizinischen und pflegerischen Kontexten definiert. Die Arbeit betrachtet CR sowohl unter unipersonal-psychologischen als auch multipersonal-soziologischen Aspekten, um die Teamkomponente in der Pflege zu berücksichtigen. Sechs Elemente werden detailliert beschrieben: Kognition, Wissen, Metakognition, Umfeld, Patienteninput und Problem.
Welche Rolle spielt die Dual-Process-Theory?
Die Dual-Process-Theory erweitert das Paradigma eines rein rationalen CR. Sie beschreibt die Interaktion zwischen System 1 (Intuition) und System 2 (Deliberation) im Entscheidungsprozess und beleuchtet die Gesetzmäßigkeiten des rational-deliberativen und holistischen CR.
Was ist intuitives Clinical Reasoning (ICR)?
ICR konzentriert sich auf die Rolle der Intuition im CR-Prozess. Die Arbeit untersucht verschiedene Definitionen und Funktionsebenen der Intuition, ihre Formen und Wahrnehmungsebenen. Es werden diverse Methoden zur Intuitionsmessung diskutiert, darunter die Jungsche Typologie, JPP, jtl, MBTI, KTS, MII, SII, HINTS, REI und PID.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil definiert CR und ICR, beschreibt relevante Theorien (Dual-Process-Theory) und Methoden zur Intuitionsmessung. Der empirische Teil umfasst eine Literaturanalyse, die Formulierung von Forschungsfrage und Hypothesen, die Beschreibung der Methodik (quantitative Studie mit Fragebogenbefragungen), die Datenerhebung und -auswertung sowie die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welchen Einfluss hat Intuition auf die pflegerischen Entscheidungen erfahrener Pflegefachkräfte im Gegensatz zu denen weniger erfahrener Pflegefachkräfte?
Welche Methodik wurde angewendet?
Es wurde ein quantitatives Studiendesign mit Fragebogenbefragungen in drei Alten- und Pflegeheimen verwendet. Die Stichprobenbildung, die Erhebungsmethode und die Triangulation zur Absicherung der Ergebnisse werden detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse werden in Bezug auf Stichprobenbeschreibung, spezifische Elemente, explorative Ergebnisauswertung und die Interpretation in Bezug auf Rücklaufquote, Altersverteilung, Expertise, Berufserfahrung, basale und expertisierte Entscheidungspräferenzen dargestellt und diskutiert. Es wird analysiert, wie das Lebensalter die Präferenz beeinflusst.
Welche Bedeutung haben die Ergebnisse?
Die Ergebnisse haben Bedeutung für die Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik, Pflegepraxis und das Pflegemanagement. Die Schlussfolgerungen werden im Kontext der Pflegeberufe und deren Entscheidungsfindung diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Clinical Reasoning, Intuitives Clinical Reasoning, Intuition, Expertise, Pflege, Dual-Process-Theory, Gedächtnis, Entscheidungsfindung, Implizites Wissen, Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik, Pflegepraxis, Pflegemanagement, Jungsche Typologie, Messinstrumente (PID, REI).
- Quote paper
- Horst Siegfried Kolb; BA, MSc (Author), 2014, Intuitive Clinical Reasoning, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266783