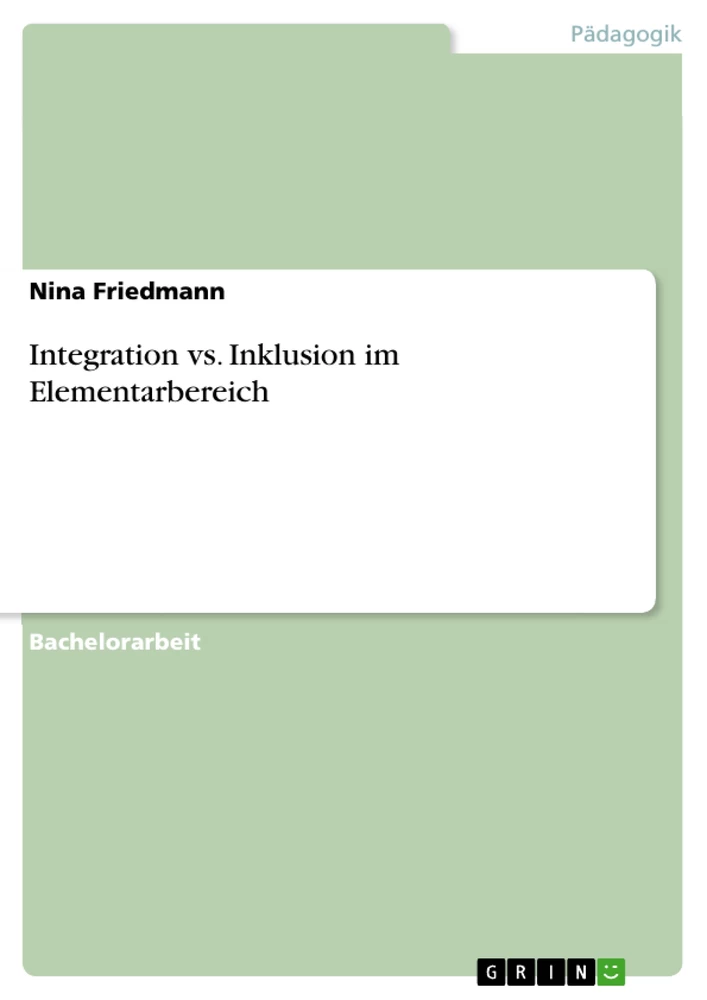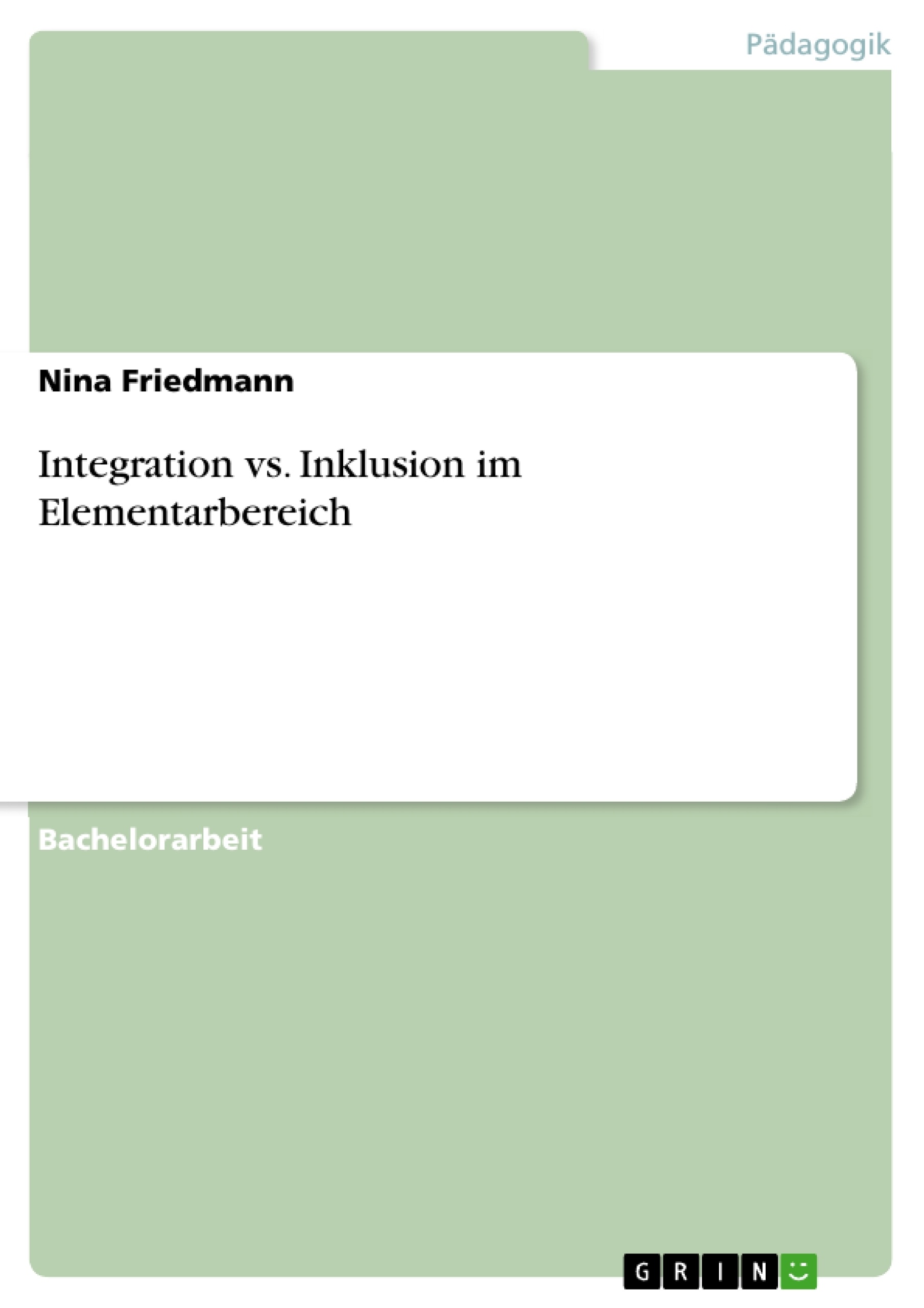„Es ist normal, verschieden zu sein.“
(Richard von Weizsäcker)
Mit diesem Zitat beschreibt Richard von Weizsäcker schon im Jahr 1933 in einer Rede als Bundespräsident gewissermaßen das Inklusionskonzept, welches einen
der beiden Schwerpunkte dieser Thesis darstellt.
Inklusion und Integration – zwei Begriffe die für viele Menschen dasselbe bedeuten, jedoch für andere klar voneinander abzugrenzen sind. In der heutigen Fachdiskussion ist der Begriff der Inklusion immer häufiger zu finden, woraus man schließen könnte, dass Inklusion den Integrationsbegriff ersetzen will. Ein Blick in die Praxis zeigt aber, dass das Inklusionskonzept oftmals so nicht in der Praxis
vorzufinden ist. In den meisten Einrichtungen wird das Konzept der Integration umgesetzt, welches den zweiten Schwerpunkt darstellt.
Die vorliegende Thesis befasst sich mit dem Integrations- und dem Inklusionsbegriff im pädagogischen Sinne. Herauszufinden gilt, ob Inklusion nur ein neues
Synonym für Integration darstellt, diesen Begriff eventuell ersetzt oder als Erweiterung des Integrationsbegriffs gesehen werden soll. Zunächst wird in dieser Arbeit auf den Begriff „Behinderung“ eingegangen und wie dieser Begriff im Integrations- und
Inklusionskonzept gesehen wird. Danach werden beide Konzepte näher erläutert. Hierbei wird ein historischer Einblick bzw. die Entstehung der beiden Begriffe
dargelegt. Im Zusammenhang mit dem Inklusionskonzept wird weiter auf den „Index for Inclusion“ eingegangen und anschließend werden das Integrations- und das Inklusionskonzept miteinander verglichen. Ziel dieser Thesis ist es zu ergründen, mit welchen Problemen die Praxis bei der Umsetzung des Integrations- bzw.
Inklusionskonzeptes zu kämpfen hat und wie damit umgegangen wird. Zudem will die Thesis aufdecken, was Integration und Inklusion in der pädagogischen Arbeit verändert haben oder es gegebenenfalls verändern werden. Hierzu wurden drei aussagekräftige, aus der Theorie abgeleitete, Hypothesen erstellt.[...]
Im zweiten Teil der Thesis wird auf eine selbst durchgeführte Untersuchung eingegangen,
bei der es um die Umsetzung des Integrations- bzw. Inklusionskonzeptes
in frühkindlichen Einrichtungen geht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- „Behinderung“ im Zusammenhang mit Integration/Inklusion
- Integration im pädagogischen Kontext
- Inklusion im pädagogischen Kontext
- Vergleich des Integrations- und Inklusionskonzeptes
- Integration/Inklusion in der Praxis
- Kooperationen
- Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit
- Probleme/Lösungen
- Konzepte im Elementarbereich
- Montessori-Pädagogik
- Reggio-Pädagogik
- Der offene Kindergarten – die offene Arbeit
- Situationsansatz
- Beurteilung der Ansätze im Hinblick auf die Umsetzung des Inklusionsgedanken
- Hypothesen/Annahmen
- Empirischer Teil
- Art der Befragung
- Fragebogen
- Stichprobe
- Analyse/Ergebnisse
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Konzepte von Integration und Inklusion im Elementarbereich. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Konzepte herauszuarbeiten und deren praktische Umsetzung in frühkindlichen Einrichtungen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Implementierung dieser Konzepte.
- Begriffliche Abgrenzung von Integration und Inklusion
- Analyse der Auswirkungen von Integration und Inklusion auf die pädagogische Praxis
- Bewertung verschiedener pädagogischer Ansätze im Hinblick auf Inklusion
- Empirische Untersuchung zur Umsetzung von Integrations- und Inklusionskonzepten in Kitas
- Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Implementierung von Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Integration und Inklusion ein und benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Sie verdeutlicht die Bedeutung des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das Zitat von Richard von Weizsäcker dient als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dem Inklusionsgedanken.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ im pädagogischen Kontext. Es analysiert den Begriff „Behinderung“ im Zusammenhang mit beiden Konzepten und beleuchtet die historischen Entwicklungen sowie den Unterschied zwischen Integration und Inklusion. Der Index for Inclusion wird als relevantes Instrument zur Förderung von Inklusion vorgestellt.
Integration/Inklusion in der Praxis: Dieses Kapitel untersucht die praktische Umsetzung von Integrations- und Inklusionskonzepten. Es beleuchtet Kooperationen, Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit, auftretende Probleme und Lösungsansätze. Verschiedene pädagogische Ansätze wie Montessori-Pädagogik, Reggio-Pädagogik, der offene Kindergarten und der Situationsansatz werden im Hinblick auf ihre Eignung zur Umsetzung des Inklusionsgedanken analysiert und bewertet. Der Abschnitt endet mit der Formulierung von Hypothesen für die empirische Untersuchung.
Empirischer Teil: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Art der Befragung, den Aufbau des Fragebogens und die Auswahl der Stichprobe. Die Datengewinnung und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung werden detailliert dargestellt.
Analyse/Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert und analysiert. Die Ergebnisse der Befragung werden in Bezug auf die zuvor formulierten Hypothesen interpretiert.
Diskussion: Die Diskussion setzt die Ergebnisse der empirischen Untersuchung in einen theoretischen Kontext. Sie bewertet die Ergebnisse kritisch und diskutiert mögliche Einschränkungen der Studie. Es erfolgt ein Abgleich der empirischen Ergebnisse mit den theoretischen Überlegungen aus den vorhergehenden Kapiteln.
Schlüsselwörter
Integration, Inklusion, Elementarbereich, Behinderung, Pädagogik, frühkindliche Bildung, inklusive Pädagogik, empirische Untersuchung, Montessori-Pädagogik, Reggio-Pädagogik, offener Kindergarten, Situationsansatz, Kooperation, Hypothesen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Integration und Inklusion im Elementarbereich
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Konzepte von Integration und Inklusion im Elementarbereich. Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Konzepte und deren praktische Umsetzung in frühkindlichen Einrichtungen. Ein Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen und Lösungsansätzen bei der Implementierung dieser Konzepte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffliche Abgrenzung von Integration und Inklusion, Analyse der Auswirkungen auf die pädagogische Praxis, Bewertung verschiedener pädagogischer Ansätze (Montessori, Reggio, offener Kindergarten, Situationsansatz) im Hinblick auf Inklusion, empirische Untersuchung zur Umsetzung in Kitas und Herausforderungen/Lösungsansätze bei der Implementierung von Inklusion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Begriffsbestimmung (inkl. Definition von „Behinderung“ im Kontext von Integration/Inklusion und Vergleich der Konzepte), einen Abschnitt zur Praxis von Integration/Inklusion (inkl. Kooperationen, Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit, Probleme/Lösungen und Analyse verschiedener pädagogischer Ansätze), einen empirischen Teil (mit Beschreibung der Methodik, Fragebogen und Stichprobe), die Analyse der Ergebnisse, eine Diskussion und ein Fazit.
Welche pädagogischen Ansätze werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Montessori-Pädagogik, die Reggio-Pädagogik, den offenen Kindergarten und den Situationsansatz im Hinblick auf ihre Eignung zur Umsetzung des Inklusionsgedankens.
Welche Methode wurde für die empirische Untersuchung verwendet?
Die Arbeit beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die Art der Befragung, den Aufbau des Fragebogens und die Auswahl der Stichprobe. Die Datengewinnung und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die zuvor formulierten Hypothesen interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integration, Inklusion, Elementarbereich, Behinderung, Pädagogik, frühkindliche Bildung, inklusive Pädagogik, empirische Untersuchung, Montessori-Pädagogik, Reggio-Pädagogik, offener Kindergarten, Situationsansatz, Kooperation, Hypothesen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Integrations- und Inklusionskonzepten herauszuarbeiten und deren praktische Umsetzung in frühkindlichen Einrichtungen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Implementierung dieser Konzepte.
Wie werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung verwendet?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden präsentiert, analysiert und in einen theoretischen Kontext gesetzt. Sie werden kritisch bewertet, mögliche Einschränkungen der Studie diskutiert und mit den theoretischen Überlegungen aus den vorhergehenden Kapiteln abgeglichen.
- Quote paper
- Nina Friedmann (Author), 2013, Integration vs. Inklusion im Elementarbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266501