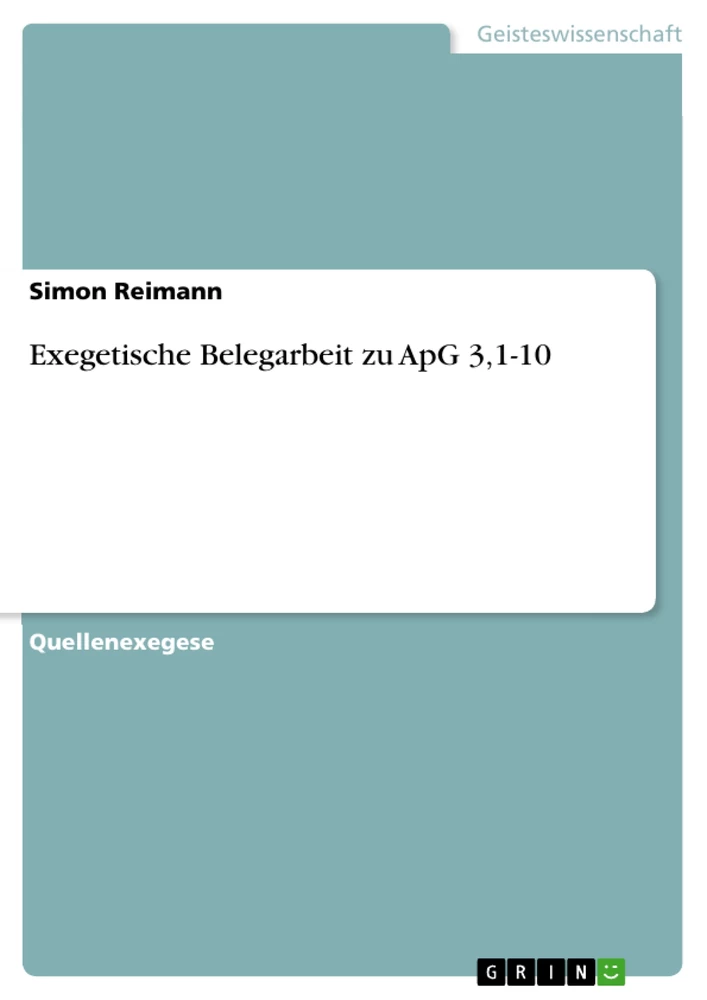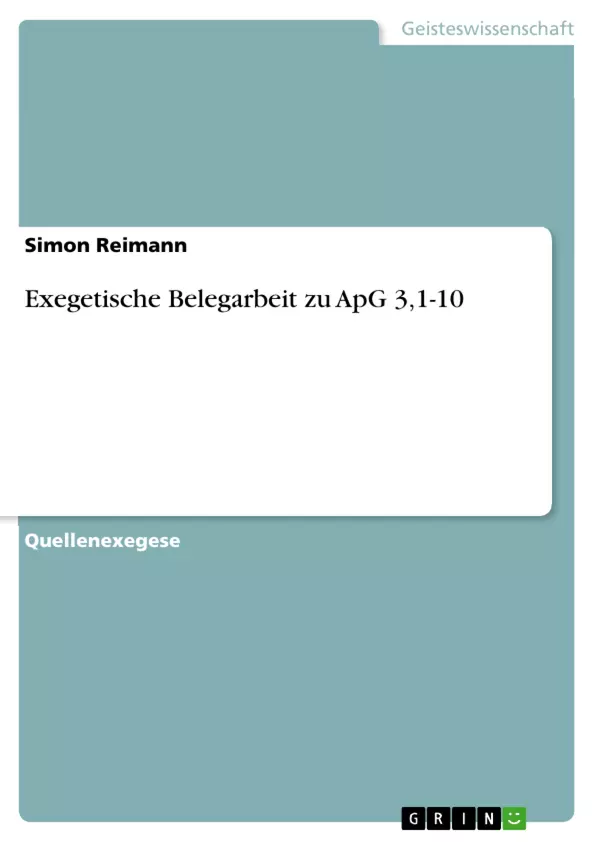Im Lauf der nachfolgenden Arbeit soll die Perikope „Die Heilung des Gelähmten im Tempel“ (ApG 3,1- 10) einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden. Dazu erfolgt zuerst eine Arbeitsübersetzung, deren Intention und Situiertheit in einer kurzen Überlegung dargestellt wird, da es die Übersetzung, für jeden denkbaren Leser in jeder Situation, kaum zu geben scheint. Die Entscheidungen für die Fälle, in denen von den etablierten Übersetzungen abgewichen wurde, werden anschliessend ausgeführt, um die Gedankengänge nachvollziehbar zu machen.
Der Textkritik wird kein eigener Abschnitt gewidmet, dass einzige in diesem Zusammenhang auftretende erwähnenswerte Problem wird im Rahmen der diachronen Betrachtung abgehandelt, da es aufgrund seiner theologischen Implikationen dort am plausibelsten zu erörtern ist. Im Rahmen der synchronen Betrachtung wird versweise vorgegangen, beziehungsweise in der Reihenfolge, in der Personen, Themen und Besonderheiten auftreten. Im Rahmen der diachronen Betrachtung wird von den Themen und Problemen ausgegangen, so dass sich teilweise eine andere Reihenfolge ergibt, welche ehr den thematischen Zusammenhängen folgt.
Der Blick auf Literatur und Forschungsstand liefert ein uneinheitliches Bild. Ausgehend von M. Dibelius war das Bild von Lukas als „Historiker“ in Frage gestellt worden. Hierbei machten sich verschiedene Autoren daran, die Berichte und Erzählungen „kritisch“ zu überprüfen, wobei sie selber anachronistisch vorgingen und die Maßstäbe ihrer Zeit auf Lukas' Arbeitsweise projizierten. Dass dessen Darstellungen jedoch sehr wohl den Regeln des historischen Diskurses seiner Zeit entsprachen, ist eine neuere Entdeckung, die am Ende einer Forschungsgeschichte steht, in deren Verlauf neben dem historischen Wert des lukanischen Doppelwerkes auch dessen Theologie zur Debatte gestellt wurde. Vor allem aufgrund der Unterschiede zwischen dem Paulus der Apostelgeschichte und dem Paulus der Briefe ist Lukas' Werk als „frühkatholizistisch“ verunglimpft worden, „lukanische Theologie“ wurde pejorativ gebraucht. Inzwischen ist sowohl in der Bewertung der Theologie als auch des historischen Wertes des lukanischen Doppelwerkes eine Ebene erreicht worden, die es gestattet, mit einem Augenzwinkern auf den Anfang der Diskussion zurückzublicken: Eines der neuesten Werke zum Thema leiht sich seinen Titel ausgerechnet bei einem Aufsatz von Martin Dibelius aus dem Jahr 1948: „Lukas, der erste christliche Historiker“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Übersetzung der Perikope
- Erläuterungen zur Arbeitsübersetzung
- Die Perikope in synchroner Betrachtung
- Die Perikope in diachroner Betrachtung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Perikope „Die Heilung des Gelähmten im Tempel“ (Apg 3,1-10) eingehend. Zuerst wird eine neue Übersetzung präsentiert und deren Übersetzungsentscheidungen erläutert. Anschließend wird die Perikope synchron und diachron betrachtet, um ihre theologische und historische Bedeutung zu beleuchten.
- Übersetzung und Interpretation der Perikope Apg 3,1-10
- Synchrone und diachrone Textanalyse
- Theologische Implikationen der Heilung
- Vergleich mit parallelen Heilungsberichten im Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte
- Der soziale Kontext der Armut und die Bedeutung von Gemeinschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die eingehende Betrachtung der Perikope Apg 3,1-10. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, die Übersetzung und Erläuterung des Textes, sowie die synchrone und diachrone Analyse. Die Einleitung erwähnt auch den uneinheitlichen Forschungsstand zur Historizität und Theologie des Lukas-Werkes und die randständige Position der Perikope in der Literatur zu Wundererzählungen.
Übersetzung der Perikope: Dieser Abschnitt präsentiert eine neue Übersetzung der Perikope, die eine kommunikativere Sprache als die Lutherbibel von 1984 anstrebt, ohne die Struktur der griechischen Originalsprache zu vernachlässigen. Die Übersetzungsentscheidungen werden im Hinblick auf einen impliziten Schüler der 10. Klasse erläutert, wobei pädagogische und theologische Aspekte berücksichtigt werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der differenzierten Darstellung von Armut, die über die reine materielle Bedürftigkeit hinausgeht.
Erläuterungen zur Arbeitsübersetzung: Hier werden die einzelnen Übersetzungsentscheidungen im Detail erläutert und mit anderen Bibelübersetzungen verglichen. Der Abschnitt diskutiert die Herausforderungen der Übersetzung, den Bedeutungswandel von Wörtern über die Zeit und die Unmöglichkeit einer objektiven, allen Ansprüchen gerecht werdenden Übersetzung. Der Autor reflektiert seine eigene Übersetzungsintention und den Kontext der Vermittlungssituation (Schule).
Die Perikope in synchroner Betrachtung: Dieser Abschnitt analysiert die Perikope anhand ihrer Figuren, Handlung und Struktur. Die zentrale Rolle des Petrus wird hervorgehoben, im Gegensatz zur passiven Rolle des Johannes. Die Beschreibung des gelähmten Mannes wird detailliert untersucht und im Kontext der sozialen Stigmatisierung interpretiert. Der Aufbau der Wundererzählung wird als "typical, novellistic healing story" klassifiziert und die verschiedenen Aspekte der Heilung (körperlich, sozial, spirituell) werden diskutiert.
Die Perikope in diachroner Betrachtung: Dieser Teil untersucht die Entstehungsgeschichte der Perikope und fragt nach ihrer Einbettung in eine vorlukanische Petrustradition. Die Rolle des Johannes wird hinterfragt, und mögliche Gründe für seine Einbeziehung in den Text werden diskutiert. Die Parallelen zur Heilung eines Gelähmten durch Paulus werden analysiert, und die Frage nach der Ursprünglichkeit bestimmter Textpassagen (z.B. "ἔγειρε καὶ") wird erörtert. Der Abschnitt behandelt die theologischen Herausforderungen, die sich aus der Ambivalenz von Wundererzählungen ergeben und untersucht den Gegensatz zwischen christlichen und magischen Praktiken.
Schlüsselwörter
Apostelgeschichte, Petrus, Heilungswunder, Lähmung, Armut, soziale Ausgrenzung, Gemeinschaft, Übersetzung, Textkritik, synchrone und diachrone Analyse, lukanische Theologie, Petrustradition, Parallelen zu Paulus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Heilung des Gelähmten im Tempel (Apg 3,1-10)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Perikope „Die Heilung des Gelähmten im Tempel“ (Apg 3,1-10) aus der Apostelgeschichte. Der Fokus liegt auf Übersetzung, Interpretation und der theologischen sowie historischen Bedeutung des Textes.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine neue Übersetzung der Perikope mit detaillierten Erläuterungen zu den Übersetzungsentscheidungen. Sie beinhaltet eine synchrone Analyse (Betrachtung der Perikope für sich) und eine diachrone Analyse (Betrachtung im historischen Kontext und Entwicklung). Zusätzlich werden die theologischen Implikationen der Heilung, der soziale Kontext der Armut, und Vergleiche mit parallelen Heilungsberichten untersucht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Abschnitten zur Übersetzung, Erläuterungen zur Übersetzung, synchroner und diachroner Betrachtung) und eine Zusammenfassung. Der Hauptteil untersucht die Perikope detailliert, analysiert die Figuren, die Handlung und die Struktur des Textes und beleuchtet die Entstehungsgeschichte sowie die Einbettung in die lukanische und petrinische Tradition.
Welche Übersetzung wird verwendet und warum?
Die Arbeit präsentiert eine neue Übersetzung der Perikope, die eine kommunikativere Sprache anstrebt, als die Lutherbibel von 1984, ohne die Struktur des griechischen Originals zu vernachlässigen. Die Übersetzungsentscheidungen werden detailliert erläutert und im Hinblick auf einen impliziten Schüler der 10. Klasse erklärt, wobei pädagogische und theologische Aspekte berücksichtigt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der differenzierten Darstellung von Armut.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet Methoden der Textanalyse, sowohl synchron als auch diachron. Die synchrone Analyse untersucht die Struktur, Figuren und Handlung der Perikope. Die diachrone Analyse betrachtet den Text im Kontext seiner Entstehungsgeschichte und seiner Einbettung in die lukanische und petrinische Tradition. Vergleiche mit parallelen Texten werden ebenfalls durchgeführt.
Welche zentralen Themen werden diskutiert?
Zentrale Themen sind die Übersetzung und Interpretation der Perikope, die synchrone und diachrone Textanalyse, die theologischen Implikationen der Heilung, der soziale Kontext von Armut und Ausgrenzung, die Rolle von Petrus und Johannes, und Vergleiche mit anderen Heilungsberichten im Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse der synchronen und diachronen Analysen zusammen und diskutiert die Bedeutung der Perikope im Kontext der lukanischen Theologie und der petrinischen Tradition. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Übersetzung und Interpretation biblischer Texte und den Wert einer differenzierten Betrachtung des sozialen Kontextes.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für die Exegese der Apostelgeschichte, die lukanische Theologie und die Interpretation von Heilungswundern interessieren. Der didaktische Ansatz der Übersetzungserläuterungen macht sie auch für Studierende und Lehrkräfte im Bereich Bibelkunde geeignet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Apostelgeschichte, Petrus, Heilungswunder, Lähmung, Armut, soziale Ausgrenzung, Gemeinschaft, Übersetzung, Textkritik, synchrone und diachrone Analyse, lukanische Theologie, Petrustradition, Parallelen zu Paulus.
- Quote paper
- M. A. Simon Reimann (Author), 2013, Exegetische Belegarbeit zu ApG 3,1-10, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266456