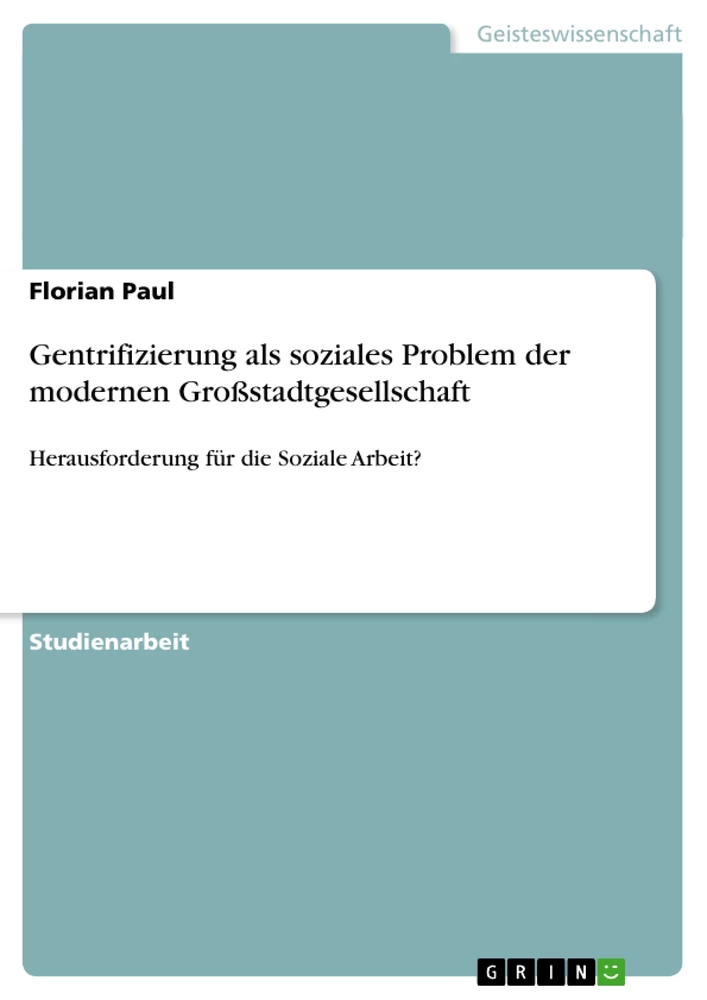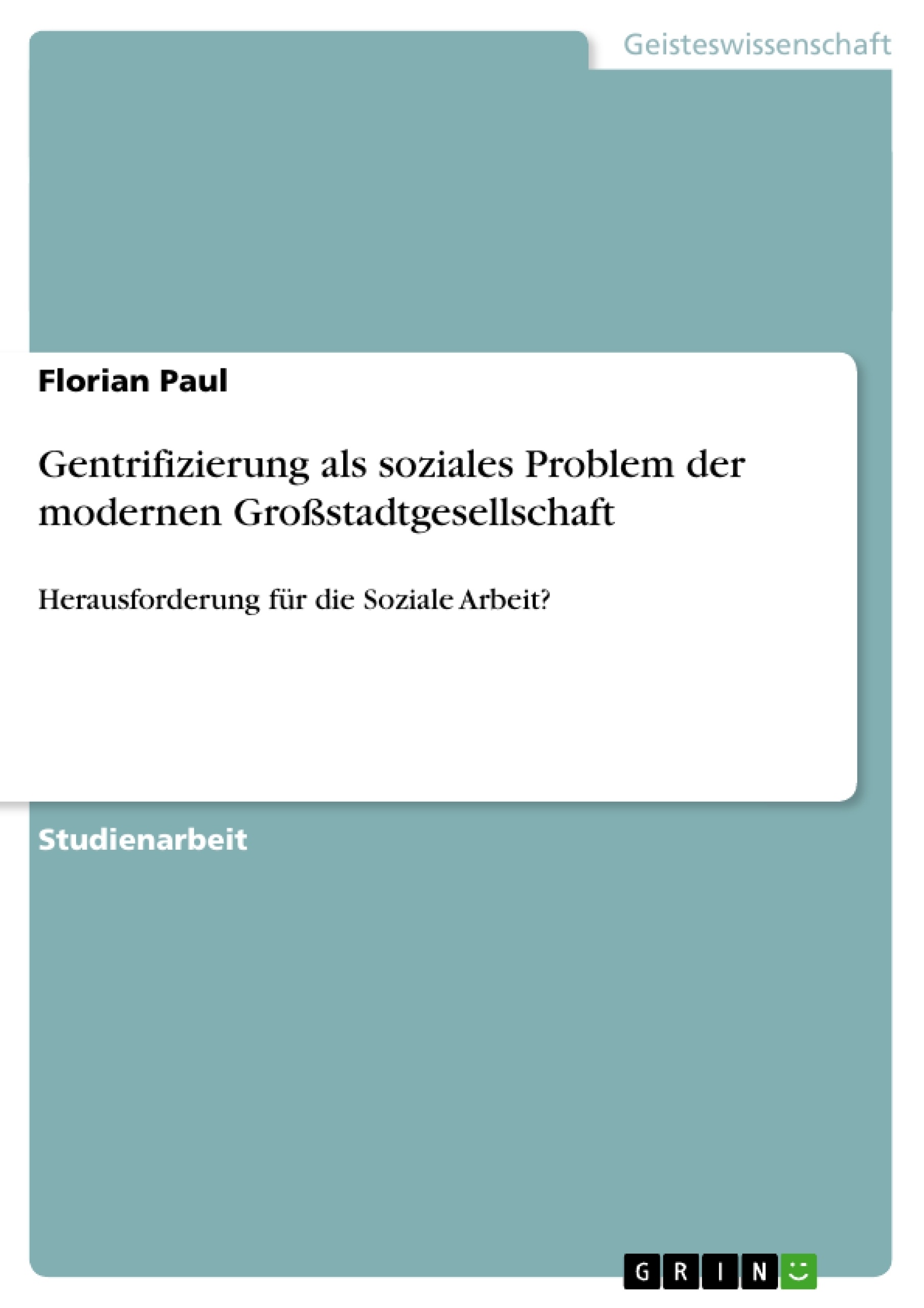Ausgehend von der historischen Bedeutung soll dargestellt werden, was unter dem eher abstrakten Begriff der "Gentrifizierung" überhaupt zu verstehen ist bzw. welche begrifflichen Unterscheidungen möglich sind. Im Anschluss wird darauf eingegangen, wie es zu Gentrifizierung kommen kann, ob es legitim ist, von einer Verlaufstypologie zu sprechen und welche gesellschaftlichen Folgen sich daraus ergeben. Abschließend werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des politischen und sozialen Umgangs mit dem Problem betrachtet, wie dies bearbeitet werden kann und wird und welche bzw. ob die Soziale Arbeit eine Rolle dabei spielen sollte.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Phänomen Gentrifizierung
2.1 Gentrifizierung und (soziale) Segregation
2.2 Definition von Gentrifizierung
3. Erklärungsansätze der Gentrifizierung
3.1 Der ökonomische Erklärungsansatz
3.2 Der politische Erklärungsansatz
3.3 Erklärungsansatz des urbanen gesellschaftlichen Wandels
4. Typologie des Verlaufs und Folgen
4.1 Typischer Verlauf von Gentrifizierung
4.2 Folgen der Gentrifizierung
5. Rolle der Sozialen Arbeit bei der Problembearbeitung
6. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Als großstädtisches[1] Thema ist Gentrifizierung in den letzten Jahren verstärkt in die öffentliche Aufmerksamkeit vorgedrungen, meist über die mediale Darstellung von Widerstandshandlungen gegen städtebauliche Maßnahmen bzw. Veränderungen in einem Viertel bzw. Quartier. So beschrieb die Nürnberger Zeitung zuletzt am 17.01.2013 unter dem Titel "Gostenhofer Bewohner leiden unter Schmierereien" eine Folge von Gentrifizierungsprozessen so, dass "immer wieder neue Häuser in Gostenhof mit Farbbeuteln beworfen und frisch getünchte Fassaden mit Graffiti beschmiert [werden]. Mit Sprüchen gegen 'Bonzen' oder 'Yuppies' und 'teure Mieten'. Die Täter wehren sich gegen die Aufwertung des Stadtteils."[2] Ob durch eine solche mediale Darstellung und die einseitige Kriminalisierung dieser Form des Widerstandes das Problem in seinen Auswirkungen und Folgen umfassend und angemessen dargestellt wird, soll im Laufe dieser Arbeit noch geklärt werden. Auch das Curt-Magazin empfahl bereits 2009, "Liebe Yuppies und Hipster, so wie ich es erst neulich einem von Euch sagte: [...] frisst doch nen Haufen Hundescheisse (und verpisst Euch aus Gostenhof), ha."[3]
Nicht nur durch diese beiden exemplarischen Artikel ist erkennbar, dass Gentrifizierung mittlerweile auch in der Großstadt Nürnberg[4] als soziales Problem angekommen ist, oft auch für das Klientel der Sozialen Arbeit als unmittelbar davon Betroffene. Allein eine Suchabfrage in der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung ergibt für den Begriff "Gentrifizierung" nur für das Jahr 2013 bereits dreizehn Treffer[5], "Google-News" liefert knapp 4000 Treffer[6] und die Verlaufskurve des Google eigenen Statistiktools "Trends" geht seit 2007 ebenfalls steil nach oben.[7] Mit der Thematisierung durch ver.di ist das Problem beispielweise auch bei einer der größten deutschen Gewerkschaften angekommen: "Explodierende Mieten und die unsoziale Arbeits- & Sozialpolitik Berlins bedrohen unsere Existenz. [...] Aber es geht hier nicht nur um die direkt Betroffenen. Heute geht es um die Stadt von Morgen und ob diese nur für Reiche bezahlbar sein wird."[8] Alles zumindest Indikatoren für eine Relevanz der Thematik und damit auch ein Merkmal für die Definition als "soziales Problem".[9] Um der Komplexität der Thematik für die Soziale Arbeit aber gerecht werden zu können und das Problem nicht nur auf Farbbeutel werfende "Chaoten" zu reduzieren, bedarf es einer umfassenderen Betrachtung, als ich sie den eingangs zitierten Artikeln zuerkennen will. Walter Siebel (2010) spricht in seinem Aufsatz über die Zukunft der Städte davon, dass sich soziale Spaltungen in den Städten aktuell zusehends vertiefen, der Zusammenhalt der Stadtgesellschaft immer öfter in Frage gestellt bzw. einer Bewährungsprobe ausgesetzt wird und Städte Gefahr laufen, zu einem "Ort der Ausgrenzung zu werden" (ebd., S. 3f).In wie weit das Phänomen der "Gentrifizierung" bei dieser Feststellung eine Rolle spielt bzw. welche soll Inhalt dieser Arbeit sein.
Ausgehend von der historischen Bedeutung soll daher im Folgenden dargestellt werden, was unter dem eher abstrakten Begriff der "Gentrifizierung" überhaupt zu verstehen ist bzw. welche begrifflichen Unterscheidungen möglich sind. Im Anschluss werde ich darauf eingehen, wie es zu Gentrifizierung kommen kann, ob es legitim ist, von einer Verlaufstypologie zu sprechen und welche gesellschaftlichen Folgen sich daraus ergeben. Abschließend werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des politischen und sozialen Umgangs mit dem Problem betrachtet, wie dies bearbeitet werden kann und wird und welche bzw. ob die Soziale Arbeit eine Rolle dabei spielen sollte.
2. Das Phänomen Gentrifizierung
Der Begriff der Gentrifizierung kann bis in das 18. Jahrhundert zurück verfolgt werden, wo die "Gentry", der Landadel niederen Standes, wieder verstärkt in die Städte zurück migrierte (Holm 2012, S. 662). Darunter zu verstehen ist also allgemein ein Prozess der "Reurbanisierung"[10] nach einer vorangegangen "Suburbanisierung"[11] (Stadtflucht). In der Neuzeit wurde Gentrifizierung als Begriff erstmals 1964 von der britischen Geografin Ruth Glass genutzt, die in ihren Schilderungen von Veränderungen in einem Londoner Stadtteil bereits von Aufwertungsprozessen sprach und diese als "Gentrification" beschrieb (ebd., S. 661). "Wesentliche Merkmale dieser frühen Gentrification-Beschreibung sind die ökonomische und bauliche Aufwertung heruntergewirtschafteter Häuser und ein durch Bevölkerungsaustausch ausgelöster Wandel des sozialen Charakters der Nachbarschaft" (ebd.). Zunächst lohnt es sich meines Erachtens aber, sich bei der Suche nach einem Verständnis von Gentrifizierung kurz mit dem stadtsoziologischen Begriff der Segregation[12] zu beschäftigen, um Gentrifizierung auch in diesem Kontext verorten zu können.
2.1 Gentrifizierung und (soziale) Segregation
Hartmut Häusermann[13] und Walter Siebel[14] (2004) sprechen hier zunächst davon, dass eine Stadt immer einen Sozialraum bildet. Als Ergebnis komplexer Prozesse beanspruchen bestimmte soziale Gruppen und Milieus einer Stadt in dieser Stadt einen Ort für sich oder bekommen diesen zugewiesen (ebd., S. 140), wobei dabei wiederum unterschiedliche Aspekte und Prozesse eine Rolle spielen.[15] In der Folge sind die einzelnen Gruppen nicht gleichmäßig über eine Stadt verteilt, sondern mehr oder weniger stark in bestimmen Vierteln oder Quartieren konzentriert. "Man bezeichnet diese Struktur als 'residentielle' oder 'soziale' Segregation" (ebd.).
Diese Tatsache erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung meist als negativ, denkt man an die damit verbunden Eigenschaften, wenn von Glasscherbenvierteln, sozialen Brennpunkten oder ähnlichem gesprochen wird, obwohl lediglich Stadtteile mit Bewohnern/innen mit niedrigen Einkommen, Bildungsstand, klassische Arbeiterviertel oder von Migranten/innen geprägte Quartiere bzw. Kombinationen aus diesen und weiteren Eigenschaften gemeint sind. Stadtpolitisch wird daher meist das Leitbild "soziale Mischung" angestrebt, obwohl dies, wie Häusermann betont "keineswegs in jeder Hinsicht und in jedem Falle eine positive Orientierung [liefert]" (ebd., S. 146), denn die bedeutendste Leistung der Stadt war eigentlich immer, dass verschiedenste Gruppierungen auf engem Raum friedlich zusammen leben konnten (ebd., S. 139), unabhängig von Überlegungen zur sozialen Mischung.
Der Sozialraum der Stadt ist also nicht nur verantwortlich für die Lebenschancen seiner Bewohner/innen, "insofern sie vom Wohnstandort beeinflusst werden" (ebd., S. 140) - ein klassischer Aspekt u.a. der Gemeinwesenarbeit - sondern auch ein Garant für sozialen Frieden. Gerade die Wohnungsfrage ist dabei maßgeblich für gewachsene Quartiere mit verantwortlich und die "soziale Prägung von Quartieren ist das Ergebnis von teilweise weit zurück liegenden Entscheidungen" (ebd., S.155). Diese Tatsache ist nicht für die Betrachtung eines "Jetzt"- Zustandes relevant, sondern vielmehr und insbesondere für eine städteplanerischen "Soll"- Zustand. Wird ein über Jahre gewachsenes Stadtviertel in Frage gestellt, ist eine mögliche Reaktion der Betroffenen unter anderem auch die bereits in der Einleitung erwähnten Farbbeutel, sofern sie die Gefahr sehen - neben allen anderen Problemen - auch noch aus ihrem Sozialraum vertrieben zu werden. Der Prozess der Gentrifizierung kann - das wird im weiteren Verlauf noch deutlich werden - den Grundsatz des friedlichen Zusammenlebens also radikal und nachhaltig in Frage stellen und ist deswegen dazu geeignet, den sozialen Frieden in Städten zu zerstören.
Gentrifizierung ist folglich auch als Prozess zu verstehen, in dem aus einem segregierten Viertel der Kategorie A über einen bestimmten Zeitraum ein abschließend segregiertes Viertel der Kategorie B wird, und während dessen Verlauf das bereits erwähnte Leitbild der "sozialen Mischung" zum Nachteil ohnehin bereits benachteiligter Bevölkerungsgruppen (Kategorie A) zu Gunsten bereits privilegierter (Kategorie B) überschritten wird. Das Ergebnis sind dann "exklusive Räume" (ebd., S. 140), die aufgrund ihres Charakters - Häusermann spricht hier von "ökonomischen und symbolischen Barrieren" (ebd.) - nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen zugänglich sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Einordung der Gentrifizierung im Segregationsdiskurs (eigene Darstellung)
Damit sollte klar geworden sein, wo Gentrifizierung in dem Segregationsdiskurs für die Soziale Arbeit sinnvoll verortet werden kann. Die Definition des Begriffs "Gentrifizierung" ist allerdings dennoch etwas komplexer, als diese bisherigen grundsätzlichen Überlegungen und Beschreibung zunächst vermuten lassen. Dies soll im Weiteren näher betrachtet werden.
[...]
[1] Unter dem Begriff "Großstadt" werden Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern definiert. http://www.duden.de/rechtschreibung/Groszstadt [zuletzt aufgerufen am 31.03.2013].
[2] http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/gostenhofs-bewohner-leiden-unter-schmierereien-1.2634210?searched=true [zuletzt aufgerufen am 31.03.2013].
[3] http://www.curt.de/nbg/content/view/1951/87/ [zuletzt aufgerufen am 31.03.2013].
[4] Die verfügbare Fachliteratur bezieht sich meist auf die Stadtstaaten Hamburg und Berlin oder auch internationale Großstädte wie New York. Es wird aber dennoch darauf verwiesen, dass dies nur exemplarisch erfolgt und mittlerweile immer mehr deutsche Großstädte davon betroffen sind. Siehe u. a. bei Twickel, 2010, S. 102.
[5] http://suche.sueddeutsche.de/query/Gentrifizierung/sort/-docdatetime [zuletzt aufgerufen am 31.03.2013].
[6] http://news.google.de/ [zuletzt aufgerufen am 31.03.2013].
[7] http://www.google.de/trends/explore#q=Gentrifizierung [zuletzt aufgerufen am 31.03.2013].
[8] http://erwerbslose.berlin.verdi.de/kampagnen-aktionen/2013_maerz_16-mietendemo/data/Demoflyer.pdf [zuletzt aufgerufen am 02.04.2013].
[9] Um Probleme als "soziale Probleme" definieren zu können, müssen diese mindestens "sozial verursacht sein, die sozialen Bedingungen einer größeren Gruppe bzw. Kategorie von Menschen beeinträchtigen und öffentlich als veränderungsbedürftig definiert werden" (Garhammer 2013, S. 12).
[10] "Jüngste Entwicklungsphase von Verdichtungsräumen (=Ballungsräumen, Anmerkung d. Verfassers), die durch eine Zunahme des Kernstadtanteils von Bevölkerung und Beschäftigung bei entsprechender Abnahme oder Stagnation im Umland gekennzeichnet ist." http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/reurbanisierung.html [zuletzt aufgerufen am 02.04.2013].
[11] "[...]die aus der Stadtflucht resultierende Expansion der Städte in ihr Umfeld und die damit einhergehende intraregionale Verschiebung des Wachstumsschwerpunktes aus dem Kernbereich einer Stadt (Zentrum) in das städtische Umland bzw. den suburbanen Raum (Suburbia)." http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/suburbanisierung.html [zuletzt aufgerufen am 02.04.2013].
[12] Mit Segregation wird die "Konzentration bestimmter sozialer Gruppen auf bestimmte Teilräume einer Stadt oder Stadtregion gemessen" (Häusermann et. al., 2004, S. 140f).
[13] Zuletzt Professor am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin.
[14] Professor für Soziologie an der Universität Oldenburg.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gentrifizierung laut diesem Text?
Gentrifizierung wird als ein Prozess der "Reurbanisierung" nach einer vorangegangenen "Suburbanisierung" (Stadtflucht) verstanden. Es ist ein Prozess, bei dem einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden, während gleichzeitig eine Aufwertung des Viertels stattfindet.
Woher stammt der Begriff "Gentrifizierung"?
Der Begriff kann bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt werden, als der Landadel niederen Standes ("Gentry") wieder verstärkt in die Städte zog. In der Neuzeit wurde er erstmals 1964 von der britischen Geografin Ruth Glass verwendet.
Wie hängt Gentrifizierung mit Segregation zusammen?
Gentrifizierung wird als ein Prozess verstanden, in dem aus einem segregierten Viertel der Kategorie A (z.B. einkommensschwach) über einen bestimmten Zeitraum ein segregiertes Viertel der Kategorie B (z.B. einkommensstark) wird. Dieser Vorgang kann den sozialen Frieden in Städten stören.
Was ist "soziale Mischung" und welche Rolle spielt sie bei der Gentrifizierung?
"Soziale Mischung" ist ein stadtpolitisches Leitbild, das angestrebt wird, um homogene Wohnquartiere aufzubrechen und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen. Der Text argumentiert, dass eine übertriebene Fokussierung auf soziale Mischung problematisch sein kann, da sie zu einer Verdrängung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen durch Gentrifizierung führen kann.
Welche Folgen kann Gentrifizierung haben?
Gentrifizierung kann zu einer Verdrängung von angestammten Bewohnern führen, den sozialen Frieden stören und "exklusive Räume" schaffen, die nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen zugänglich sind.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der Gentrifizierung laut der Inhaltsangabe?
Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Problembearbeitung im Zusammenhang mit Gentrifizierung wird untersucht. Wie die Soziale Arbeit mit den Folgen von Gentrifizierung umgehen kann und soll ist eine zentrale Frage.
Welche Themen werden in dem Text behandelt?
Der Text behandelt die Definition von Gentrifizierung, Erklärungsansätze, typische Verläufe und Folgen, die Rolle der Sozialen Arbeit und ein Fazit.
Welche Medienberichte werden in der Einleitung erwähnt?
Die Einleitung erwähnt einen Artikel in der Nürnberger Zeitung über Schmierereien in Gostenhof und einen Kommentar im Curt-Magazin.
Welche Suchanfragen und Statistiken werden zur Relevanz von Gentrifizierung genannt?
Es werden Suchabfragen in der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, Google-News und das Google Statistiktool "Trends" genannt, um die zunehmende Relevanz des Themas Gentrifizierung zu verdeutlichen.
Wer sind Hartmut Häusermann und Walter Siebel?
Hartmut Häusermann war Professor am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Walter Siebel ist Professor für Soziologie an der Universität Oldenburg. Beide werden im Zusammenhang mit der stadtsoziologischen Betrachtung von Segregation erwähnt.
- Quote paper
- Sozialarbeiter B.A. Florian Paul (Author), 2013, Gentrifizierung als soziales Problem der modernen Großstadtgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266194