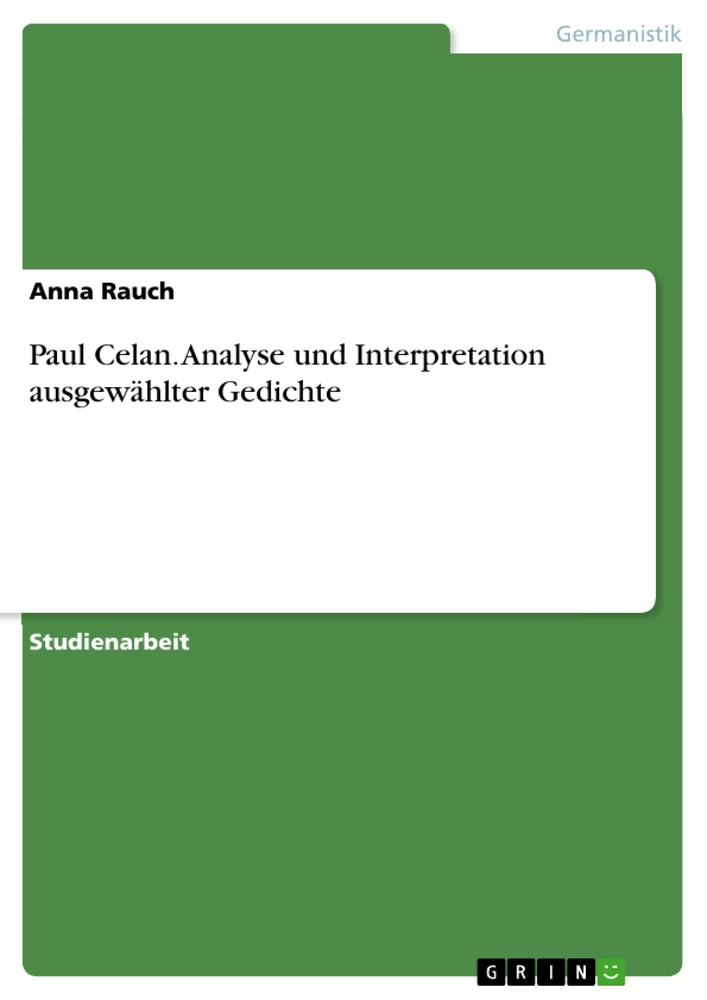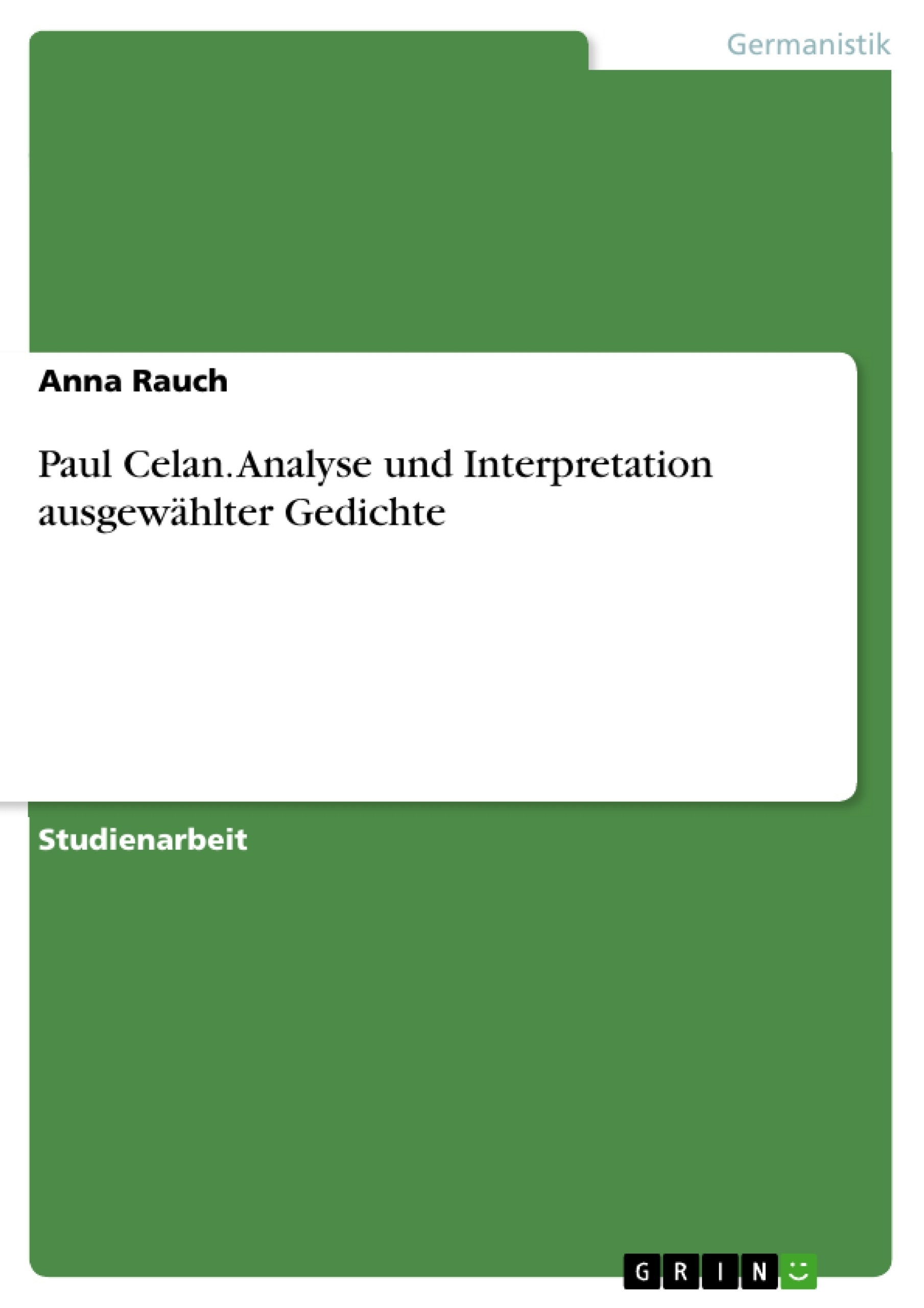„Sich auf das Lebens-Werk Paul Celans einzulassen, ist ein schwieriges
Unterfangen. Aus Finsternis und Verwunderung schuf er frappierende Gedichte,
die die Wege unserer Welt in Frage stellen.“1
Die Lyrik Paul Celans ist heutzutage weitreichend bekannt und Celan selbst gehört zu den meist bekannten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Seine Lyrik bezeugt das Leid und die Tragödie des Holocaust, gedenkt den Opfern des
Faschismus und fordert zur Erinnerung auf: Aufarbeitung der Vergangenheit und das Übertragen dieser in die Gegenwart wird zur Hauptaufgabe seiner Poesie. In seiner Lyrik versucht er dies auf vielschichtige Weise zu reflektieren, wobei er immer wieder auf die Hürde der Sprachlosigkeit trifft. Die Begebenheiten, die sich in den Gaskammern vollzogen haben, rauben ihm die Sprache, jene deutsche Sprache, die beim Mord an Millionen als Organisations- und Propagandamedium genutzt wurde.
Seine Poesie, die als symbolistische Lyrik beginnt und sich zur surrealistischen Lyrik weiterentwickelt, zeigt die Kunst des Umgangs mit Sprache auf, obwohl diese mehr verschlüsselt als enthüllt und erst im zeitgenössischen Kontext aufgearbeitet und interpretiert werden kann. Seine Dichtung zeigt trotz verwendeter Chiffren, Neologismen, Metaphern und Zusammenfügen des eigentlich nicht Zusammenpassenden eine Präzision im Ausdruck und in der Kunst und überwindet somit die Sprachskepsis.2
Diese Einzigartigkeit des lyrischen Umgangs mit Sprache und Vergangenheitsbewältigung zeigt die nachfolgende Seminararbeit durch die Analyse zweier ausgewählter Gedichte auf. „Corona“ und „Tenebrae“ stammen aus zwei verschiedenen Gedichtbänden und Schaffensphasen im Werk Paul Celans und
zeigen demzufolge verschiedenste Eigenheiten seiner Lyrik auf.
Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist vor allem welche unterschiedlichen Interpretationsansätze im zeitgenössischen, sowie biographischen Kontext auf die Gedichte angewandt werden kann. Demzufolge ist es wichtig, die Arbeit mit biographisch wichtigen Elementen Celans einzuleiten, um die Eigenheiten der anschließenden Lyrik deutlicher hervorzubringen und das Verständnis zu fördern.
Gewählt wurden zwei unterschiedliche Gedichte, sei es inhaltlich als auch im literarischen Ton. Ziel ist aber nicht einen Vergleich im konkreten Sinne anzustellen, sondern zwei verschiedene Facetten des literarischen Werks Celans herauszukristallisieren, die die Thematik der Vergangenheitsbewältigung des Holocaust auf unterschiedlichste Weise bearbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie: Paul Antschel alias Paul Celan
- „Corona" (aus: Mohn und Gedächtnis)
- Allgemeine Informationen zum Gedichtband
- Analyse und Interpretation
- Ingeborg Bachmann und Paul Celan
- „Tenebrae" (aus: Sprachgitter)
- Allgemeine Informationen zum Gedichtband
- Analyse und Interpretation
- Schlusswort
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert und interpretiert zwei ausgewählte Gedichte von Paul Celan, „Corona" und „Tenebrae", um die vielschichtigen Aspekte seiner Lyrik und insbesondere die Verarbeitung des Holocaust in seinem Werk aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Interpretationsansätze im zeitgenössischen und biographischen Kontext und beleuchtet die Eigenheiten der celan'schen Sprache und ihrer Bedeutung für die Vergangenheitsbewältigung.
- Verarbeitung des Holocaust und die Erinnerung an die Toten
- Sprachlosigkeit und die Kunst des Umgangs mit Sprache
- Die Bedeutung der Liebe und ihre Verbindung mit dem Tod
- Die Rolle der Zeit und ihre Verarbeitung in Celans Lyrik
- Die Beziehung zwischen Celan und Ingeborg Bachmann und deren Einfluss auf sein Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Lebenswerk Paul Celans ein und erläutert die Bedeutung seiner Lyrik für die Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse zweier Gedichte, „Corona" aus dem Band „Mohn und Gedächtnis" und „Tenebrae" aus dem Band „Sprachgitter", die unterschiedliche Facetten von Celans Lyrik repräsentieren. Die Biographie Paul Celans beleuchtet die prägenden Ereignisse seines Lebens, die seine Lyrik maßgeblich beeinflusst haben, wie seine Erfahrungen während des Holocaust und seine Beziehung zu Ingeborg Bachmann.
Die Analyse von „Corona" zeigt die Verwendung von Chiffren und Metaphern, die auf die Verarbeitung des Holocaust und die Erinnerung an die Toten verweisen. Das Gedicht verbindet die Themen Liebe und Tod und stellt die Zeit als zentralen Faktor für die Bewältigung der Vergangenheit dar. Die Beziehung zu Ingeborg Bachmann wird in diesem Zusammenhang beleuchtet und die Bedeutung des Gedichtes für die Interpretation ihrer Beziehung wird hervorgehoben.
Die Analyse von „Tenebrae" fokussiert auf die Sprachlosigkeit und die Dunkelheit, die Celans Werk in dieser Phase prägen. Das Gedicht stellt das Verhältnis zwischen dem Lyrischen Ich und dem „Herrn" in den Mittelpunkt und arbeitet mit religiösen Motiven, die auf die Leidensgeschichte der Juden im Holocaust verweisen. Die Interpretation des Gedichts beleuchtet die Vielschichtigkeit der Sprache und die Bedeutung des Schweigens für die Verarbeitung der Vergangenheit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Paul Celan, Lyrik, Holocaust, Vergangenheitsbewältigung, Sprachlosigkeit, Erinnerung, Liebe, Tod, Zeit, Ingeborg Bachmann, "Corona", "Tenebrae", "Mohn und Gedächtnis", "Sprachgitter", Chiffren, Metaphern, Interpretation, Analyse, Biographie, "Herr", "Wir", "Nah", "Blut", "Bild", "Tenebrae", "Dunkles", "Geschlecht", "Corona".
- Quote paper
- Anna Rauch (Author), 2011, Paul Celan. Analyse und Interpretation ausgewählter Gedichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266058