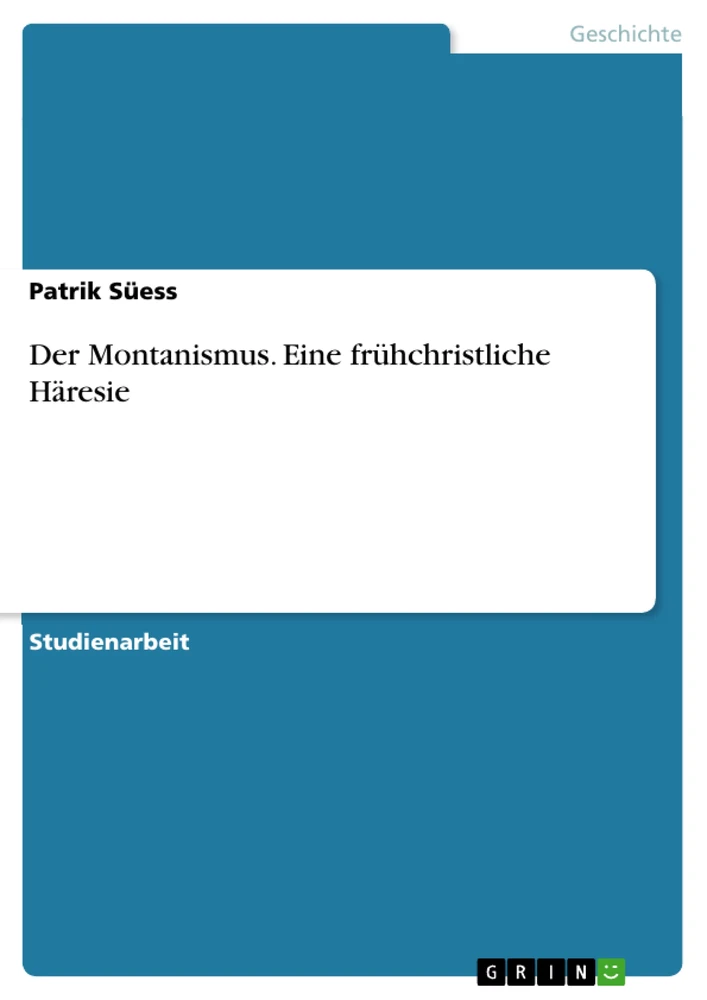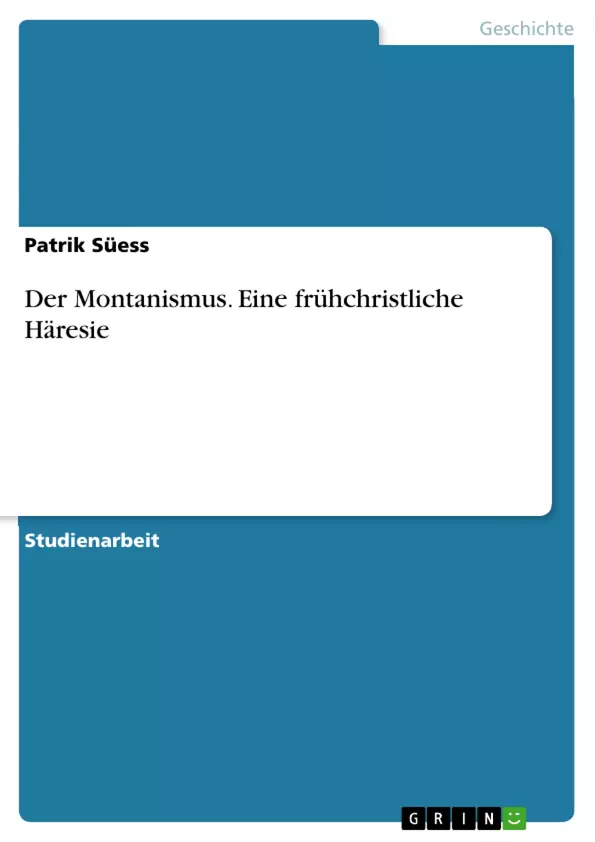Bei der Beschäftigung mit dem Montanismus beginnen die Streitfragen und die Unklarheiten bereits mit der Definition dessen, worüber gesprochen werden soll. Handelt es sich bei der Bewegung des Montanismus um eine frühchristliche häretische Strömung, also um eine Irrlehre? Und was kann Irrlehre heissen in einer Zeit, in der von Orthodoxie nur sehr vorsichtig, sozusagen in Anführungsstrichen gesprochen werden kann? Oder haben wir es vielmehr mit dem ersten Schisma der entstehenden Kirche zu tun, wie andere annehmen, also mit Differenzen in der Auslegung der grundsätzlich gemeinsam vertretenen Lehren? Diese Fragen können hier zwar nicht beantwortet werden, sollen aber eine Ahnung geben von den Schwierigkeiten, sich auch über grundlegende Fragen, die den Montanismus betreffen, einig zu werden. Es gibt kaum einen zunächst für gesichert gehaltenen Punkt, der nicht irgendwann – trotz des schmalen Umfangs der Literatur, der hier zur Verfügung steht – hinterfragt oder vielmehr bestritten wird.
Lebten die Montanisten in der Erwartung der unmittelbaren Endzeit? Führten sie pagane Elemente in den christlichen Kultus ein? Unterschieden sie sich in ihrer Wertschätzung von Frauen von den anderen (früh-)christlichen Gemeinden? War ekstatische Prophetie im christlichen Kontext üblich oder nicht? Auf einige dieser Fragen werde ich eingehen, doch werde ich mich, was die Hauptpunkte betrifft, auf die gelehrte Mehrheitsmeinung stützen und vor allem die Quellen zu Wort kommen lassen.
Dass die Quellen spärlich und einseitig verfasst sind, brauche ich – gerade angesichts eines solchen Themas – kaum zu erwähnen. Dennoch werde ich versuchen so gut als möglich zu referieren, was es mit diesem Mann namens Montanus und seinen Prophezeiungen auf sich hatte, und welche Unruhe er durch sein Wirken in die noch jungen christlichen Gemeinden brachte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.1 Ein neuer Prophet
- 2.2 Die Lehre
- 2.3 Die Quellen
- 2.4 Geschichte des Montanismus – Die ersten Jahrzehnte
- 2.5 Prophetie und Ekstase
- 2.6 Weitere Kritik der Orthodoxie
- 2.7 Tertullian
- 2.8 Das weibliche Element
- 2.9 Heidnische Einflüsse?
- 2.10 Ausblick
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Montanismus, einer frühchristlichen Bewegung. Ziel ist es, die Bewegung zu beschreiben, ihre Lehre zu erläutern und ihre Bedeutung im Kontext des frühen Christentums zu untersuchen. Dabei werden die Schwierigkeiten bei der Definition und Einordnung des Montanismus thematisiert.
- Die Lehre des Montanismus und ihre Abweichungen von der orthodoxen Lehre.
- Die Rolle von Prophetie und Ekstase im Montanismus.
- Der Einfluss von Montanus, Maximilla und Priscilla auf die Bewegung.
- Die Bedeutung der Orte Pepuza und Tymion.
- Die Quellenlage und die Herausforderungen bei der Interpretation der Quellen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Schwierigkeiten bei der Definition des Montanismus und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor: War der Montanismus eine häretische Strömung oder ein Schisma? Sie hebt die spärliche und einseitige Quellenlage hervor und kündigt den Fokus auf die gelehrte Mehrheitsmeinung an, wobei die Quellen selbst zu Wort kommen sollen. Die Einleitung skizziert die zentralen Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden, wie die Erwartung der Endzeit, den Umgang mit paganen Elementen, die Rolle von Frauen und die Bedeutung ekstatischer Prophetie.
2.1 Ein neuer Prophet: Dieses Kapitel beschreibt den Ursprung des Montanismus mit Montanus als zentrale Figur. Es wird auf seine Anfänge in Phrygien eingegangen, seine Rolle als Prophet und die Bedeutung der Prophetinnen Maximilla und Priscilla. Das Kapitel beleuchtet die anfängliche Fremdzuschreibung der Bezeichnung "Montanismus" und die Selbstbezeichnung der Anhänger als Anhänger der "neuen Prophetie". Die Quellenlage wird kurz kritisch beleuchtet, und der umfassende Anspruch der Bewegung wird dargestellt.
2.2 Die Lehre: Dieses Kapitel beleuchtet die Lehre des Montanismus. Da es keine eigenen schriftlichen Quellen gibt, stützt sich der Autor auf die Berichte der Gegner. Zentrale Punkte sind die Erwartung der nahenden Endzeit, strenge Fastenregeln, sexuelle Enthaltsamkeit und die Akzeptanz des Martyriums. Jedoch bleibt die Frage umstritten, ob die Montanisten eine zeitlich determinierte Erwartung des Weltendes hatten, ob Montanus die Auflösung aller Ehen forderte oder nur die Zweiehe untersagte und ob das willige Ertragen oder das aktive Aufsuchen des Martyriums propagiert wurde. Die Bedeutung der Orte Pepuza und Tymion als "himmlisches Jerusalem" wird ebenfalls erwähnt, wobei die ungeklärte Lage dieser Orte betont wird.
Schlüsselwörter
Montanismus, frühchristliche Häresie, Montanus, Maximilla, Priscilla, Prophetie, Ekstase, Endzeit, Pepuza, Tymion, Orthodoxie, Quellenkritik, Martyrium, Phrygien.
Häufig gestellte Fragen: Seminararbeit zum Montanismus
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Montanismus, einer frühchristlichen Bewegung. Sie beschreibt die Bewegung, erläutert ihre Lehre und untersucht ihre Bedeutung im Kontext des frühen Christentums. Ein besonderer Fokus liegt auf den Schwierigkeiten bei der Definition und Einordnung des Montanismus.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Lehre des Montanismus und ihre Abweichungen von der orthodoxen Lehre, die Rolle von Prophetie und Ekstase, den Einfluss der zentralen Figuren Montanus, Maximilla und Priscilla, die Bedeutung der Orte Pepuza und Tymion, die Quellenlage und die Herausforderungen bei der Interpretation der Quellen.
Welche Fragen werden in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung thematisiert die Schwierigkeiten bei der Definition des Montanismus und stellt die zentralen Fragen: War der Montanismus eine häretische Strömung oder ein Schisma? Sie hebt die spärliche und einseitige Quellenlage hervor und kündigt den Fokus auf die gelehrte Mehrheitsmeinung an, wobei die Quellen selbst zu Wort kommen sollen. Es werden Fragen zur Endzeiterwartung, zum Umgang mit paganen Elementen, zur Rolle von Frauen und zur Bedeutung ekstatischer Prophetie skizziert.
Was wird im Kapitel "Ein neuer Prophet" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Ursprung des Montanismus mit Montanus als zentrale Figur, seine Anfänge in Phrygien, seine Rolle als Prophet und die Bedeutung der Prophetinnen Maximilla und Priscilla. Es beleuchtet die anfängliche Fremdzuschreibung der Bezeichnung "Montanismus" und die Selbstbezeichnung der Anhänger als Anhänger der "neuen Prophetie". Die Quellenlage wird kritisch beleuchtet, und der umfassende Anspruch der Bewegung wird dargestellt.
Womit befasst sich das Kapitel "Die Lehre"?
Das Kapitel beleuchtet die Lehre des Montanismus anhand von Berichten der Gegner, da es keine eigenen schriftlichen Quellen gibt. Zentrale Punkte sind die Erwartung der nahenden Endzeit, strenge Fastenregeln, sexuelle Enthaltsamkeit und die Akzeptanz des Martyriums. Die Interpretation der Lehre bleibt jedoch in einigen Punkten umstritten (z.B. zeitlich determinierte Endzeiterwartung, Montanus' Position zur Ehe, Aktives oder passives Aufsuchen des Martyriums). Die Bedeutung von Pepuza und Tymion als "himmlisches Jerusalem" wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Montanismus, frühchristliche Häresie, Montanus, Maximilla, Priscilla, Prophetie, Ekstase, Endzeit, Pepuza, Tymion, Orthodoxie, Quellenkritik, Martyrium, Phrygien.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit umfasst eine Einleitung, ein Hauptkapitel (unterteilt in mehrere Unterkapitel) und einen Schluss. Die Unterkapitel befassen sich mit einzelnen Aspekten des Montanismus, wie dem neuen Propheten Montanus, der Lehre, den Quellen, der Geschichte, Prophetie und Ekstase, Kritik der Orthodoxie, Tertullian, dem weiblichen Element, heidnischen Einflüssen und einem Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, den Montanismus zu beschreiben, seine Lehre zu erläutern und seine Bedeutung im Kontext des frühen Christentums zu untersuchen. Die Schwierigkeiten bei der Definition und Einordnung des Montanismus werden thematisiert.
- Quote paper
- Patrik Süess (Author), 2008, Der Montanismus. Eine frühchristliche Häresie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265907