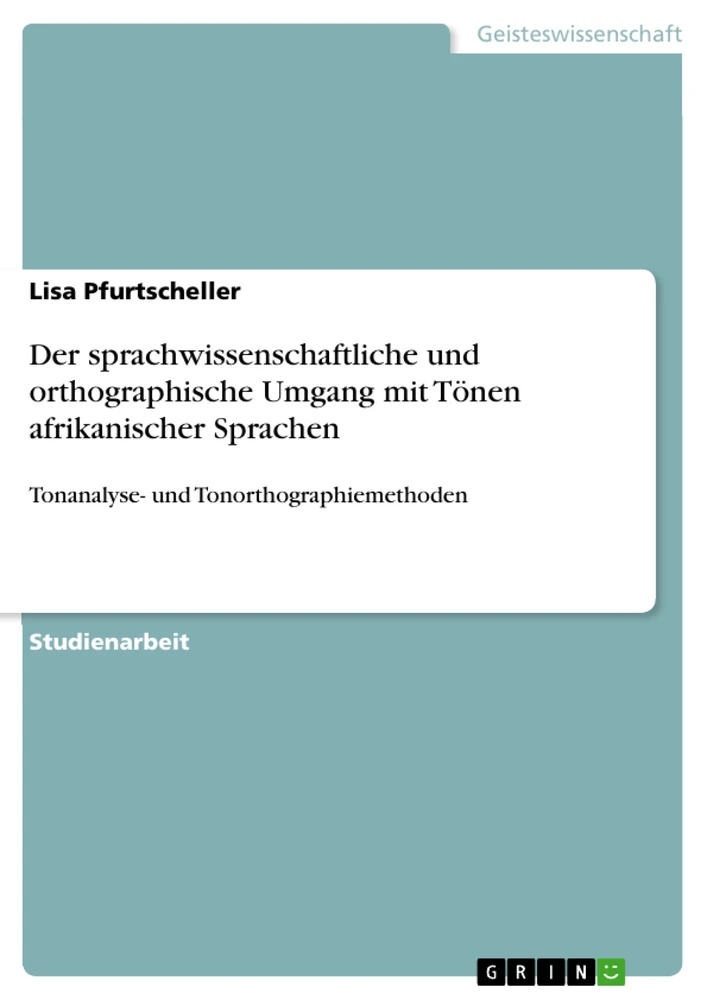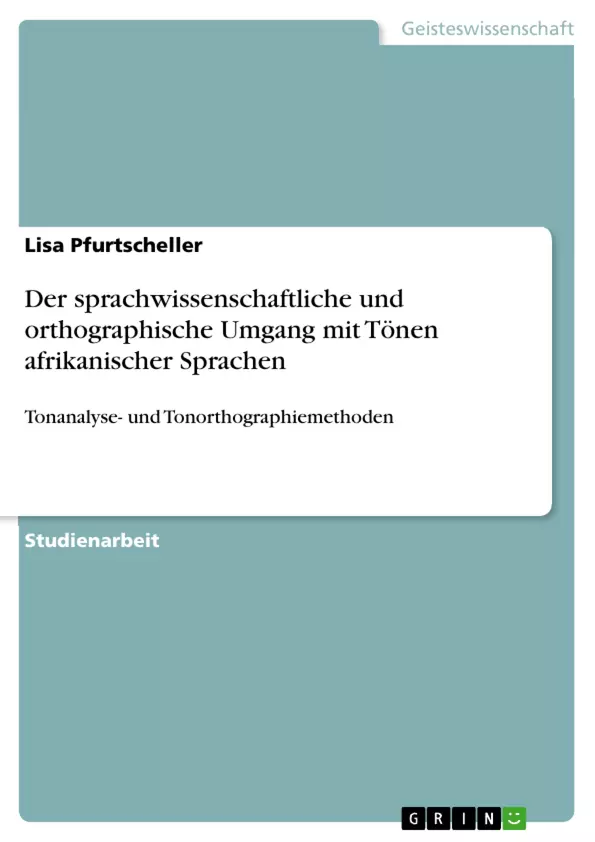Während die Untersuchung von Grammatiken schon seit Jahrtausenden vom Menschen betrieben wird, blieb die Existenz von bedeutungsunterscheidenden Tönen in afrikanischen Sprache bis vor einigen Jahrhunderten unentdeckt, und war vor dem zwanzigsten Jahrhundert noch überhaupt nicht in das Bewusstsein der meisten Sprachwissenschaftler vorgedrungen. Ein Grund dafür lag wohl darin, dass es lange keine Möglichkeit der Sprachaufzeichnung gab. Als dann aufgenommen wurde, ist die Tonhöhe nicht bewusst wahrgenommen worden. Das ist wohl darauf zurückzuführen, dass Tonmelodien in Sprachen für europäische Sprachwissenschaftler etwas völlig Neues darstellten, denn während nach Verben, Nomen, Nebensätzen etc. stets „gesucht“ werden konnte, da diese ja in der Muttersprache des Linguisten existierten, stolperte man sozusagen über „Töne“, die auf Grund mangelnder oder gar nicht existierender Sensibilisierung für dieses Phänomen nicht als solche wahrgenommen, sondern als „Akzente“ oder „Intonationstöne“ fehlinterpretiert wurden. Somit mangelte es nicht nur der Kenntnis über die Existenz von Tönen schlechthin, sondern auch jedweder Methoden, um diese zu analysieren, zu repräsentieren und schlussendlich in der Orthographie zu verankern. Noch heute herrscht keine weltweit angewandte Methode zur Analyse von Tonsystemen, und auch die Orthographie unterscheidet sich von Sprache zu Sprache, wobei in vielen afrikanischen Sprachen dem Ton für die Orthographie sowohl in den Werken der Sprachwissenschaftler, als auch für die Alltagsverwendung der einheimischen Bevölkerung in vielen Fällen noch nicht ausreichend Bedeutung beigemessen wird.
In der vorliegenden Arbeit soll zunächst ein Abriss der Tonforschung im Hausa beschrieben werden, bevor die Geschichte der Tonanalyse zum zentralen Thema der Arbeit wird. Es folgt ein Kapitel über die Repräsentation der Töne in afrikanischen Sprachen.
Dazu muss gesagt werden, dass viele Publikationen existieren, die in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden konnten, weswegen das gesammelte Material zwar umfangreich ist, nicht jedoch den gesamten aktuellen Forschungsstand widerzuspiegeln vermag.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte der Tonbeschreibung im Hausa
- 3. Geschichte der Tonanalyse
- 3.1. Einleitung
- 3.2. Deskriptive Analysen
- 3.2.1. Christaller, 1893
- 3.2.2. Westermann, 1905
- 3.2.3. Roehl & Nekes, 1911
- 3.2.4. Ittmann, 1939
- 3.2.5. Weitere deskriptive Tonanalysen
- 3.3. Theoretische Analysen
- 3.3.1. Pike, 1948
- 3.3.2. Williams, 1971
- 3.3.3. Goldsmith, 1976
- 3.3.4. Halle und Vergnaud, 1982
- 3.3.5. Pulleyblank, 1986
- 3.3.6. Snider, 1988
- 3.3.7. Yip, Hyman, Clark- 1993
- 3.3.8. Cassimjee, 1998
- 4. Repräsentation von Tönen in Grammatiken
- 4.1. Einleitung
- 4.2. Christaller, 1893 & Ittmann, 1939
- 4.3. Ida Ward, 1933
- 4.4. Kenneth Pike, 1948
- 4.5. John Bendor Samuel, 1974
- 4.6. Neuere Erscheinungen
- 5. Repräsentation von Tönen in der Orthographie
- 5.1. Einleitung
- 5.2. Die Notwendigkeit der Tonorthographie
- 5.3. Von der Tonanalyse zur Orthographie
- 5.4. Diakritische Zeichen vs. Interpunktionszeichen
- 5.5. Vorteile einer Interpunktionszeichenrepräsentation von Tönen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Geschichte der Tonbeschreibung und -analyse in afrikanischen Sprachen, insbesondere im Hausa. Ziel ist es, einen Überblick über die Entwicklung verschiedener Methoden der Tonanalyse und deren Repräsentation in Grammatiken und Orthographien zu geben. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und unterschiedlichen Ansätze bei der Darstellung von Tönen in schriftlicher Form.
- Entwicklung der Tonforschung im Hausa
- Historische Entwicklung von Methoden der Tonanalyse
- Repräsentation von Tönen in Grammatiken afrikanischer Sprachen
- Die Rolle der Tonorthographie
- Vergleich verschiedener Methoden der Tonrepräsentation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Tonforschung in afrikanischen Sprachen. Sie hebt die anfängliche Nichtbeachtung bedeutungsunterscheidender Töne durch europäische Sprachwissenschaftler hervor und erklärt dies mit dem Mangel an Aufzeichnungsmöglichkeiten und der fehlenden Sensibilisierung für dieses Phänomen. Die Arbeit skizziert die Ziele und den Umfang der Untersuchung, die sich auf die Geschichte der Tonanalyse und deren Repräsentation in Grammatiken und Orthographien konzentriert. Der Mangel an einheitlichen Analyse- und Schreibweisen wird als zentrales Problem dargestellt.
2. Geschichte der Tonbeschreibung im Hausa: Dieses Kapitel beleuchtet die frühen Ansätze der Tonbeschreibung im Hausa. Es wird gezeigt, wie frühe Sprachwissenschaftler, meist deutsche Missionare, die Komplexität der Tonstrukturen zwar bemerkten, sie aber als "Intonation" oder "Akzent" fehlinterpretierten und nicht als bedeutungsunterscheidende Elemente erkannten. Die Arbeit verfolgt die Entwicklung der Forschung, von der anfänglichen Nichtbeachtung der Töne bis hin zur ersten richtigen Erkennung ihrer Bedeutung durch F.W. Taylor, der die entscheidende Rolle der Töne für die Unterscheidung von Wörtern hervorhob. Das Kapitel illustriert die Herausforderungen bei der Erforschung von Tonsprachen aus einer außersprachlichen Perspektive.
3. Geschichte der Tonanalyse: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung der Tonanalysemethoden. Es werden sowohl deskriptive als auch theoretische Ansätze verschiedener Sprachwissenschaftler vorgestellt, beginnend mit frühen deskriptiven Arbeiten bis hin zu komplexeren theoretischen Modellen. Die Zusammenfassung vergleicht die unterschiedlichen Ansätze und zeigt die Entwicklung von eher intuitiven Beschreibungen hin zu formaleren, theoretisch fundierten Analysen. Die verschiedenen Perspektiven von Christaller, Westermann, Pike, Goldsmith und anderen werden eingeordnet und in ihren historischen Kontext gestellt. Die Entwicklung der theoretischen Modellierung von Tonsystemen wird detailliert dargestellt, wobei die verschiedenen Ansätze und deren Vor- und Nachteile beleuchtet werden.
4. Repräsentation von Tönen in Grammatiken: Dieses Kapitel analysiert, wie verschiedene Autoren die Töne in ihren Grammatiken des Hausa und anderer afrikanischer Sprachen repräsentiert haben. Es werden unterschiedliche Notationssysteme und deren Vor- und Nachteile im Detail dargestellt und miteinander verglichen. Das Kapitel zeigt die Entwicklung von rudimentären Darstellungen hin zu ausgefeilteren Systemen und betont die Herausforderungen der angemessenen Darstellung komplexer Tonsysteme. Die unterschiedlichen Herangehensweisen von Christaller, Ittmann, Ward, Pike und Bendor Samuel werden analysiert und eingeordnet.
5. Repräsentation von Tönen in der Orthographie: Dieses Kapitel behandelt die Frage der Tonorthographie, d.h. die Repräsentation von Tönen in der Schriftsprache. Es diskutiert die Notwendigkeit einer konsistenten Tonorthographie und vergleicht verschiedene Methoden der Tonmarkierung (diakritische Zeichen vs. Interpunktionszeichen). Die Vorteile einer Interpunktionszeichenrepräsentation werden ausführlich dargelegt. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der adäquaten Darstellung von Tönen in der Schriftsprache für die Lesbarkeit und das Verständnis afrikanischer Sprachen. Die praktischen Implikationen für die Alphabetisierung und den Spracherwerb werden angedeutet.
Schlüsselwörter
Tonanalyse, Tonorthographie, afrikanische Sprachen, Hausa, Sprachwissenschaft, Grammatik, Orthographie, Bedeutungsunterscheidende Töne, Deskriptive Analyse, Theoretische Analyse, Diakritische Zeichen, Interpunktionszeichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Geschichte der Tonbeschreibung und -analyse im Hausa
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Geschichte der Tonbeschreibung und -analyse in afrikanischen Sprachen, insbesondere im Hausa. Sie beleuchtet die Entwicklung verschiedener Methoden der Tonanalyse und deren Repräsentation in Grammatiken und Orthographien, einschließlich der Herausforderungen und unterschiedlichen Ansätze bei der schriftlichen Darstellung von Tönen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Tonforschung im Hausa, die historische Entwicklung von Methoden der Tonanalyse, die Repräsentation von Tönen in Grammatiken afrikanischer Sprachen, die Rolle der Tonorthographie und einen Vergleich verschiedener Methoden der Tonrepräsentation. Sie umfasst eine detaillierte Analyse historischer Ansätze von verschiedenen Sprachwissenschaftlern, von frühen deskriptiven Arbeiten bis hin zu komplexeren theoretischen Modellen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) gibt einen historischen Überblick und skizziert die Ziele der Untersuchung. Kapitel 2 behandelt die Geschichte der Tonbeschreibung im Hausa, von frühen Fehlinterpretationen bis zur korrekten Erkennung der bedeutungsunterscheidenden Funktion der Töne. Kapitel 3 bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung der Tonanalysemethoden, sowohl deskriptiv als auch theoretisch. Kapitel 4 analysiert die Repräsentation von Tönen in Grammatiken verschiedener Autoren und vergleicht unterschiedliche Notationssysteme. Kapitel 5 behandelt die Tonorthographie, diskutiert die Notwendigkeit einer konsistenten Darstellung und vergleicht verschiedene Methoden der Tonmarkierung (diakritische Zeichen vs. Interpunktionszeichen).
Welche Sprachwissenschaftler werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich auf zahlreiche Sprachwissenschaftler, darunter Christaller, Westermann, Roehl & Nekes, Ittmann, Pike, Williams, Goldsmith, Halle und Vergnaud, Pulleyblank, Snider, Yip, Hyman, Clark, Ida Ward, Kenneth Pike und John Bendor Samuel. Ihre unterschiedlichen Ansätze und Beiträge zur Tonanalyse und -repräsentation werden im Detail analysiert und verglichen.
Welche Herausforderungen werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die anfängliche Nichtbeachtung bedeutungsunterscheidender Töne durch europäische Sprachwissenschaftler, den Mangel an einheitlichen Analyse- und Schreibweisen, die Herausforderungen bei der Erforschung von Tonsprachen aus einer außersprachlichen Perspektive und die Schwierigkeiten bei der angemessenen Darstellung komplexer Tonsysteme in Grammatiken und Orthographien.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Entwicklung der Tonforschung auf, von frühen, oft unpräzisen Beschreibungen hin zu komplexen theoretischen Modellen. Sie hebt die Bedeutung einer konsistenten Tonorthographie für die Lesbarkeit und das Verständnis afrikanischer Sprachen hervor und diskutiert die Vor- und Nachteile verschiedener Repräsentationsmethoden. Die Arbeit unterstreicht die Herausforderungen und die Notwendigkeit einer einheitlichen Vorgehensweise bei der Analyse und Darstellung von Tönen in Tonsprachen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tonanalyse, Tonorthographie, afrikanische Sprachen, Hausa, Sprachwissenschaft, Grammatik, Orthographie, Bedeutungsunterscheidende Töne, Deskriptive Analyse, Theoretische Analyse, Diakritische Zeichen, Interpunktionszeichen.
- Quote paper
- MMag. Lisa Pfurtscheller (Author), 2011, Der sprachwissenschaftliche und orthographische Umgang mit Tönen afrikanischer Sprachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265419