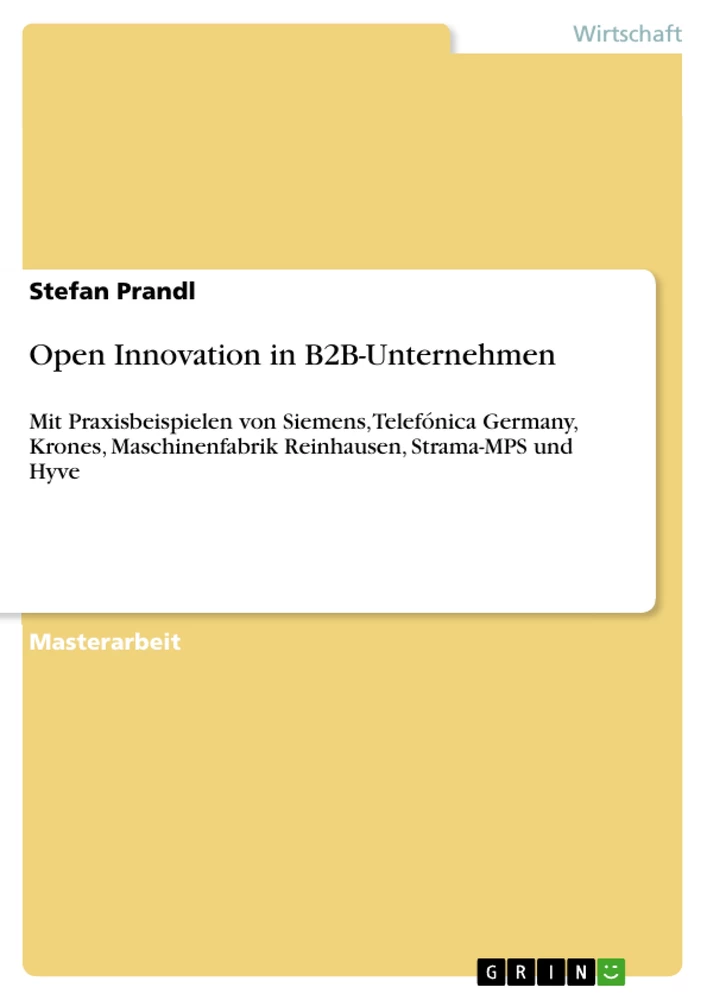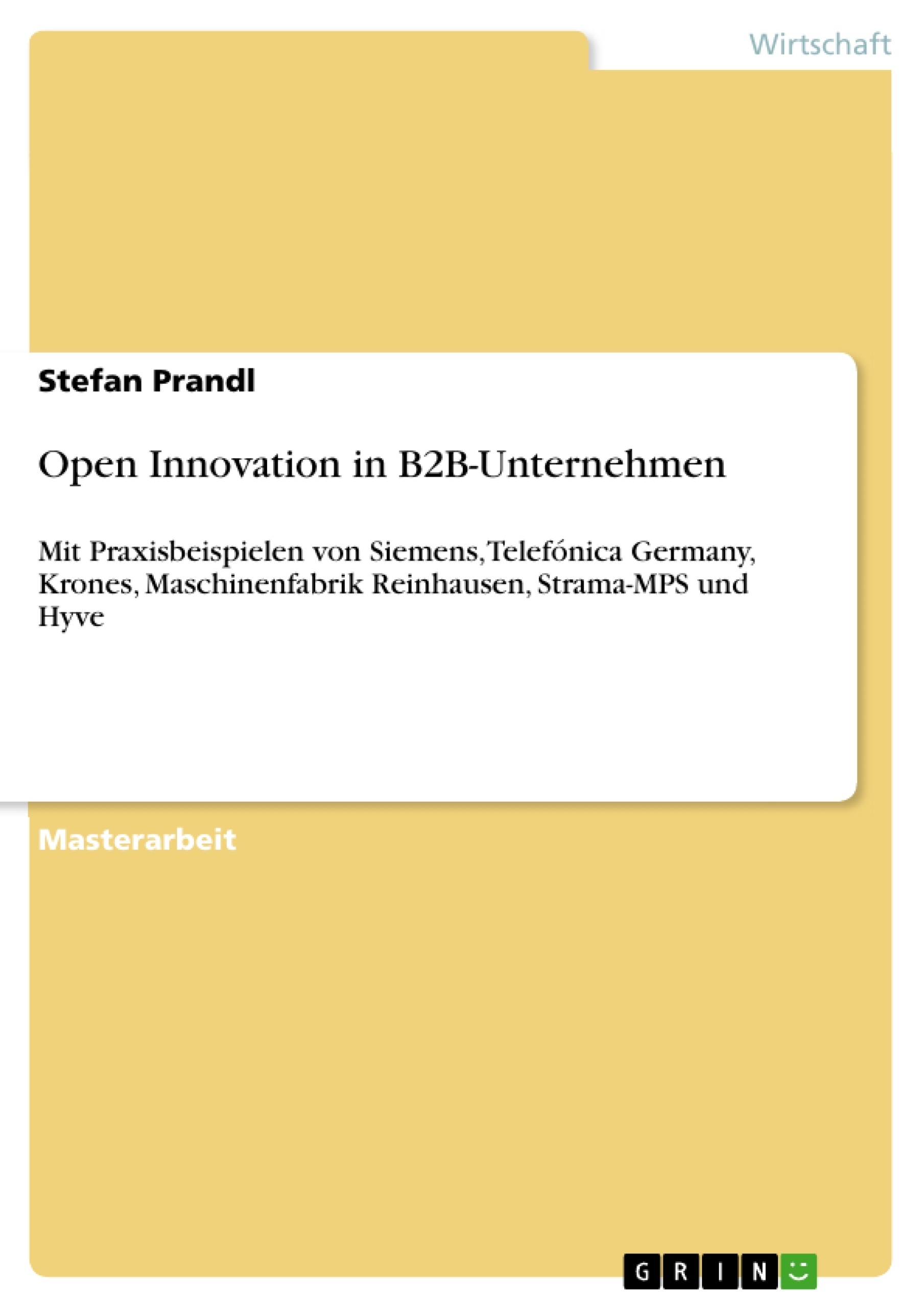Abstract
Seit Chesbrough 2003 alle offenen Innovationsprozesse unter dem Begriff Open Innovation (OI) zusammenfasste, erfreut sich dieses Paradigma großer Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Unternehmenspraxis.
Daher ist es Ziel dieser Arbeit, einen bisher relativ unbeachteten Bereich in der OI-Forschung näher zu beleuchten – nämlich die Besonderheiten von OI in Business-to-business- (B2B-) und Business-to-consumer-Unternehmen (B2C-Unternehmen), wobei der Schwerpunkt auf der Untersuchung von offenen Innovationsprozessen in B2B-Unternehmen liegt. Außerdem wird gezeigt, welche wesentlichen Unterschiede zu OI in B2C-Unternehmen vorzufinden sind.
Dazu wird zum Teil auf die bisher verfügbare OI-Forschung zurückgegriffen. Außerdem werden die Ergebnisse aus der Befragung von vier B2B-Praktikern bzw. Experten und zwei B2C-Praktikern bzw. -Experten und aus der Betrachtung von 64 OI-Projekten mit einbezogen und abgeglichen.
Dabei wurden besonders Unterschiede bzgl. Nutzenerwartungen und Kooperationspartner gefunden. So nutzen B2B-Unternehmen OI verstärkt, um an externes Wissen, Know-how und Ressourcen von Zulieferern, Universitäten und anderen Unternehmen zu gelangen, wohingegen B2C-Unternehmen OI oft als Marketinginstrument in Kooperation mit ihren Kunden einsetzen. Gemeinsam ist ihnen der Schwerpunkt von Inside-Out-Aktivitäten am Anfang des Innovationsprozesses.
Praxis und Wissenschaft bekommen durch diese Erkenntnisse eine zusätzliche Perspektive, inwieweit OI in Bezug auf B2B- und B2C-Unternehmen differenzierter betrachtet werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Erläuterung des Forschungsgebiets und der -methodik
- 2.1 Open Innovation
- 2.1.1 Notwendigkeit und Vorteil der Öffnung des Innovationsprozesses
- 2.1.2 Der offene Innovationsprozess
- 2.1.3 Aktivitäten im offenen Innovationsprozess
- 2.2 B2B-Unternehmen
- 2.2.1 Beschreibung von B2B-Unternehmen
- 2.2.2 Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Unternehmen
- 2.3 Beschreibung der Forschungsmethodik
- 2.1 Open Innovation
- 3 Erkenntnisse aus der Theorie
- 3.1 Nutzen aus dem Einsatz von OI
- 3.2 Grenzen beim Einsatz von OI
- 3.3 Treiber beim Einsatz von OI
- 3.4 Hauptpartner beim Einsatz von OI
- 3.5 Anwendung von Inbound-, Outbound- und Coupled-OI
- 3.6 Unterschiede in der Nutzung des Ideenspeichers
- 3.7 Unterschiede bei der Durchlässigkeit der Unternehmensgrenze
- 4 Erkenntnisse aus der Praxis
- 4.1 Beschreibung der Methodik und der Experten/Praktiker
- 4.2 Befragung der B2B-Praktiker
- 4.2.1 Fallbeispiel B2B 1: Maschinenfabrik Reinhausen
- 4.2.2 Fallbeispiel B2B 2: Siemens
- 4.2.3 Fallbeispiel B2B 3: Krones
- 4.2.4 Fallbeispiel B2B 4: Strama-MPS
- 4.2.5 Erkenntnisse aus der B2B-Praxis
- 4.3 Befragung der B2C-Praktiker
- 4.3.1 Fallbeispiel B2C 1: Telefónica Germany
- 4.3.2 Fallbeispiel B2C 2: Hyve AG
- 4.3.3 Erkenntnisse aus der B2C-Praxis und Abgleich mit der B2B-Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Besonderheiten von Open Innovation (OI) in Business-to-business (B2B) und Business-to-consumer Unternehmen (B2C). Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse offener Innovationsprozesse in B2B-Unternehmen und dem Vergleich zu B2C-Unternehmen. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in der Ausgestaltung und Anwendung von OI in beiden Kontexten.
- Charakteristika von Open Innovation in B2B-Unternehmen
- Vergleich der OI-Prozesse in B2B und B2C-Unternehmen
- Schlüsselpartner und -aktivitäten im Rahmen von OI
- Nutzen und Grenzen des Einsatzes von OI
- Einfluss der Unternehmenskultur auf die OI-Strategie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Innovationsprozesses vom geschlossenen zum offenen Modell. Sie führt den Begriff "Open Innovation" (OI) ein und begründet die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung von OI in B2B- und B2C-Unternehmen. Das Ziel der Arbeit wird definiert als die Untersuchung der Charakteristika und Unterschiede von OI in beiden Unternehmenstypen. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert.
2 Erläuterung des Forschungsgebiets und der -methodik: Dieses Kapitel präzisiert den Begriff "Open Innovation" und differenziert ihn von "Closed Innovation". Es werden die Kriterien für die Einordnung von Unternehmen als B2B- oder B2C-Unternehmen im Kontext des Innovationsmanagements definiert. Die Forschungsmethodik, basierend auf einer Literaturrecherche und Fallstudien mit Experteninterviews, wird detailliert beschrieben. Der qualitative Forschungsansatz wird begründet.
3 Erkenntnisse aus der Theorie: Dieses Kapitel analysiert bestehende Theorien zu Open Innovation und erarbeitet daraus Arbeitsthesen. Es werden der Nutzen von OI, dessen Grenzen, die treibenden Faktoren für OI, die wichtigsten Kooperationspartner und die Anwendung von Inbound-, Outbound- und Coupled-OI untersucht. Besonders werden die Unterschiede in der Nutzung des Ideenspeichers und die Durchlässigkeit der Unternehmensgrenzen in B2B- und B2C-Unternehmen beleuchtet.
4 Erkenntnisse aus der Praxis: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse von Experteninterviews mit Praktikern aus verschiedenen B2B- und B2C-Unternehmen. Es werden detaillierte Fallstudien von Maschinenfabrik Reinhausen, Siemens, Krones, Strama-MPS, Telefónica Germany und Hyve AG vorgestellt. Die Interviews untersuchen den praktischen Einsatz von OI, die identifizierten Herausforderungen und die beobachteten Unterschiede zwischen B2B und B2C.
Schlüsselwörter
Open Innovation, Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Innovationsprozess, Wissensmanagement, Kooperation, Fallstudie, Experteninterview, Inbound-OI, Outbound-OI, Coupled-OI, Industriegüter, Konsumgüter, Wettbewerbsvorteil, Unternehmenskultur, NIH-Syndrom.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Open Innovation in B2B- und B2C-Unternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Besonderheiten von Open Innovation (OI) in Business-to-business (B2B) und Business-to-consumer (B2C) Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse offener Innovationsprozesse in B2B-Unternehmen und deren Vergleich mit B2C-Unternehmen. Es werden die Unterschiede in der Ausgestaltung und Anwendung von OI in beiden Kontexten beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Charakteristika von Open Innovation in B2B-Unternehmen, Vergleich der OI-Prozesse in B2B und B2C-Unternehmen, Schlüsselpartner und -aktivitäten im Rahmen von OI, Nutzen und Grenzen des Einsatzes von OI, sowie den Einfluss der Unternehmenskultur auf die OI-Strategie.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Forschungsmethodik basiert auf einer Literaturrecherche und Fallstudien mit Experteninterviews. Es wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt, um die komplexen Aspekte von Open Innovation in den jeweiligen Unternehmenstypen zu erfassen.
Welche Unternehmen wurden in den Fallstudien untersucht?
Die Arbeit beinhaltet Fallstudien mit Experteninterviews aus verschiedenen B2B- und B2C-Unternehmen. Im B2B-Bereich wurden Maschinenfabrik Reinhausen, Siemens, Krones und Strama-MPS untersucht. Im B2C-Bereich wurden Telefónica Germany und Hyve AG als Fallbeispiele herangezogen.
Welche Erkenntnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Erkenntnisse aus der Theorie zu Open Innovation, wie Nutzen, Grenzen, treibende Faktoren, Kooperationspartner und die Anwendung von Inbound-, Outbound- und Coupled-OI. Die Praxis-Erkenntnisse basieren auf den Experteninterviews und beleuchten den praktischen Einsatz von OI, identifizierte Herausforderungen und Unterschiede zwischen B2B und B2C.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Open Innovation, Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Innovationsprozess, Wissensmanagement, Kooperation, Fallstudie, Experteninterview, Inbound-OI, Outbound-OI, Coupled-OI, Industriegüter, Konsumgüter, Wettbewerbsvorteil, Unternehmenskultur, NIH-Syndrom.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einführung, die Erläuterung des Forschungsgebiets und der Methodik, die Präsentation der theoretischen Erkenntnisse und schließlich die Darstellung der praktischen Erkenntnisse aus den Fallstudien.
- Quote paper
- Stefan Prandl (Author), 2013, Open Innovation in B2B-Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265324