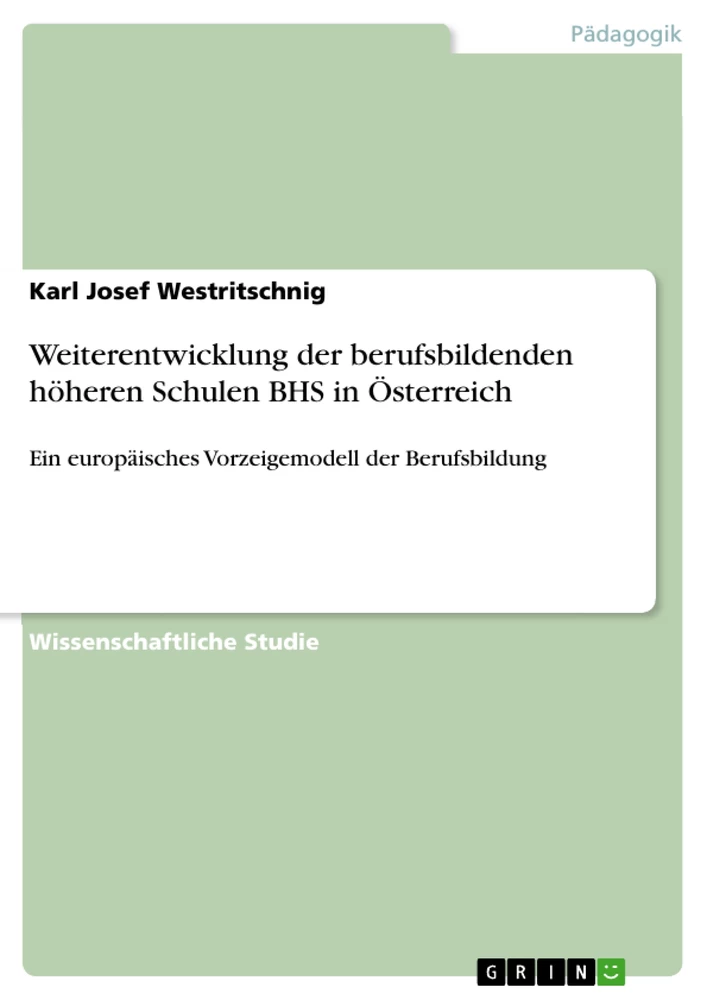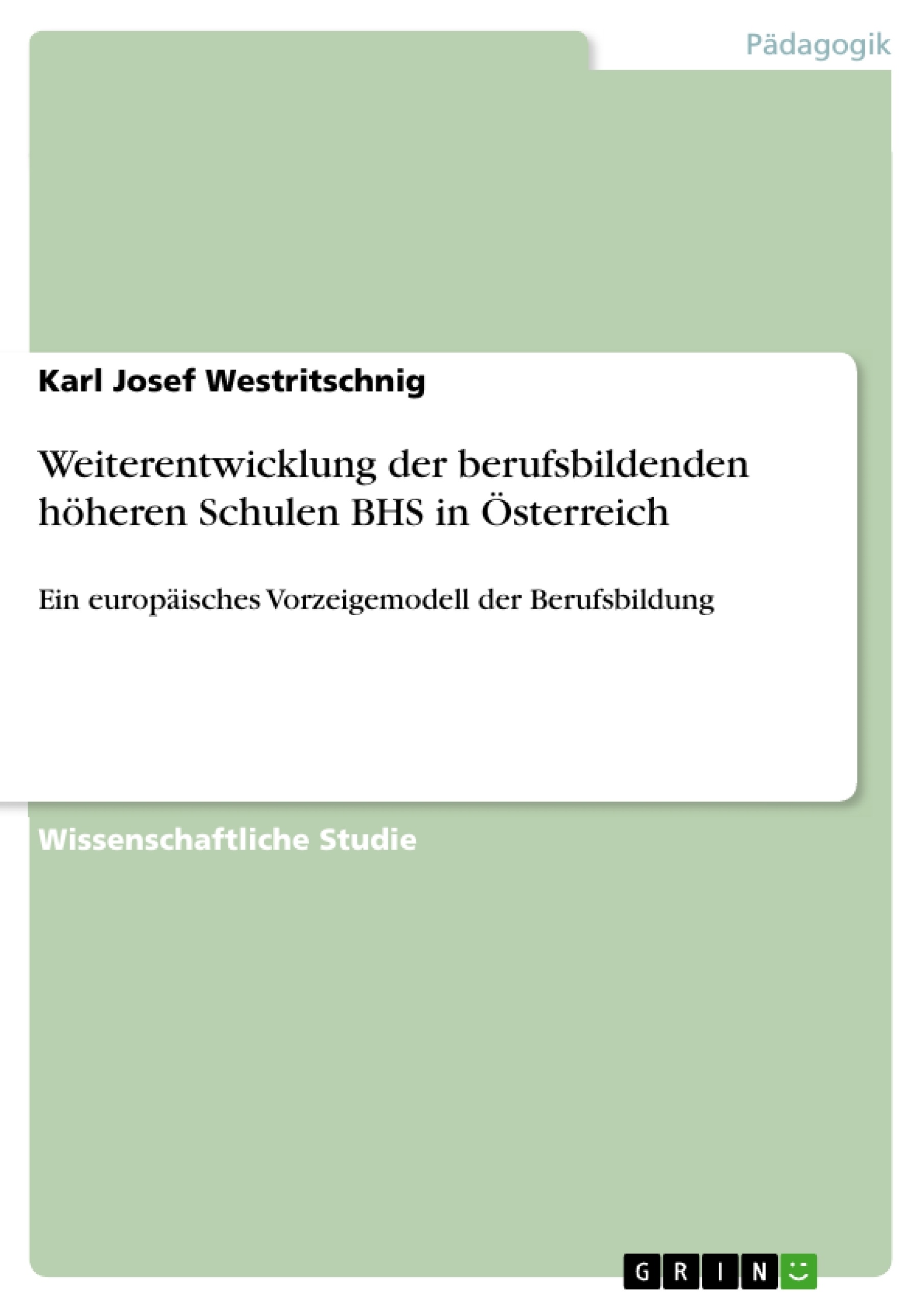Die berufsbildenden höheren Schulen BHS schließen mit einer Reife- und Diplomprüfung durch eine Doppelqualifikation ab. Der bestehende Bildungsprozess an diesen höheren Lehranstalten sollte dual Betriebs- und praxisorientiert, europakonform, tertiär-akademisch erweitert werden. Bildungsredundanzen in ein weiterführendes Bildungssystem werden dadurch minimiert. Eine entsprechende Durchlässigkeit im Bildungssystem muss für jene stattfinden, die sich weiterqualifizieren wollen. Der europäische Bildungstrend macht es erforderlich, dass die Arbeitsmarkt- und beschäftigungsfähigen berufsbildenden höheren Schulen BHS durch eine tertiäre Betriebs- und praxisnahe Hochschulebene ergänzt werden. Die Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen Bildungskontext wird dadurch gesichert. Die sekundare Berufsbildung an den „berufsbildenden höheren Schulen“ wird nach einem höheren, dualen Bildungsprinzip tertiär erweitert. Eine zunehmende Konkurrenz in der Privatwirtschaft durch die Fachhochschulen macht es notwendig, Betriebs- und praxisnah auf der Tertiärebene akademisch zu positionieren. Eine Betriebs- und praxisnahe Weiterqualifizierung für bildungswillige BHS-Absolventen wird im Bologna-Prozess erforderlich. Die berufsbildenden höheren Schulen sind formal durch ein europakonformes BOLOGNA-Programm zu erweitern. Das BOLOGNA-Programm ermöglicht eine Durchlässigkeit in das Masterprogramm von Fachhochschulen und Universitäten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Nationaler Qualifikationsrahmen in berufsbildende höhere Schulen europakonform integriert
- Europäischer Qualifikationsrahmen und dessen Schlüsselkonzepte
- Nationaler Qualifikationsrahmen - Lernergebnis in einem internationalen Kontext lernergebnisorientiert
- ISCED-Klassifikation und berufsbildende höhere Schulen mit unterschiedlichen Bildungswegen
- ISCED-Systematik und BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN mit einer 3-jährigen Betriebs- und Berufspraxis
- Höhere technische Lehranstalten mit einer Rückbindung der Betriebspraxis an das Bildungssystem
- Fachtheorie und Fachpraxis – eine Symbiose mit nationalen und internationalen Zukunftsaussichten in der Ingenieurbildung
- Betriebs- und Berufspraxis einschlägig und gehoben zur Weiterqualifizierung zum durchlässigen akademischen Bachelor-Grad
- Technologischer Strukturwandel durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien
- Höhere technische Lehranstalten mit Bildungsstandards für den internationalen Vergleich der Ingenieurbildung
- Bologna-Prozess und Bildungsstandards zum europäischen und internationalen Vergleich der zweistufigen Ingenieurbildung
- HTL-DIPLOM mit Betriebspraxis als Weiterqualifizierung zum Ingenieur und dessen Einstufung in der ISCED-Systematik
- Der HTL-INGENIEUR und seine berufliche und gesellschaftliche Aufwertung im Nationalen Qualifikationsrahmen
- Höhere technische Lehranstalten mit flexiblen Lehrplänen zur Entgegnung eines wirtschaftlich-technischen Strukturwandels
- Höhere technische Lehranstalten und eine umfassende Allgemeinbildung mit einer grundlegenden Fachbildung
- Höhere technische Lehranstalten im Spannungsfeld von Persönlichkeits- und Fachbildung
- Ingenieurpraxis und eine „duale“ Rückbindung an das Bildungssystem mit einer Weiterbildung zum akademischen Bachelor-Ingenieur
- HTL-ABSOLVENTEN dual durch eine tertiär-formalisierte Betriebs- und Berufspraxis zum akademischen Ingenieur
- HTL-ABSOLVENTEN durch eine facheinschlägige und gehobene Ingenieurpraxis zum ,,akademischen\" Ingenieur als Bachelor-Grad
- ISCED-Bildungssystematik orientiert sich an der internationalen Wirtschaftsorganisation OECD mit einer Chancengleichheit aller
- Fachhochschulen und der Bologna-Prozess erfordern zunehmend eine sekundar-tertiäre Weiterentwicklung des HTL-Bildungssystems zum akademischen Ingenieur
- Bachelorprogramme beim HTL-Bildungssystem ermöglichen einen Zugang zu Masterprogrammen an Fachhochschulen und Universitäten
- Nationaler Qualifikationsrahmen durch Lernergebnisse vornehmlich output-orientiert
- HTL-ABSOLVENTEN mit dualer, tertiär-formalisierter Betriebspraxis zum akademischen Ingenieur
- Die Hohe technische Lehranstalt - ein sekundar-tertiär weiterentwickeltes Bildungssystem
- MODELL la: HTL-ABSOLVENTEN werden sekundar-tertiär zum betriebs- und praxisorientierten akademischen Ingenieur
- BHS-ABSOLVENTEN durch eine „dual“, tertiär-formalisierte Betriebs- und Berufspraxis zum akademischen Bachelor-Grad
- Berufsbildende höhere Schule BHS mit zusätzlich dualem, tertiärem Bildungsprinzip zum durchlässigen akademischen BACHELOR-Grad
- Berufsbildende höhere Schule BHS mit ihrem Ursprung in der industriellen und liberal-fortschrittlichen Zeit der Habsburger-monarchie
- Niederer, gewerblich-beruflicher Unterricht entsteht durch die aufgeklärt-absolutistische Kaiserin Maria Theresia im 18. Jahrhundert
- Mittleres gewerblich-berufliches Unterrichtswesen entwickelt sich zunehmend in der Habsburgermonarchie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- Höhere Gewerbeschulen und höhere Handelsschulen als aufstrebende Mittelschulen zur gewerblichen und industriellen Bildung
- BHS-Absolventen gelangen mit dualer, tertiär-formalisierter Betriebs- und Berufspraxis zum akademischen BACHELOR-Grad
- MODELL Ib: BHS-ABSOLVENTEN gelangen sekundar-tertiär zum betriebs- und praxisorientierten akademischen BACHELOR-Grad
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht die Weiterentwicklung berufsbildender höherer Schulen (BHS) in Österreich im europäischen Kontext. Ziel ist es, das österreichische Modell als Vorzeigemodell für Berufsbildung in Europa zu präsentieren und dessen Stärken und Potenziale hervorzuheben.
- Integration nationaler Qualifikationsrahmen in europäische Standards
- Zusammenspiel von Theorie und Praxis in der Ingenieurausbildung
- Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung
- Der Einfluss des Bologna-Prozesses auf die Ingenieurausbildung
- Historische Entwicklung der BHS in Österreich
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Weiterentwicklung der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) in Österreich ein und skizziert den Ansatz der Arbeit, das österreichische System als europäisches Vorzeigemodell darzustellen. Sie umreißt die Bedeutung der Berufsbildung im europäischen Kontext und benennt die zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
Nationaler Qualifikationsrahmen in berufsbildende höhere Schulen europakonform integriert: Dieses Kapitel beleuchtet die Einbettung des österreichischen Qualifikationsrahmens in den europäischen Kontext. Es analysiert die Schlüsselkonzepte des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) und deren Umsetzung im österreichischen System. Der Fokus liegt auf der Lernergebnisorientierung und der internationalen Vergleichbarkeit der Abschlüsse.
ISCED-Klassifikation und berufsbildende höhere Schulen mit unterschiedlichen Bildungswegen: Dieses Kapitel beschreibt die Einordnung der österreichischen BHS in die internationale ISCED-Klassifikation. Es untersucht verschiedene Bildungswege innerhalb des BHS-Systems und deren spezifische Merkmale im Hinblick auf die Dauer der Ausbildung und die Integration von Betriebspraxen. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der unterschiedlichen Abschlüsse und deren Vergleichbarkeit.
Höhere technische Lehranstalten mit einer Rückbindung der Betriebspraxis an das Bildungssystem: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL). Es analysiert das Zusammenspiel von Fachtheorie und Fachpraxis, die Bedeutung der Betriebspraxis für die Weiterqualifizierung zum Bachelor-Abschluss, den Einfluss des technologischen Strukturwandels und die Bedeutung von Bildungsstandards für den internationalen Vergleich. Es werden die Herausforderungen und Chancen der HTL-Ausbildung im Kontext des Bologna-Prozesses beleuchtet. Die Kapitel untersuchen die berufliche und gesellschaftliche Aufwertung des HTL-Ingenieurs und die Anpassungsfähigkeit der HTL-Lehrpläne an wirtschaftlich-technische Veränderungen.
HTL-ABSOLVENTEN dual durch eine tertiär-formalisierte Betriebs- und Berufspraxis zum akademischen Ingenieur: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Übergang von der HTL zum akademischen Ingenieurstudium. Es analysiert verschiedene Modelle der dualen Ausbildung und deren Auswirkung auf den Zugang zu Bachelor-Programmen an Fachhochschulen und Universitäten. Der Nationale Qualifikationsrahmen und dessen Output-Orientierung werden im Hinblick auf die Chancengleichheit aller Absolventen diskutiert.
BHS-ABSOLVENTEN durch eine „dual“, tertiär-formalisierte Betriebs- und Berufspraxis zum akademischen Bachelor-Grad: Dieses Kapitel widmet sich der Weiterentwicklung der BHS im Allgemeinen, nicht nur der HTL, und untersucht verschiedene Modelle, wie BHS-Absolventen über eine duale, tertiär-formalisierte Praxis einen akademischen Bachelor-Abschluss erlangen können. Die historische Entwicklung der BHS in Österreich, beginnend mit dem gewerblich-beruflichen Unterricht der Habsburgermonarchie, wird beleuchtet und in den Kontext der modernen Berufsbildung eingeordnet.
Schlüsselwörter
Berufsbildende höhere Schulen (BHS), Österreich, Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR), ISCED-Klassifikation, Höhere Technische Lehranstalten (HTL), Ingenieurausbildung, duale Ausbildung, Bologna-Prozess, Bachelor-Abschluss, Nationaler Qualifikationsrahmen, betriebliche Praxis, technologischer Strukturwandel, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Weiterentwicklung berufsbildender höherer Schulen (BHS) in Österreich
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Diese Forschungsarbeit untersucht die Weiterentwicklung berufsbildender höherer Schulen (BHS), insbesondere der Höheren Technischen Lehranstalten (HTL), in Österreich im europäischen Kontext. Das Ziel ist es, das österreichische Modell als positives Beispiel für Berufsbildung in Europa zu präsentieren und dessen Stärken und Potenziale hervorzuheben.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Integration nationaler Qualifikationsrahmen in europäische Standards, das Zusammenspiel von Theorie und Praxis in der Ingenieurausbildung, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung, den Einfluss des Bologna-Prozesses, die historische Entwicklung der BHS in Österreich und die Einordnung der BHS in die internationale ISCED-Klassifikation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zur Integration des nationalen Qualifikationsrahmens in den europäischen Kontext, zur ISCED-Klassifikation, zur Rolle der HTL und ihrer Rückbindung an die Betriebspraxis, zum Übergang von der HTL zum akademischen Ingenieurstudium und zur Weiterentwicklung des BHS-Systems im Allgemeinen, inklusive eines historischen Überblicks. Zusätzlich enthält sie ein Vorwort, ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR)?
Die Arbeit analysiert die Schlüsselkonzepte des EQR und deren Umsetzung im österreichischen BHS-System. Der Fokus liegt auf der Lernergebnisorientierung und der internationalen Vergleichbarkeit der Abschlüsse.
Welche Bedeutung hat die ISCED-Klassifikation?
Die Arbeit beschreibt die Einordnung der österreichischen BHS in die internationale ISCED-Klassifikation und untersucht verschiedene Bildungswege innerhalb des BHS-Systems, die Dauer der Ausbildung und die Integration von Betriebspraxen.
Wie wird die Ausbildung an HTLs beschrieben?
Die Arbeit analysiert das Zusammenspiel von Theorie und Praxis an HTLs, die Bedeutung der Betriebspraxis für die Weiterqualifizierung zum Bachelor-Abschluss, den Einfluss des technologischen Strukturwandels und die Bedeutung von Bildungsstandards im internationalen Vergleich. Der Bologna-Prozess und die berufliche Aufwertung des HTL-Ingenieurs werden ebenfalls behandelt.
Wie wird der Übergang von der HTL zum akademischen Studium dargestellt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Übergang von der HTL zum akademischen Ingenieurstudium und analysiert verschiedene Modelle der dualen Ausbildung und deren Auswirkung auf den Zugang zu Bachelor-Programmen.
Wie wird die historische Entwicklung der BHS behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der BHS in Österreich, beginnend mit dem gewerblich-beruflichen Unterricht der Habsburgermonarchie, und ordnet diese in den Kontext der modernen Berufsbildung ein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berufsbildende höhere Schulen (BHS), Österreich, Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR), ISCED-Klassifikation, Höhere Technische Lehranstalten (HTL), Ingenieurausbildung, duale Ausbildung, Bologna-Prozess, Bachelor-Abschluss, Nationaler Qualifikationsrahmen, betriebliche Praxis, technologischer Strukturwandel, historische Entwicklung.
Welches Ziel verfolgt die Darstellung des österreichischen Modells?
Das österreichische BHS-System soll als positives Beispiel für Berufsbildung in Europa präsentiert werden, um dessen Stärken und Potenziale hervorzuheben.
- Quote paper
- Prof. i.R. Ing. Dipl.-Ing. MMag. Dr.phil. Karl Josef Westritschnig (Author), 2013, Weiterentwicklung der berufsbildenden höheren Schulen BHS in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265294