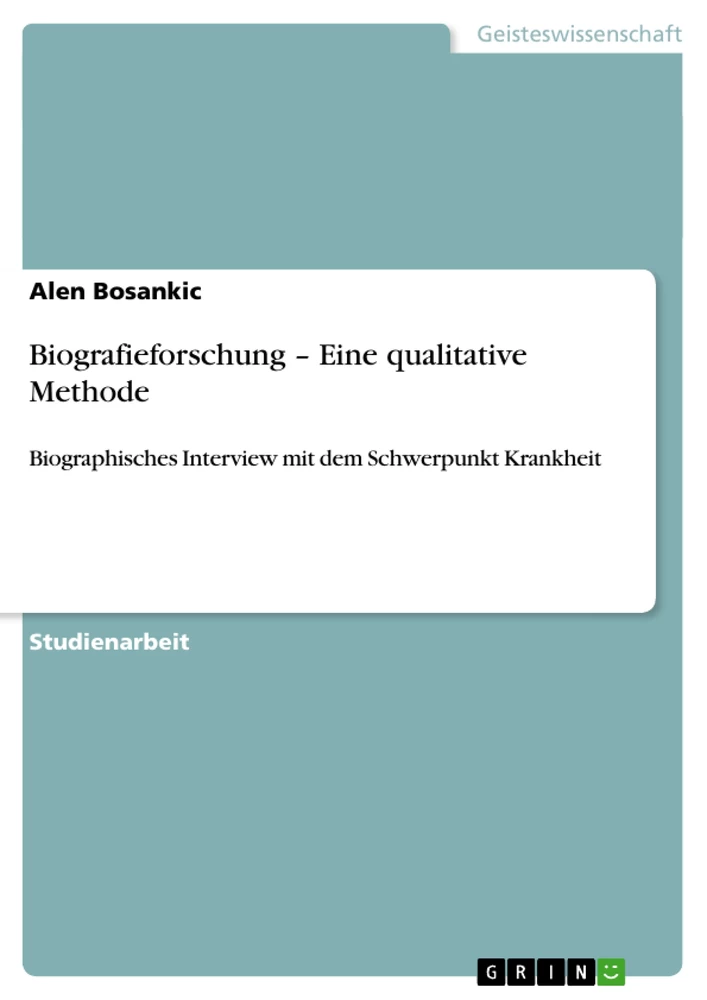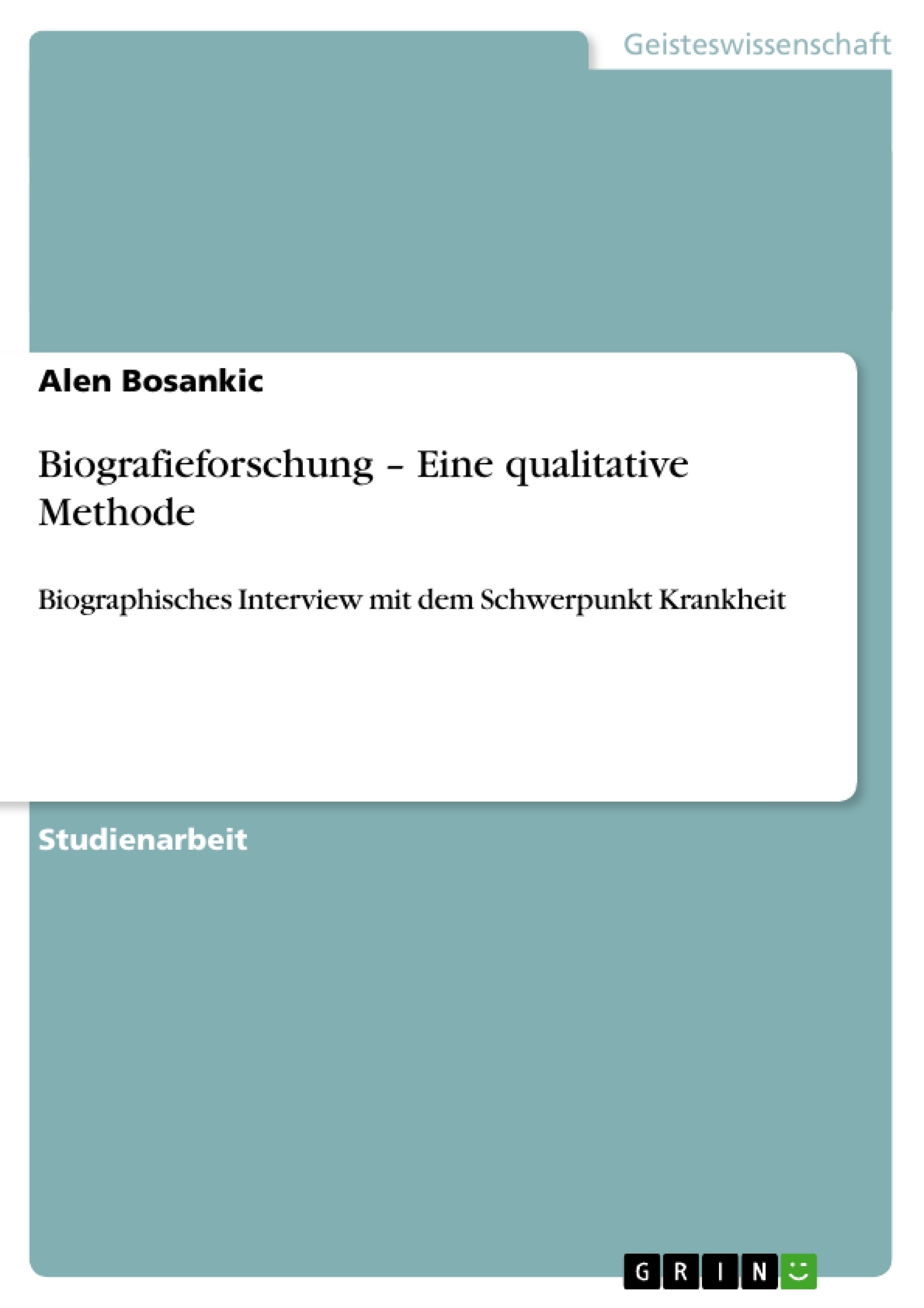Die Veranstaltung des Sommersemesters 2010, „Biografieforschung – Eine qualitative Methode“, beschäftigte sich mit autobiographisch-narrativen Interviews in der Sozialpsychologie. In der vorgesehenen Empiriephase sollten Biographieinterviews autonom mit einer selbstakquirierten Person geführt werden, die wahlweise zum Schwerpunkt „Krankheit“ oder „Arbeit“ bzw. „Beruf“ befragt wurde; die Analyse des erhobenen Datenmaterials stellte den Abschluss des Seminars dar. Gegenstand vorliegender Ausarbeitung ist das von mir geführte biographische Interview, welches, zufälligerweise, beide Schwerpunkte in einer Person vereint. Dieses soll im Folgenden, unter eingeschränktem Rückgriff auf die Ansätze von Fritz Schütze bzw. Gabriele Rosenthal, analysiert werden. Unter Berücksichtigung der inhaltlichen Anforderungen zur Anfertigung dieser Arbeit sowie in Anbetracht des Datenmaterials wurde von einer vollständigen Analyse nach Schütze bzw. Rosenthal abgesehen und hinsichtlich des Auswertungsvorgangs vielmehr selektiv verfahren. Demnach enthält vorliegende Arbeit nicht alle Schritte der von den Autoren vorgeschlagenen Vorgehensweise, wie beispielsweise die „Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte“ oder etwa die „Konstruktion unterschiedlicher Typen anhand einer Fallrekonstruktion“. In diesem Zuge sei sogleich darauf hingewiesen, dass die Beantwortung der eingangs gestellten Fragen somit keineswegs erschöpfend, sondern lediglich ansatzweise erfolgt.
Darüber hinaus wird in der inhaltlichen Auswertung, aufgrund des limitierten Darstellungskontextes, auf psychoanalytische Konzepte verzichtet, sodass lediglich eine interpretative Analyse bewerkstelligt wird. Folglich kann und möchte der Anspruch vorliegender Arbeit weder im exakten Durchexerzieren einer Methode von Anfang bis Ende, noch in einer psychoanalytisch aufgeladenen Dokumentation von Therapiebedürftigkeit, anhand einer Biographie, liegen. Vielmehr kann und möchte diese Arbeit das methodische Vorgehen der Biographieforschung und die Legitimierung des Rückgriffs auf dieses Konzept in der soziologischen bzw. sozialpsychologischen Forschung, anhand eines konkreten Biographiebeispiels, exemplifizieren. Konkreter wird dieser Anspruch im noch darzustellenden Abschnitt zur Methode ausgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
1.1 Gegenstand und Problematik
1.2 Gang der Ausarbeitung
2. Grundlagen zur qualitativen Forschungsmethode
2.1 Das narrative Interview in der sozialwissenschaftlichen Forschung
3. Das narrative Interview
3.1 Zur Person
3.2 Kontaktherstellung
3.3 Gesprächsdaten; Gesprächssituation; Grenzphänomene
3.4 Das Gespräch: strukturell inhaltliche Beschreibung der Haupterzählung
3.5 Problematisierung
4. Schlussteil: Resümee
5. Bibliographie
6. Annex
1. Einführung
Die Veranstaltung des Sommersemesters 2010 von Panja Schweder, „Biografieforschung - Eine qualitative Methode“, beschäftigte sich mit autobiographisch-narrativen Interviews in der Sozialpsychologie. Nach der theoretischen Fundierung des Forschungsprozesses im ersten Teil des Seminars, wobei die Kontaktaufnahme, Durchführung, Protokollierung und Auswertung des Interviews thematisiert wurde, sollten die vermittelten Kenntnisse, im zweiten Teil des Seminars, in die Praxis umgesetzt werden. Es folgte eine Empiriephase, in der autonom Biographieinterviews mit einer selbstakquirierten Person geführt wurden, die wahlweise zum Schwerpunkt „Krankheit“ oder „Arbeit“ bzw. „Beruf“ befragt wurden; die Analyse des erhobenen Datenmaterials stellte den Abschluss des Seminars dar
1.1 Gegenstand und Problematik
Das Interview mit dem Schwerpunkt „Krankheit“ sollte vornehmlich problematisieren, wie bestimmte Menschen, durch eine bestimmte Erkrankung, in ihrem Lebenslauf beeinflusst werden: was biographisch aus der Krankheit resultierte, welche Entscheidungen sie getroffen oder nicht getroffen haben, etc. Interviews zum Themenkomplex „Beruf“ sollten hingegen Aufschluss darüber geben, wie bestimmte Menschen zu ihrem Beruf kamen: welche Schlüsselereignisse auf ihrem Lebensweg dorthin identifiziert oder benannt werden können, wie es dazu kam, dass sie ihre Präferenzen beruflich fundierten und welche Gründe und Faktoren den Beruf insgesamt determinierten.
Ungeachtet des Schwerpunktes sollte das Biographieinterview letztlich ausreichend Daten liefern, um daraus Aspekte zu filtern, die nach entsprechender Aufbereitung, gesamtbiographisch, verallgemeinernde bzw. typologische Qualität für eine sozialpsychologische Forschung besitzen.
Gegenstand vorliegender Ausarbeitung ist das von mir geführte biographische Interview, welches, zufälligerweise, beide Schwerpunkte in einer Person vereint.1 Dieses soll im Folgenden, unter eingeschränktem Rückgriff auf die Ansätze von Fritz Schütze bzw. Gabriele Rosenthal, analysiert werden. Unter Berücksichtigung der inhaltlichen Anforderungen zur Anfertigung dieser Arbeit sowie in Anbetracht des Datenmaterials wurde von einer vollständigen Analyse nach Schütze bzw. Rosenthal abgesehen und hinsichtlich des Auswertungsvorgangs vielmehr selektiv verfahren. Demnach enthält vorliegende Arbeit nicht alle Schritte der von den Autoren vorgeschlagenen Vorgehensweise, wie beispielsweise die „Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte“ oder etwa die „Konstruktion unterschiedlicher Typen anhand einer Fallrekonstruktion“. In diesem Zuge sei sogleich darauf hingewiesen, dass die Beantwortung der eingangs gestellten Fragen somit keineswegs erschöpfend, sondern lediglich ansatzweise erfolgt.
Darüber hinaus wird in der inhaltlichen Auswertung, aufgrund des limitierten Darstellungskontextes, auf psychoanalytische Konzepte verzichtet, sodass lediglich eine interpretative Analyse bewerkstelligt wird. Folglich kann und möchte der Anspruch vorliegender Arbeit weder im exakten Durchexerzieren einer Methode von Anfang bis Ende, noch in einer psychoanalytisch aufgeladenen Dokumentation von Therapiebedürftigkeit, anhand einer Biographie, liegen. Vielmehr kann und möchte diese Arbeit das methodische Vorgehen der Biographieforschung und die Legitimierung des Rückgriffs auf dieses Konzept in der soziologischen bzw. sozialpsychologischen Forschung, anhand eines konkreten Biographiebeispiels, exemplifizieren. Konkreter wird dieser Anspruch im noch darzustellenden Abschnitt zur Methode ausgeführt.
1.2 Gang der Ausarbeitung
Vor dem „Einstieg“ in die Daten, soll zunächst kurz in die qualitative Sozialforschung eingeführt werden und die Methode des narrativen Interviews in der Biographieforschung sowie ihre Herkunft skizziert werden (2.).2 Dabei wird keineswegs eine methodologische Diskussion erfolgen; diese ist an anderer Stelle in extenso kritisch rekonstruiert worden3. Vielmehr wird dieser zweite Teil für das methodische Verständnis und Vorgehen der Arbeit als unabdingbar erachtet, weshalb die Verwendung der Methode und die Fragestellung nochmals plausibel dargestellt werden sollen. Der darauf folgende Hauptteil geht in medias res und bereitet die Daten des Interviews qualitativ auf (3.). Neben der Gesprächsführung wird hier auf die biographischen Daten eingegangen, wobei einige Daten schließlich ausführlicher in einer Text- bzw. thematischen Analyse besprochen werden. In Form eines Fazits versucht sich der Schlussteil, mithilfe der Ergebnisse, an einer Antwort auf die eingangs gestellte Frage (4.).
2. Grundlagen zur qualitativen Forschungsmethode
Herrscht in der Wissenschaft Konsens darüber, was unter quantitativer Sozialforschung zu verstehen ist, fehlt qualitativen Untersuchungen hingegen eine eindeutige Definition der Vorgehensweise und der methodologischen Grundannahmen. Sicher ist, dass es sich nicht um eine Interpretation und numerische Generalisierung handelt, die auf der Häufigkeit des Auftretens bestimmter sozialer Phänomene beruht. Vielmehr geht es um das Verallgemeinern und Überprüfen von im Forschungsprozess generierter Hypothesen bzw. der Formulierung gegenstandsbezogener Theorien am Einzelfall (Rosenthal 2005: 13). Dabei folgt die qualitative Sozialforschung, methodologisch, einem Prinzip des Entdeckens, woraus der Anspruch einer offenen Vorgehensweise erwächst; d.h. eine Standardisierung von Datenerhebungsinstrumenten wird ausgeschlossen und die Beobachtungs- bzw. Erhebungssituation wird an die jeweiligen Relevanzen und Gegebenheiten des zu beobachtenden Objektes bzw. der zu beobachtenden Individuen adaptiert. Insgesamt soll, beispielsweise den Individuen, so viel Gestaltungsspielraum wie möglich gelassen werden, damit diese, in ihrem „natürlichen“ Prozess, nicht beeinflusst werden (Rosenthal 2005: 13 f.).
Alles in allem können qualitative Untersuchungen nach unterschiedlichen Kriterien unterschieden werden. Nämlich ob Interpretationen von Studien „auf der Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens von sozialen Phänomenen oder auf der Rekonstruktion von Wirkungszusammenhängen am konkreten Fall beruhen, ob sie eher einer Überprüfung- oder eher einer Entdeckungslogik von Hypothesen folgen und schließlich wie offen ihre Instrumente der Erhebung und der Auswertung sind“ (Rosenthal 2005: 14).
In der Forschungsrealität kann jedoch ein Gros der Arbeiten nicht nach diesen Kriterien „dingfest“ gemacht werden, da die meisten qualitativen Untersuchungen zwischen diesen beiden Polen pendeln. Unter diesem Blickwinkel beanspruchen VertreterInnen einer „konsequenten interpretativen oder rekonstruktiven Forschungslogik“ ihren wissenschaftlichen Modus Operandi anders als „qualitative Methode“ zu labeln und sprechen beispielsweise von einer kommunikativen, rekonstruktiven, sozialwissenschaftlichen oder auch wissensoziologischen Hermeneutik (Rosenthal 2005: 14). Dies ist insofern relevant, als der Mensch im interpretativen Paradigma, was jener Forschungslogik zugrunde liegt, als ein handelnder und erkennender Organismus verstanden wird, der der Welt nicht lediglich entgegensteht und auf sie reagiert, sondern erst in seinen Interaktionen, etwa der Kommunikation mit anderen Individuen, „soziale Wirklichkeit“ erzeugt (Rosenthal 2005: 15). Letzterer Aspekt ist Ausgangspunkt des narrativen Verfahrens in der qualitativen Sozialforschung und bildet für Fritz Schütze den Anknüpfungspunkt für die Entwicklung seiner Methode, die nun weiter expliziert werden soll.
2.1 Das narrative Interview in der sozialwissenschaftlichen Forschung
Das narrative Interview geht auf den Soziologen Fritz Schütze zurück, der die Methode Ende der 1970er Jahre unter einer Vielzahl US-amerikanischer Wissenschaftseinflüsse, wie der Chicago School, des Symbolischen Interaktionismus sowie der Grounded Theory von Strauss und Glasner, entwickelt hat (Küsters 2009: 18). Die grundlegende Annahme der Methode ist, dass soziale Wirklichkeit nicht außerhalb des gesellschaftlichen Handelns existiert, sondern jeweils im Rahmen kommunikativer Interaktionen hergestellt wird. Soziale Wirklichkeit ist demnach keineswegs statisch, sondern wird von jeder Interaktionssituation in einem „ongoing social progress“ aufs Neue aktualisiert (Küsters 2009: 18). Hieran knüpft die eingangs erwähnte rekonstruktive Forschungslogik an: um die durch Kommunikation konstituierte soziale Wirklichkeit zu untersuchen, müssen die kommunikativen Interaktionen sinnverstehend analysiert werden. Dabei geht es weniger um die Inhalte der sprachlichen Interkationen als vielmehr um die Inhaltskonstitution, also wie die gemeinsam geteilte bzw. hergestellte soziale Wirklichkeit mit der sprachlichen Interaktion zusammenhängt; anders formuliert: welcher Zusammenhang besteht zwischen den Äußerungen eines Individuums und seinem tatsächlichen Handeln (Küsters 2009: 18).
Damit orientiert sich dieses Theoriegebäude zugleich an den drei hauptsächlichen Zielen qualitativer Sozialforschung, nämlich der Erfassung subjektiver Sichtweisen, der Erforschung interaktiver Herstellung sozialer Wirklichkeiten und schließlich, der Identifikation kultureller Rahmungen sozialer Wirklichkeiten (Küsters 2009: 19). Ungeachtet einer dieser Ausrichtung, ist die Hauptintention jedoch „Lebenswelten von innen heraus zu beschreiben, also die jeweilige soziale Wirklichkeit in der Perspektive der Individuen zu rekonstruieren“, wobei einerseits die soziale Wirklichkeit aus Sicht des Individuums zu beschreiben ist und andererseits erforscht werden muss, wie diese Perspektive selbst beschaffen ist (Küsters 2009: 19). Darüber hinaus muss die Analyse über das explizit geäußerte des Individuums hinweg reichen und jene Daten erfassen, die der Informant nur implizit oder symptomatisch äußert (Küster 2009: 20).
Obschon der qualitativen Sozialforschung dafür eine Vielzahl an Instrumentarien zur Verfügung steht, ist dem Wissenschaftler ein direktes Erfassen solcher latenter Strukturen, Deutungsmuster und Sinnbezüge, in Form eines „Abfragens“, nicht möglich. Dies folgt daraus, dass Individuen nur „sehr begrenzt in direkter Weise als Informant für ihre subjektive Sicht auf die Welt fungieren“ können (Küster 2009: 20). Aus diesem Grunde muss sich die qualitative Sozialforschung indirekt funktionierender Methoden bedienen (ibidem).
All diesen Ansprüchen zollt die interpretative Analyse narrativer Interviews nach Schütze ausreichend Tribut: erstens wird eine theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch die WissenschaftlerInnen erst dann vorgenommen, wenn seine Strukturierung durch die beforschten Individuen erhoben sowie analysiert ist und zweitens wird gewährleistet, dass „bedeutungsstrukturierte Daten“ exklusiv durch die „Kommunikationsbeziehung mit dem Forschungssubjekt“ erhoben werden, die den Kommunikationsregeln des Beforschten und nicht der wissenschaftlichen Forschung folgen (Küsters 2009: 19 f.). Letzteres wird dadurch gewährleistet, dass entgegen standardisierten Interviews keine vorgegebenen Antwortkategorien offeriert werden.
Alles in allem verspricht die Methode nach Schütze dem Befragten genügend Gestaltungsspielraum für die vereinbarte Interviewthematik zu geben, ihm aber trotzdem heikle bzw. latente Informationen zu entlocken, was schließlich zur möglichst unverfälscht Erfassung der Redeweise des Befragten führt (Küsters 2009: 21); sehr erfolgreich zeigt sich dies auch im vorliegenden Interview. Darüber hinaus ermöglicht die besondere Gestaltung der Erhebungssituation, den Befragten zum Wiedererleben von Vergangenem zu bringen und ihn zur möglichst umfassenden Reproduktion seiner Erinnerungen daran zu animieren. Hierbei arbeitet der Forscher mit einer einzigen Frage, die den Befragten zu einer spontanen „Stehgreif- Erzählung“ veranlasst, die er daraufhin ununterbrochen entfalten kann. Erst nach Beendigung dieser, vom Befragten autonom gestalteten Erzählung, greift der Forscher das zuvor Erzählte auf und schließt mit Rückfragen an, welche wiederum möglichst erzählgenerierend gestellt werden (Küsters 2009: 21 f.).
Evident ist zwar das stark asymmetrisch verteilte „Rederecht“ und die „künstliche“ Interviewsituation; indem letztere aber auf natürlichen Kommunikationsmechanismen beruht und versucht, sich diese zunutze zu machen, imitiert das narrative Interview dennoch eine alltägliche Kommunikationssituation4. Letztlich gilt es damit eine unbeteiligte Person in dem Maße zu informieren, dass sie vergangene Handlungszusammenhänge nachvollziehen und daraufhin ein Verständnis für die erzählte Geschichte sowie die entsprechenden Handlungsentscheidungen entwickeln kann (Küsters 2009: 22).
In einem erfolgreichen narrativen Interview bringt also der Interviewer den Befragten dazu, die „innere Form der Erlebnisaufschichtung“ bzw. „Erfahrungsaufschichtung“ wieder zu aktualisieren und in Form einer Stehgreif-Erzählung, den damaligen Erlebnisstrom, durch Reanimation der „kognitiven Figuren“, zu reproduzieren (Küsters 2009: 23).
3. Das narrative Interview
Gerüstet mit dieser theoretisch-methodischen Rahmung wird im Folgenden das von mir geführte Interview ausgewertet, wobei nicht nur die narrativen Segmente berücksichtigt werden. Es wird auch versucht, die nicht in die Erzählung eingebetteten Beschreibungen und Argumentationen, in ihrem Zusammenhang zu den narrativen Textteilen, zu interpretieren. In Anbetracht der bereits erwähnten Darstellungsbeschränkung dieser Arbeit sowie der Seminaranforderungen wird das Interview nicht vollständig interpretiert, sondern lediglich einzelne, frappierende Textpassagen. Die entsprechenden Textstellen sind vor allem nach dem Konzept der „Irritation“ ausgesucht worden5: häufig gibt es in Biographieerzählungen Erzählinhalte, die merkwürdig, unpassend und wenig plausibel erscheinen oder gar quer zu den eigenen Erwartungen und völlig überraschend auftauchen; meist sind dies problematische Stellen im Gespräch, dort, wo der Gesprächsfluss stockt, Missverständnisse auftauchen oder sich das Verhältnis umkehrt und der Forschende ausgefragt wird. Diese dürfen jedoch grundsätzlich nicht als Interviewerfehler begriffen werden, sondern als erste Hinweise auf Brüche in der Präsentation der Lebensgeschichte. Im Laufe des langwierigen Auswertungsprozesses können daraufhin strukturgleiche Szenen gesucht, geprüft und zu Irritationsmustern verknüpft werden, die wiederum weitere und neue Bedeutungsfelder eröffnen (Klein 2000: 84).
So gut wie möglich wurde auch in vorliegender Arbeit nach diesem Konzept verfahren; Ausgangspunkt der Analyse ist dennoch zunächst die autonom gestaltete Haupterzählung des Befragten. Die gesamte Interpretation schöpft sich aus der von mir erstellten Transkription.6 Bei der Transkription selbst, wird das im Annex zuvor dargestellte Transkriptionsregelsystem verwendet, welches nach einer sogenannten mittleren Transkriptionsgenauigkeit gewählt wurde.7
Gemäß der Logik eines biographisch-narrativen Interviews, gab es bei der Konzeption der Erhebung sowie der Auswertung keinen vorweg konstruierten theoretischen Bezugsrahmen. Die Ausgangsfrage nach der biographischen Verankerung bzw. Determinierung von „Krankheit“ bzw. „Arbeit“ oder „Beruf“ präformierte die Auswertung nicht, sondern blieb offen für die mögliche Diagnose eines positiven oder negativen Zusammenhangs. Schlussendlich sind in diesem Interview, speziellerweise, beide Konzepte „unter einen Hut“ zu bringen.
3.1 Zur Person
Das Interview wurde mit einer männlichen Person geführt. Zum Zeitpunkt des Interviews ist der Befragte 43 Jahre alt, deutscher Staatsangehörigkeit, durchschnittlicher Statur sowie gewöhnlich dezenten Kleidungsstils. Geboren und aufgewachsen ist er in einer deutschen Großstadt, in der er, abgesehen von einem kurzen Studienaufenthalt, durchweg ansässig ist. Er entstammt einer Akademikerfamilie, sein Vater hielt eine geisteswissenschaftliche Professur inne, seine Mutter war Lehrerin. Der Befragte ist ledig, hat keine Kinder und bewohnt alleinstehend, seit mehreren Jahren, die identische Wohnung. Seit Geburt leidet er an Muskelatrophie, sitzt jedoch erst seit Ende der 1990-er Jahre im Rollstuhl. Nach mehreren Erwerbstätigkeiten im Angestelltenverhältnis diverser Branchen, ist er, nunmehr seit über zehn Jahren, als Diskothekenbetreiber und seit circa vier Jahren, als Gastronom selbständig. Mit sukzessiver Verschlechterung seiner Muskelatrophie nimmt er seit wenigen Jahren auch selbstorganisiert Pflegedienstleistungen in Anspruch. Seinen Lebensunterhalt bestreitet der Befragte offensichtlich vollständig selbstragend, durch seine Selbständigkeit, könnte jedoch, nach eigenen Angaben, eventuell, auf Unterstützung des Vaters zurückgreifen.
3.2 Kontaktherstellung
Nachdem die ersten Versuche scheiterten meine zunächst favorisierten Interviewpersonen, exklusiv zum Thema „Arbeit“ bzw. „Beruf“, zu rekrutieren, suchte ich nach Alternativen. Wochen vergingen, bis ich, in einem beiläufigen Gespräch, meiner Schwester von dem Seminar, meiner Aufgabe und den Findungsschwierigkeiten einer geeigneten Befragungsperson erzählte. Prompt fiel der Name meines Befragten, woraufhin sie sich bereit erklärte, als Türöffner zu fungieren und den Kontakt herzustellen, indem sie meine Mobiltelefonnumer vermittelte.
Der erste Kontakt mit meinem Befragten erfolgte dann per Telefon. Nachdem wir uns mehrmals verpasst hatten und uns gegenseitig Sprachnachrichten auf die Mailbox hinterließen, telefonierten wir schließlich, nach dem dritten Anlauf, miteinander. Zunächst schilderte ich nochmals den Hintergrund sowie mein Forschungsinteresse und gab nachdrücklich die Zusicherung zur Wahrung der Anonymität im Datenumgang. Ohne weiteres erhielt ich die Gesprächszusage und in gleicher Weise unproblematisch einen zeitnahen Termin zum Interview. Insgesamt war der Befragte am Telefon sehr empfänglich und offen für das Projekt: die simultane Aufzeichnung des Gesprächs wurde als selbstverständlich angesehen.
3.3 Gesprächsdaten, Gesprächssituation, Grenzphänomene
Das Interview habe ich am Donnerstag, den 1. Juli 2010, um 13.00 Uhr geführt. Die reine, mittels Tonband aufgezeichnete Interviewzeit beträgt 02:19:01.8 In Anbetracht der Tatsache, dass wir einen barrierefreien Interviewort benötigen, erschöpft sich die Auswahl eines geeigneten Treffpunktes rasch. Vor diesem Hintergrund findet unser Gespräch in einem der buchbaren Gruppenarbeitsräume der Goethe-Universität, auf dem Campus Westend, statt. Wir sind vor dem Haupteingang des Hauptgebäudes verabredet und ich begrüße, zunächst etwas verunsichert, zwei Personen, woraufhin ich über die Begleitung als den Helfer bzw. Pflegedienst aufgeklärt werde. Die Rollstuhlrampe befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes, wir müssen ein Stück laufen. Obschon wir uns zum ersten Mal persönlich kennenlernen, hat die Begegnung etwas Vertrautes: wir führen Smalltalk und verstehen uns auf Anhieb, wobei aus diesem Vorgespräch, quasi wie verabredet, nichts Substantielles zum Interview hervorgeht. Die letzten Meter lasse ich den Befragten und seinen Helfer alleine, um gekühlte Wasserflaschen aus der Cafeteria zu holen. Im Raum angekommen, verlässt uns der Helfer, nachdem er hinsichtlich Abholzeitpunkt instruiert wurde.
Der uns zugeteilte Raum ist der kleinste buchbare Gruppenarbeitsraum und ist für vier Personen ausgelegt. Uns stehen vier Stühle und zwei Tische auf drei Quadratmetern zur Verfügung, wobei das Mobiliar so viel Platz beansprucht, dass effektiv lediglich zwei Arbeitsplätze nutzbar sind, sofern man seine Kletterkünste nicht unter Beweis stellen möchte. Habe ich mir vorher noch Gedanken über die Sitzordnung gemacht, ergibt sich aus dieser Platz- und Inventaranordnungsproblematik zwangsweise unsere Sitzordnung: wir sitzen an einem Tisch direkt an der Tür; der Befragte am linken Tischende, mit dem Rollstuhl zwischen den linken Tischbeinen, wohingegen ich, tischmittig, an den rechten Tischbeinen Platz nehme. Insgesamt ist der Raum, typisch bildungsinstitutionell, neutral bzw. kahl gehalten, die Stühle etwas altersschwach, was sich mit entsprechenden Geräuschen durch das gesamte Interview zieht. Mangels Klimaanlage und aufgrund der 34°C Außentemperatur, herrscht eine hohe Raumtemperatur. Die Fenster sind während des gesamten Interviews gekippt, sodass Außengeräusche vom Campus unser Gespräch konstant, jedoch nicht erschwerend, mitprägen.
3.4 Das Gespräch: strukturell inhaltliche Beschreibung der Haupterzählung
Die sogenannte Aushandlungsphase des Interviews vollzieht sich außerordentlich rasch; simultan zum auffordernden Frageimpuls ratifiziert der Befragte bereits die Erzählaufforderung und kommt mir fast sogar entgegen, was im Anfangssegment an den wiederholt affirmativen Antworten bzw. Einschüben während meiner Einleitung deutlich wird (1-30). Die Ratifizierung bildet den Abschluss der Aushandlungsphase, woraufhin die Haupterzählung beginnt (31 ff.).
Im ersten Segment der Haupterzählung schildert der Befragte seine Schullaufbahn, er nennt seinen Geburtsort und sein Geburtsjahr und geht auf den Beruf seiner Eltern ein. Mit Erwähnen seiner Eltern folgt eine Problematisierung seine Krankheit, woraufhin er vorweg deklariert, dass er „normal“ und „ohne Sondermaßnahmen“ aufgewachsen sei. Deutlich wird hier bereits der Stellenwert der Krankheit, die sich durch die gesamte Biographie zieht und als Schwerpunkt deutlich hervortritt. Insbesondere das mehrfache Wiederholen des „normal“ sowie die Tatsache, dass der Befragte diese Klarstellung zu Beginn anführt, verstärkt die hohe Priorität der Krankheit in seiner Biographie. Zugleich wird hier bereits implizit die Einstellung bzw. Erwartung des Elternhauses deutlich, mit welcher der Befragte, schon in frühen Jahren, konfrontiert wurde, nämlich einem „normalen“ Lebensweg, ohne Sondermaßnahmen zu bestreiten.
Nachdem der Befragte in der „Erzählpräambel“9 die Perspektive verdeutlicht hat, aus welcher die Biographie (die Einstellung seines Elternhauses zur Krankheit) zu verstehen ist, folgt die Skizzierung seines inhaltlichen Vorgehens bei der nun folgenden Erzählung (56-64).
Daraufhin wird zunächst quasi der tabellarische Lebenslauf geschildert (65 ff.): man erfährt, dass der Befragte nach der Grundschule auf einer Gesamtschule Abitur macht, dann ein Studium beginnt sowie die Fachrichtung, nach einem halbjährigen Aufenthalt in einer anderen deutschen Großstadt, wechselt; später arbeitet er in einer Agentur und eignet sich betriebswirtschaftliche Grundlagen autodidaktisch an, bis er Veranstalter wird und sich im Zuge des erfolgreichen Geschäfts mit einer Diskothek sowie zuletzt mit einer Gaststätte selbständig macht, wobei die Unternehmung mit „nem Freund“ mittlerweile kurz vor der Insolvenz steht. Interessant ist an dieser Stelle der Bezug zur Gegenwart, der im Weiteren mehrmals hergestellt wird. Diesem „groben Raster“ in der Erzählung folgt ein Wechsel hin zu seiner Krankheit, wobei er „grob“ die drei Verläufe der spinalen Muskelatrophie expliziert (77-83).
Nach diesem zweiten Segment der Haupterzählung geht es für den Befragten sozusagen ans Eingemachte (77 ff.): er leitet über zum Familiären, wobei er ankündigt, nun zu den „härteren Geschichten“ zu kommen. Erneut ist die Krankheit zentraler Aspekt und prägt „die gesamte Familiengeschichte“. Man erfährt, dass seine Mutter Selbstmord beging und dass er bis in die 1990er Jahre „humpelnderweise“ gehen sowie bis vor sieben Jahren auch noch Auto fahren konnte. Nachdem sich 1989 durch einen Oberschenkeldurchbruch sein Gesundheitszustand verschlechtert, nimmt er, über das Sozialamt, selbstorganisierte Pflege in Anspruch und hat nach einem zweiten Unfall 2006, bei welchem sich ein Durchbruch beider Oberschenkelhalsknochen ereignet, erhöhten Pflegebedarf. Diesen Teil der Haupterzählung konkludiert er erneut mit dem Bezug zur Gegenwart, indem er äußert, dass es ihm gerade ein bisschen reicht.
Zugleich erfolgt an dieser Stelle ein Wechsel des Erzähltypus. Im Folgenden werden bis zum Ende der Haupterzählung biographische Erzählsegment durch längere Evaluation im Argumentationsschema ausgeleitet. Solche Evaluationen, in denen der Befragte beispielsweise die Bedeutung des geschilderten Vorgangs für den Fortgang der Geschichte bewertet, sind durchaus üblich in Biographischen Interviews; auch können neben Erzählsegmenten, in die wiederum andere Schemata eingebunden sind, oftmals Segmente vorkommen, die keine Narrationen enthalten und lediglich aus Argumentationen oder Beschreibungen in „Reinform“ bestehen. Problematisch ist in dem vorliegen Fall allerdings, dass die „erklärenden“ Elemente, im Laufe des Interviews, Überhand nehmen. Gepaart mit mehrfachen Bezügen zur Gegenwart, erfährt die Erzählung, durch den hohen Grad an Erklärung und Selbstreflexion des Befragten, stellenweise eine psychoanalytische Aufladung. Läse man lediglich Ausschnitte des Interviews, könne man vermuten, dass die erzählgenerierende Fragestellung anfänglich etwa hieß: reflektieren Sie sich im Rahmen Ihres Lebenslaufs; zeigen Sie auf, was Sie in ihrem Leben genauso, was Sie anders gemacht hätten und wie es Ihnen dabei ging.
B:..(trinkt) ja, das hat natürlich also, wenn ich, ..mich selber betrachte oder wenn man sich das so ankuckt, natürlich nach hinten hin, ist die, ehm, in der Rückwärtsbetrachtung, die Summe der Ereignisse und die Verarbeitung der Ereignisse, ich mein das ist klar, bei so ner Biographie. Sowieso‚ s gibt was grundsätzliches, an dem ich (uv) jeden Tag immer wieder aufs Neue zu tun hab und, ehm, aber es gibt natürlich auch, einfach, Sachen die, unabhängig von allem, von Behinderung, etc. einfach auch einer Verarbeitung bedürfen. Und ich könnte, also, zu allem, eigentlich sagen, dass, dass, ehm, sich das Positive und das Negative sich immer die Hand gegeben hat, ehm. (124-131)
Also es ist eine, natürlich eine Biografie, die mit relativ vielen Extremen irgendwie..und einer, sozusagen einer Grundkomponente..ehm, zu tun hat, dass natürlich diese, diese.. Selbstwahrnehmung einer Krankheit, oder des, also da wo es dann anfängt, ehm. Ja, wie auch immer, philosophisch existenziell oder so zu werden, dass das, ehm, immer eine Rolle gespielt hat und eine Rolle gespielt hat, was für Entscheidungen hat man getroffen oder wo hat man sich hinbewegt. Und wenn ich mir diesen, das mal so anschauen, ehm, und mich als, ..also biographisch, ..wiederfinde…ehm..im Sinne von…wo bin ich eigentlich da drinnen, ..ehm, dann wird es eigentlich ganz spannend: wie habe ich auf Zäsuren reagiert und wie habe ich sozusagen versucht, ehm, ehm, dagegen zu halten aber nicht um des Selbstwillen, sondern natürlich vor dem Hintergrund auch, irgendein Leben zu gestalten und zu führen. (131-142)
Also das ka, kann ich nicht anders sagen, es war auf einmal,.. war es so, als ob so n paar Knoten gelöst werden, also, das ist immer wieder, …kann man so wahrscheinlich gar nicht beantworten, was dann da teilweise psychologisch oder auch rein auf der Neuroebene dann stattfindet, warum das dann so ist und vorher wirklich alles nur noch schwarz war. (242-248)
Und das ist, halt in dem Ganzen, ehm, die Schwierigkeit, weil wenn man, wenn ich das durchleuchte, also in der Selbstanalyse, sofern das überhaupt, ehm, ich mein da kann man jetzt tausend tolle Sätze zu sagen (lächelt). Aber ich mein, man is halt, natürlich auch ein bisschen, das Produkt seiner Umwelt, seiner Verhältnisse,..und, ehm, es ist halt doch, ehm, es hat halt seinen Preis. Aber es hat natürlich in dem, wenn, wenn ich, wenn es einem gut geht, ehm, dann, ehm, einfach da…also sozusagen, das, was man sich vorstellt auch in irgendeinem, also zumindest Wirklichkeit ist, und das war, war am Anfang der Fall. (327-333)
B: Gut also das wäre jetzt vielleicht, der, des, ehm, ja, jetzt..des is so ne Art Interpretation der, meiner Lebensabschnitte, ehm. (435-336)
Bewusst unterbreche ich den Befragten nicht und greife auch nicht in seine nicht mehr stringent chronologische Darstellung ein, denn neben einer zerstörerischen Komponente für die Erzählgestalt, würde es womöglich nicht zu den für die Analyse elementaren und hochrelevanten Aspekten führen. Für die Methode nach Schütze ist nämlich insbesondere die Einbettung des Erzählten in explanative Elemente relevant, genauso wie das Abrufen bzw. Aktualisieren der Erinnerung in der Art, wie sich das Erlebte „aufgeschichtet“ hat. Leider kann, wie bereits erwähnt, eine derartige rekonstruktive Analyse, aufgrund des beschränkten Rahmens, nicht geleistet werden, weswegen im Folgenden, entgegen dem eigentlichen methodischen Vorgehen, eine gewisse Chronologie hergestellt wird und die Auswertung lediglich nach besonders signifikanten Aspekten erfolgt.
3.5 Problematisierung
Seine Vita betrachtend, vergleicht er seine Familie mit „Hotel New Hampshire“, „wo auch dauernd, die ganze Familie, irgendwelche Leute […] mit Flugzeugen ab[stürzen] und […] dauernd irgendwas [passiert]“ (157-159). Der Roman von John Irving bzw. die Tragikomödie bietet eine Fülle an komischen, skurrilen wie auch tragischen Situationen und Charakteren. Vor diesem Hintergrund leitet dieses Charakterisierung treffend in die daraufhin folgende Erzählung des Befragten.
In seiner „normalen“ Sozialisation lernt er die üblichen äußerlichen Erwartungen der Gesellschaft kennen und bekommt sie von seinen Eltern sogar aktiv vorgelebt. Daraus entwickelt er zunächst selbst eine „bürgerliche Vorstellung“ und hat fest vor, sich auch in diese Richtung zu entwickeln. Die „bürgerliche Vorstellung“ die der Interviewte hier äußert wird nicht spezifiziert, doch offenbart sich die Extension des Begriffes, die der Befragte hier für sich beansprucht, im Laufe des Interviews und kommt letztlich dem Begriff des „Bildungsbürgertums“10 nahe. Dies liegt insofern auf der Hand, als sich die Charakteristika des „Bildungsbürgertum“ im Elternhaus des Befragten, dem Beruf seiner Eltern (Professor und Lehrerin), seinem Bildungsweg („normale“ Schule) sowie seinem Wunsch ein Jurastudium zu beginnen bzw. einen Lebensweg einzuschlagen, der seinem „Background“ angemessenen ist (ähnlich seinem Onkel), manifestieren.
„Und für mich war aber immer wichtig, dass mit Lebens, eh, ehm, schon mit ner klaren Vorstellung vom Leben zu verknüpfen und habe dann irgendwann gemerkt allerdings, dass ich..(atmet ein) nicht die Kraft oder auch nicht die, die Fähigkeit in mir spüre, dass dann so zu leben, wie ich mir das so ausgeschmückt hab. Also das war, also eigentlich ein, ehm. Also mein Wunsch war größer in der, sozusagen in der Lebensweise, wie ich das von Elternseite zum Teil vorgelebt bekommen hab, als an dem tatsächlich handwerklichen, an der Juristerei, im Sinne von, ehm, büffeln, lernen ecetera.“ (199-206)
„okay, also ich will eigentlich so leben dann au wie mein Ongl, der is au Jurist und möchte eigentlich so ne, ja, ..so das Schillernde im Leben hat mich da schon immer angezogen und gereizt. Und, un' natürlich, ehm, man is auch nur dann was in der Politik, wenn man Jurist ist, und, es sei denn natürlich man ist Metzgersohn wie der Fischer (lachend), dann kann man natürlich auch was werden, aber, ehm..“ (875-879)
„Und in diesem Parkturnier das ist deswegen bekannt, weil der Fischer da mitgespielt hat, früher. Und bzw. dann immer noch..und aus diesem Background komme ich, muss ich dazu sagen. Also ..der… die erste Frau vom Fischer war meine Bezugsperson im Kinderladen und des is so n bisschen, also aus der ganzen Ecke..da bin ich so groß geworden, Kinderladenkind und, also sehr politisch geprägten Background hab ich..und.“ (567-572)
Diese gesellschaftliche Verortung ist, meines Erachtens, handlungsanleitend für den Interviewten und fundamental für seine Lebensgeschichte, da auf dem Befragten schon allein aufgrund seiner gesellschaftlichen Provenienz ein immenser Druck lastet: er hat es mit einer „plaktiven“ Welt zu tun, wie er im Laufe der Jahre selbst lernt und im Interview mehrmals äußert; in einer solchen, so kann man dem Interview entnehmen, gilt es, die gesellschaftlichen Erwartungen, die von seinem Elternhaus durchweg aufrecht erhalten wurden, zu erfüllen (etwa eine akademische Ausbildung; dem Gefallen am „Schillernden“; dem Kontakt zu vermeintlich bekannten und namhaften Gesellschaftsmitgliedern, denn nur mit einem bekannten Namen oder durch eine juristische Ausbildung hat man „in der Politik“ etwas zu sagen).
Zu Recht visiert er eine solche „bürgerliche“ Selbstverwirklichung an, denn er sieht und „spürt“ eine Andersartigkeit aufgrund seiner Krankheit zunächst nicht; in jungen Jahren tritt sie lediglich diagnostisch, aber nicht manifest zum Vorschein: er kann laufen, ist gesellschaftlich integriert und es geht ihm in seinem „schulischen Verbund […] gut“; er hat „Spaß“ am Leben und wächst bis zum Abitur behütet auf. Eine erste Auseinandersetzung mit seiner Krankheit erfolgt erst nach dem Herauslösen aus jener behüteten Umgebung, nämlich nach dem Abitur und seinem gescheiterten Versuch, in einer anderen deutschen Großstadt, Fuß zu fassen. Bis dahin besteht, aufgrund der unbeschwerten Zeit, kein Anlass zur Beschäftigung mit seiner Behinderung.
„ehm, also ich hab mich, ehm..also früher auch nichts in der Richtung gespürt, was mich jetzt so.., ehm.. verschieden gemacht hätte, als dass ich, ehm …“ (147-148)
„Ich hab mich mit 20 sehr massiv mit meiner Krankheit auseinandergesetzt, zum ersten Mal eigentlich richtig.“ (169-170)
„Ich bin kein Schöpfer, ehm, also, ich kann mich selber nicht heilen, aber da liegt was vor. Und ehm, ich mein, ich hab nie gefragt, oder ich musste nie fragen, weil mein Leben, trotz auch dem Tod meiner Mutter, ja, eigentlich, ehm, ich war in einem schulischem..Verbund, (lächelt) mir ging es gut, tatsächlich. Also ich würde sagen, ich hab, ehm…ich hab einfach gelebt und auch Spaß daran gehabt (lächelt), ehm. Deswegen war das nie das, das Ding gewesen. Und ich hab einfach über die Erfahrung, (atmet ein)..dem Bruch nach dem schulischen und dann eigentlich so ne…..glaub ich ne sehr bürgerliche Vorstellung entwickelt, dass ich es eigentlich im familiären Leben gleichtue und auch irgendwie Jurist werde und hab halt zum ersten Mal gesehen, ok (atmet ein) dieser mir v, irgendwie diesen Lebensweg, den ich mir so n bisschen vorstellt hab, das wird so nix. Und das war, halt dann, also ein Verlustschmerz und dann einhergehend mit der Sache, ich, es ist hier was anderes, (atmet ein) sozusagen: was isses? Ehm…Ich kann’s nicht, ehm, spüren, und ich kann nur sehen, ok, ehm, das hat alles ne philosophische Komponente. Ich bin mit meiner Lebenssituation, ehm…die vielleicht ähnlich wie Aidskranke, oder andere überhaupt Kranke, aber ich habe eine Krankheit, die hab ich, Punkt.“ (178-192)
Als er sich „massiv“ mit seiner Krankheit auseinandersetzt, lernt er, dass er sich von der „bürgerlichen Vorstellung“ und dem „normalen“ Lebensweg, wie er bislang durch die Eltern suggeriert wurde, verabschieden muss und dieser augenfällig nichts mit seiner Realität zu tun hat. Die Beschäftigung mit seiner Behinderung zieht eine große Depression nach sich: die Bewusstwerdung ist verständlicherweise nun umso schwieriger, da er sein Leben jahrelang „normal“ geführt hat. Die Wortwahl des Befragten verdeutlicht das Ausmaß seiner Depression, bedeutet doch das Wort „massiv“, abgeleitet von der Masse, etwas Schweres, wuchtig Wirkendes bzw. etwas unangenehmem, heftig und in grober Weise Erfolgendes. Zugleich ist der Ausdruck „sich mit etwas auseinandersetzen“ stark negativ konnotiert, zieht er doch eher eine Assoziation der kritischen, problematischen Beschäftigung mit einem Sachverhalt nach sich; so stimmt bereits die Wortwahl auf die sich später immer manifester werdende mangelhafte Krankheitsverarbeitung des Befragten ein.
Die Bewusstwerdung des Ausmaßes seiner Behinderung und die Realisierung, dass seine Realität sukzessive weniger mit derjenigen korrespondiert, in der er sozialisiert wurde, stellt für ihn ein „Zurückgeworfensein“ bzw. eine „Beleidigung“ dar. Die Ausdrucksweise des Befragten ist hier erneut anschaulich und verständlich: glaubte er bislang sich, wie alle anderen, verwirklichen zu können, in der Gesellschaft angekommen und integriert zu sein, muss er immer expliziter lernen, dass er nicht egalitäres Gesellschaftsmitglied ist, er sozusagen vom Club der „Normalen“ abgewiesen wird und dessen Eintritt ihm krankheitsbedingt verwehrt bleibt.
„Und dann hat da irgend so 'n Yuppieschnösel halt dann, irgend, irgendwie so mich dann gefragt, das war dann auch so gleich so n’ Schlüsselereignis: Sag mal ist das, was du hast, ansteckend (lachend).“ (897-899)
Das ihm nun zugewiesene Label der Gesellschaft „Behinderter“ und das Innehalten eines gesellschaftlichen Minderheitenstatus ist der Super-GAU für ihn.
„B: Ja und dann kam eben diese Phase, was ich schon auch beschrieben hatte. (trinkt) Natürlich wahnsinniger Frust über das Scheitern und ehm, und dann ehm, eben dieses..dann hat das eigentlich das ganze Jahr lang, war dann, dann ging‘s nur noch um diese Behinderung, eigentlich, dann, nur um die Krankheit.“ (955-958)
Zutiefst ist er über sein Scheitern in der anderen deutschen Großstadt, das ihm den „Realitätsabgleich“ gebracht hat, deprimiert. Interessant ist in diesem Segment (902-954), dass der Befragte den „symbolisch[en]“ Charakter anführt und die Aktion als „Flucht von Berlin“ beschreibt, obwohl er anfänglich Berlin „immer auch als n riesengroßen Abenteuerspielpatz begriffen“ hatte und man zunächst annimmt, er fühle sich dort wohl. Diese Formulierungen verdeutlichen erneut die Intensität des Empfindens seines Scheiterns und konkretisieren seine emotionale Verwundung. Darüber hinaus wird seine Depression durch die Tatsache verstärkt, dass ihn sein Onkel abholt, der anfänglich als Vorbild fungierte. Versucht der Interviewte zunächst mit dem Studienbeginn in Berlin zu demonstrieren, dass er trotz Krankheit „normal“, selbständig und genauso fähig wie andere Familienmitglieder ist (hier sein Onkel als Vorbild), scheitert er bereits bei seinem ersten Versuch, was dem Befragten nur noch nachdrücklicher zeigt, dass er eben nicht „normal“, sondern behindert ist und seine Krankheit zwangsweise Auswirkungen auf seine Lebensgestaltung hat.
Diese Scheitern-Situation ist elementar für die Lebensgeschichte des Interviewten, denn sie leitet eine Wende in seinem Leben ein. Aus diesem Umbruch heraus, entwickelt er eine Strategie, die ihm aus der Depression, dem „Zurückgeworfensein“ und wieder zurück „ins Leben“ hilft.
„Ich musste dann erstmals sozusagen für mich begreifen, ehm, daraus was machen, dass ich an der Sache nicht vorbeigehe und dass ich mich, mir diese Sache so stell, dass ich, ehm, halt sehr aktiv stehe und da…[…] Und ich denke, ich habe da, ehm, aus dieser wirklich schweren Depression heraus, da hab ich eigentlich keine psychologische Hilfe gehabt, ich hab mich dann irgendwann ins Leben gestürzt wieder, das war dann, ehm. Das war dann in den, ehm, also das war 87, 88 wo’s mir schlecht ging, und dann hat sich das eigentlich..auf ne relativ…ehm…positive Art dann doch gelöst, weil ich aus diesem…aus diesem Moment heraus, ehm, relativ große Energie entwickelt habe.“ (208-220)
„Dieses Aktive hat sich dann so entwickelt, dass ich so ne Art, ehm, ja, so ne Lebenslust auch entwickelt hab über das was sozusagen sich auch bisschen der Normalität entzieht und bin dann eigentlich relativ viel dann, also in dem, ehm, 90, 91..so in der Zeit..war ich dann relativ umtriebig im Nachtleben und hab halt mir sozusagen dann gesagt, naja lässt‘s dir doch einfach gut gehen. Also hab ne ziemlich hedonistische Lebensphase eingelegt. […] Eigentlich auch mit ner, also, ehm. mit ner relativ merkwürdigen Stabilität in dem Ganzen, weil es mir, ehm, gut ging. Also das ka, kann ich nicht anders sagen, es war auf einmal,.. war es so, als ob so n paar Knoten gelöst werden, also, das ist immer wieder, …kann man so wahrscheinlich gar nicht beantworten, was dann da teilweise psychologisch oder auch rein auf der Neuroebene dann stattfindet, warum das dann so ist und vorher wirklich alles nur noch schwarz war.“ (233-248)
Zugleich findet er damit einen Weg, sich quasi selbst zu therapieren, indem er große Energie entwickelt, aktiv wird und einen „Aktionismus“ an den Tag legt, der sich „der Normalität entzieht“.
„Sehr entscheidend ist glaub ich, tatsächlich dieses Grundmotiv, was auch immer wieder, ehm, so, dieses sich, was beweisen wollen und ehm, auch, natürlich, ehm, so dieses, also Kompensationskraftakte gepaart mit ner, ehm, auch mit ner, ehm, Erfahrungslust, ehm, und auch ner sozialen Gestaltungswillen, der sich aber, immer wieder auch, vielleicht durch, ehm, teilweise, also des, wie soll man das beschreiben, ja eigentlich so ne, mit, auch ner relativ großen visionären Kraft, also sich immer wieder an den Gegebenheiten stößt. Also das, was ich mir halt suche oder was ich brauche, sind dauerhafte Reibungsflächen, und für, also eigentlich, ein Rollstuhlfahrerleben reicht aus, wenn du.. einmal in Frankfurt, irgendwie von A nach B mit der U-Bahn fahren willst, da is eigentlich der Protest. Oder überhaupt, das is eigentlich schon, also das reicht eigentlich aus, deine... Das is für andere Leute, die (uv)..kannste das ganze Leben damit beschäftigen.
B: Für mich is, irgendeine, irgendwas steckt in mir drinnen oder hat in mir drin gesteckt, dass ich gesagt hab, nee, das akzeptier ich nicht. Und ehm, ich, also (atmet ein), krieg es formal nicht hin, so, so ne Kontinuität leg ich nich annen Tag, das politisch im normalen weg, irgendwann in dieser kleinst, also…mir ist… […] Dass ich aus dieser, aus diesem Zurückgeworfensein, aus so ner, aus so ner, Beleidigung eigentlich heraus, auch sehr viel, sehr viel, ehm, Energie, oder auch, einfach dieses dauernd gegen was ankämpfen, das is mir irgendwie, das, das hab ich halt in mir, also ich kenn, kenn keinen anderen Zustand mehr mittlerweile. Also das is..ehm..“ (436-456)
Vor dem Hintergrund seiner frühen Sozialisation des „Normalseins“, die durchweg von seinem Elternhaus aufrecht erhalten wurde, akzeptiert er nicht, dass seine Krankheit eine deterministische Rolle in seinem Leben spielt; er findet sich mit der „Vollkatastrophe“ nicht ab. Vielmehr sagt er seiner Krankheit, sich selbst und der „plakativen“ Welt, in gewisser Weise, den Kampf an, indem er fortan mit seinem Aktionismus beweist, dass er trotz seiner Behinderung alles kann.
„B: Und daraus is eben dieses, trotzdem dies entstanden, was ich auch vorher schon gesagt hab, diese, eigentlich immer dieser Ehrgeiz, doch irgendwas um- und durchsetzen zu wollen, das ist wahrscheinlich dann, ehm, (atmet aus) phh. Ich interpretier jetzt mal so, das hat, natürlich auch mit dem Vater irgendwas zu tun, halt dann doch ne Beweisführung, immer wieder zu sagen, hier kuck mal, ich bin trotzdem, ich kann alles oder so. Also das is, ehm. Also, weil diesen Ehrgeiz, dann selber so ne Disco zu machen, also ich hätt es mir, ehem (lachend) auch einfacher machen können.“ (663-669)
Diesen Plan verfolgt er ab diesem Zeitpunkt in extremer Weise. Anstatt sich das Ziel zu setzen 100% zu leisten, welches er durch seine Behinderung ohnehin so gut wie unmöglich vollbringen kann, verlangt er sich sogar 120% ab, um die „ganz große Leistung“ zu bringen und „nochmal eins draufzusetzen“. Das daraus resultierende „sich Beweisen“ ist zentraler Aspekt, denn es zieht sich durch seine gesamte Vita und ist zugleich ursächlich für seine „Berg- und Talfahrten“.
„joah, also das ist sicherlich schon sehr früh angelegt gewesen, ehm, dass ich mich, ehm, deswegen auch nicht, ehm, irgendwo in ein, in Anführungszeichen in ein normaleres.. Behindertenleben, ehm, herein begeben gab, sondern auch wirklich in einer Omnipotenz Kraftanstrengung heraus gesagt hab, ich lebe, wie die andern und ich lebe es sogar noch extremer. Also, wo is eigentlich das Problem.“ (500-504)
„B: Also ich bin…hab dann irgendwann halt die Formel für mich entdeckt, also, ich bin eigentlich unverwüstlich, das is halt, auch toll (lachend)..also, wenn man das dann irgendwann halt meint zu sein, ehm, aber das hat halt zu dieser, zu diesen Extremen geführt und da kann man natürlich, also, was ich bis da schon alles im Rucksack hatte, ehm, kann man halt schon auseinander (lachend) irgendwie basteln, ehm. Aber ich glaub, diese, also dies entscheidenden Häutung, oder wie man‘s nennt, das ist dann, da bin ich mir schon, also da war ich mir schon relativ im Klaren darüber…(trinkt) und habe mit einem ja, Aktionismus, meine, also so mein Alltag halt irgendwie gestaltet und ich, ja, bin mir eigentlich schon im Klaren darüber, was ich da eigentlich Verrücktes irgendwie, mit mir gemacht hab und zum Teil auch natürlich, also, wenn es jetzt auch nicht Nichts, also hat echt schon viel auf die Beine gestellt, aber es…“ (505-514)
[...]
1 S.h. Transkription im Annex bzw. Analyseteil
2 Hierzu wird primär auf den Ansatz von Fritz Schütze eingegangen, wobei auf die Werke Rosenthal (2005) und Küsters (2009) rekurriert wird, da entsprechende Konzeptualisierungen ebenda bereits vorliegen.
3 Siehe hierzu die bibliographischen Anmerkungen in Rosenthal (2005); Küsters (2009); Glinka (2003).
4 Diese ähnelt etwa einer Stehgreif-Erzählung mit Kollegen auf der Arbeit.
5 Vgl. hierzu: Klein, Regina (2000): BIOS Jahrgang 13 (2000) Heft. 1, Leske Budrich Verlag, S. 84
6 Siehe hierzu: Annex
7 In sozialwissenschaftlichen Arbeiten herrschen unterschiedliche Transkriptionsgrade: je nachdem, wie die Fragestellung der Untersuchung lautet und wie das Leistungsvermögen des Forschers ist bzw. welche Grenzen er bewusst setzt, kann das Sprechen nach laut und leise, bestimmt und zögerlich unterschieden werden, doch muss bspw. die genau Tonhöhe in der Transkription nicht erfasst sein. Jeder Transkriptionsgrad hat wissenschaftliche Vor- und Nachteile, wobei der Standard der „mittleren Genauigkeit“ für die Zwecke dieser Arbeit vollkommen ausreichend ist.
8 Vgl. Transkription im Annex. Zu beachten ist hierbei, dass auf der Tonbandaufnahme leider der Schlussteil des Interviews (Dank, Verabschiedung, etc.), aus unerklärlichen Gründen, fehlt. Glücklicherweise ist dies für die Analyse hier unerheblich. Vermutlich würde die effektive Interviewzeit dementsprechend 02:23:01 betragen.
9 Nach Schütze stellt der Befragte in der Erzählpräambel argumentativ fest, wie er sich selbst und den Zuhörern gegenüber seine nun folgende Erzählung verstanden wissen möchte.
10 Das „Bildungsbürgertum“ zeichnet sich durch folgende Charakteristika aus: eine akademische Ausbildung, ein besonderes Gruppenverhalten (mit Bildungs- und Sprachbarrieren eine elitäre Schicht bilden, zu der Ungebildete nur schwer Zugang bekommen), eine hohe Selbstrekrutierung sowie der Tatsache, dass gesellschaftliches Prestige wichtiger als wirtschaftliche Prosperität ist. Zudem gilt das „Bildungsbürgertum“ als „kulturelle Elite“ und besetzt Berufe, die die bürgerlichen Ordnungsentwürfe weitervermitteln.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Biografieforschung als qualitative Methode?
Ziel ist es, soziale Wirklichkeit durch die Analyse von autobiographisch-narrativen Interviews zu rekonstruieren und subjektive Sichtweisen sowie kulturelle Rahmungen zu erfassen.
Auf wen geht die Methode des narrativen Interviews zurück?
Die Methode geht maßgeblich auf den Soziologen Fritz Schütze zurück, der sie Ende der 1970er Jahre entwickelte.
Welche Schwerpunkte wurden in der Empiriephase des Seminars gesetzt?
Die Interviews konzentrierten sich entweder auf den Schwerpunkt „Krankheit“ (Einfluss auf den Lebenslauf) oder auf den Bereich „Arbeit/Beruf“ (Berufswahl und Schlüsselereignisse).
Was unterscheidet qualitative von quantitativer Sozialforschung?
Qualitative Forschung folgt einer Entdeckungslogik am Einzelfall und verzichtet auf Standardisierung, um den Individuen maximalen Gestaltungsspielraum bei der Datenerhebung zu lassen.
Welche Analyseschritte schlagen Schütze und Rosenthal vor?
Zu den Schritten gehören unter anderem die Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte sowie die Konstruktion von Typen anhand einer Fallrekonstruktion.
- Quote paper
- Alen Bosankic (Author), 2010, Biografieforschung – Eine qualitative Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265134