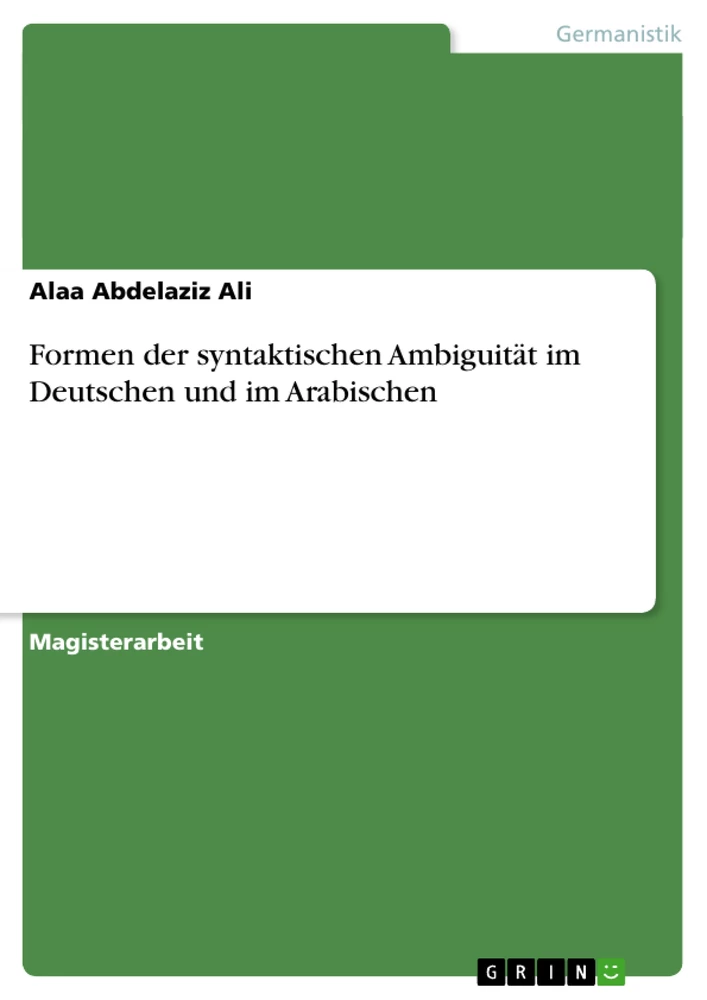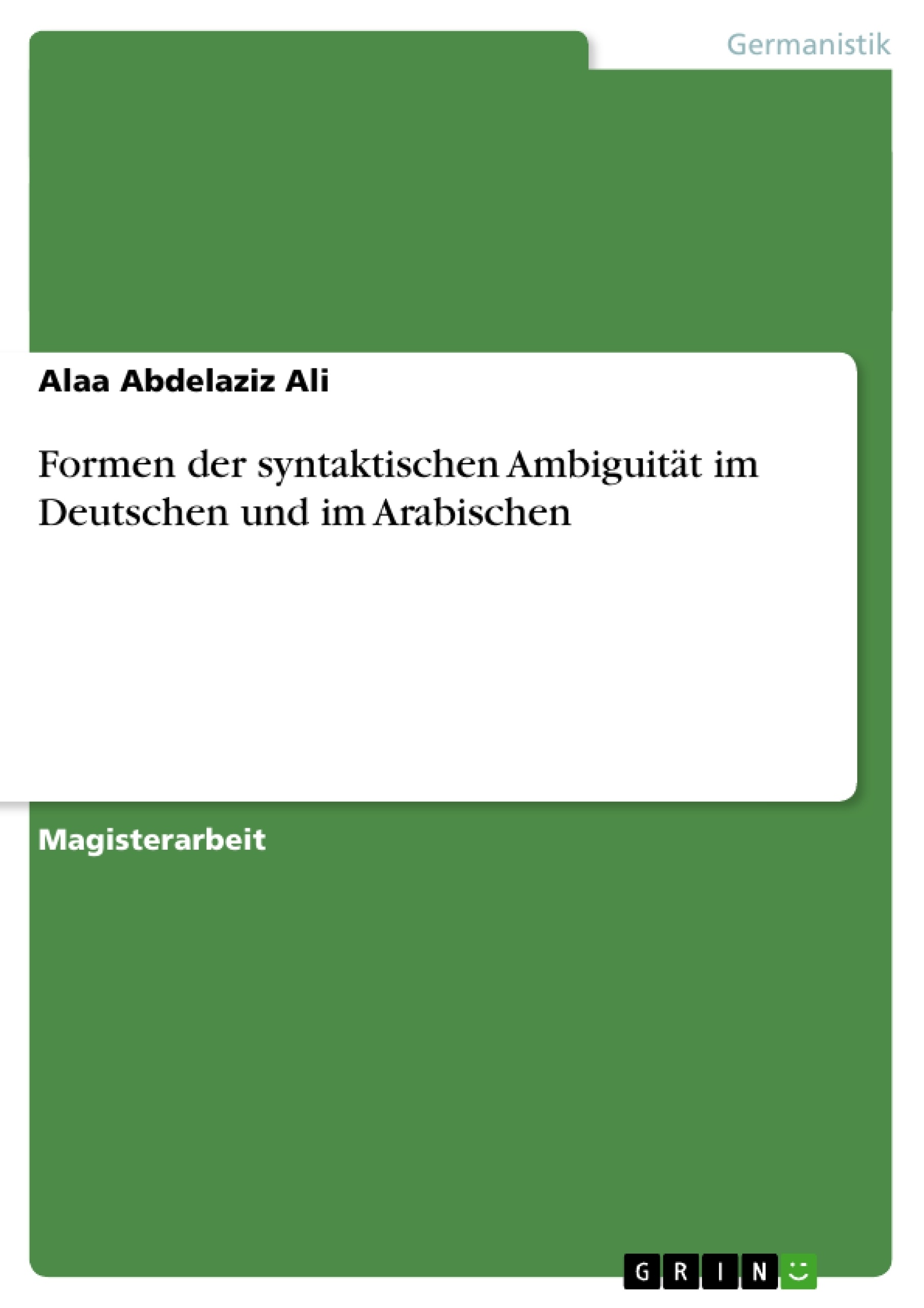Die Ökonomie der Sprache beruht genau darauf, dass uns eine endliche Menge von Ausdrücken zur Verfügung steht, mit der sich eine viel größere Menge von Situationen aus dem (mentalen) Lexikon wiedergeben lässt. Ansonsten würde die Zahl der Sätze sehr groß oder sogar unendlich. So kann derselbe Ausdruck in verschiedenen Kontexten ganz verschiedene Bedeutungen besitzen. Deshalb kommen wir mit einem endlichen Vorrat von Zeichen aus. Fast alle Inhaltswörter und auch ganze Sätze können mehrere Lesarten haben. Der Begriff „Ambiguität“ ist der Fachausdruck für dieses Phänomen.
Ambiguität existiert auf vielen linguistischen Ebenen. Damit lässt sich z. B. zwischen lexikalischer und struktureller Ambiguität unterscheiden; aber dies sind wiederum Sammelbegriffe für eine Vielzahl unterschiedlicher Probleme. Lexikalische Mehrdeutigkeit kann die beiden Phänomene Homonymie und Polysemie betreffen. In der vorliegenden Arbeit soll die Frage beantwortet werden, ob ein mehrdeutiges Lexem der Homonymie oder Polysemie angehört, damit die beiden Begriffe voneinander abgegrenzt werden können.
Strukturelle Ambiguität lässt sich den Kernpunkt der vorliegenden Arbeit bezeichnen. Sie tritt auf, wenn Worte auf unterschiedliche Weisen gruppiert werden können, oder wenn es verschiedene Interpretationen gibt, in welcher Relation Worte oder größere Konstituenten stehen. Die Bedeutung eines Satzes bzw. eines komplexen Ausdrucks ergibt sich also nicht nur aus der Bedeutung der Einzelausdrücke, sondern auch aus der Art und Weise, wie sie syntaktisch zusammengesetzt sind (der Struktur des Gesamtausdrucks).
Inhaltsverzeichnis
HINWEISE ZUR UMSCHRIFT
ABKÜRZUNGEN
0 EINLEITUNG
0.1 Problemstellung
0.2 Forschungsgegenstand
0.3 Ziel der Arbeit
0.4 Forschungsstand
0.5 Methode und Gliederung der Arbeit
Erstes Kapitel: AMBIGUITÄT IN NATÜRLICHER SPRACHE
1.1 Terminologie und Abgrenzung
1.1.1 Der Begriff Ambiguität
1.1.2 Ambiguität und Vagheit
1.2 Die Existenz der Ambiguität
1.3 Ambiguität auf den drei Ebenen der Bedeutung
1.3.1 Bedeutungsebenen
1.3.1.1 Die Ausdrucksbedeutung
1.3.1.2 Die Äußerungsbedeutung
1.3.1.3 Der kommunikative Sinn
1.4 Lexikalische & kompositionale Bedeutung
1.5 Kompositionalitätsprinzip & Kompositionale Ambiguität
1.6 Ambiguität: Eigenschaft des Systems oder Ergebnis des Sprachgebrauchs?
1.7 Kontextebenen und Ambiguitätsgrade
1.7.1 Kontextebenen
1.7.2 Ambiguitätsgrade
1.7.2.1 Potentielle Ambiguität
1.7.2.2 Phrasale Ambiguität
1.7.2.3 Phrastische Ambiguität
Zweites Kapitel: TYPEN SPRACHLICHER AMBIGUITÄT IM DEUTSCHEN
2.0 Einführung
2.1 Lexikalische Ambiguität
2.1.1 Homonymie
2.1.1.1 Totale Homonymie
2.1.1.2 Partielle Homonymie
2.1.1.3 Homographie und Homophonie
2.1.2 Polysemie
2.1.3 Etymologie als Kriterium für die Abgrenzung von Homonymie und Polysemie
2.1.4 Verhältnis von Homonymie und Polysemie
2.1.5 Komplexe Lexien als lexikalische Ambiguität
2.2 Syntaktische Ambiguität
2.3 Logisch-semantische Ambiguität
2.4 Pragmatische Unbestimmtheit
Drittes Kapitel: TYPEN SPRACHLICHER AMBIGUITÄT IM ARABISCHEN
3.0 Einführung
3.1 Phonologische Ambiguität
3.1.1 Die Intonation als disambiguierender Faktor in der geschriebenen Sprache..
3.2 Lexikalische Ambiguität
3.2.1 Homonymie & Polysemie
3.2.1.1 Morphologische Ambiguität
3.2.1.2 Worte mit zwei entgegengesetzten Bedeutungen (al-ÞaÃdÁd ﺩﺍﺪﺿﻷﺍ)
3.3 Syntaktische Ambiguität
3.4 Pragmatische Unbestimmtheit im Arabischen
Viertes Kapitel: FORMEN DER SYNTAKTISCHEN AMBIGUITÄT IM DEUTSCHEN
4.0 Einführung
4.1 Lexikalische, strukturelle und transformationelle Ambiguität
4.2 "Intuitive" vs. "formale" syntaktische Ambiguität
4.3 Rolle der Umformung syntaktischer Einheiten unter Synonymie bei der Bedeutungsbestimmung
4.4 Anbindungsambiguität in Präpositionalphrasen
4.4.1 Anbindungsmöglichkeiten der Präpositionalphrasen im Deutschen
4.4.1.1 Rechte Assoziation „Right Association“- Anbindung an die direkt vorausgehende Nominalphrase:
4.4.1.2 Minimale Anbindung „Frazier's Minimal Attachment“ - Anbindung ans Verb
4.4.1.3 Anbindung an ein Adjektiv
4.4.1.4 Anbindung an eine höhere Nominalphrase:
4.5 Rolle der semantischen Informationen bei der Disambiguierung syntaktischer Ambiguitäten
4.6 Grundtypen syntaktischer Ambiguität bei Agricola (1968)
4.6.1 Grundtyp I = SM I
4.6.2 Grundtyp II = SM II
4.6.3 Grundtyp III = SM III
4.7 Stufen der syntaktischen Mehrdeutigkeiten von Sätzen
4.8 Erscheinungsformen der syntaktischen Ambiguität
Fünftes Kapitel: FORMEN DER SYNTAKTISCHEN AMBIGUITÄT IM ARABISCHEN
5.0 Einführung
5.1 Referenz des Personalpronomens
5.2 Genitivverbindung
5.3 Anbindungsambiguität im Arabischen
5.3.1 Anbindungsambiguität in Präpositionalphrasen im Arabischen
5.3.2 Anbindungsambiguität des attributiven Adjektivs
5.3.3 Anbindungsambiguität des attributiven Relativsatzes
5.3.4 Anbindungsambiguität der Apposition
5.3.5 Anbindung als Apposition oder Prädikat
5.3.6 Anbindungsambiguität der Koordination
5.3.7 Anbindungsambiguität des ḤÁl-Akkusativs
5.4 Mehrdeutigkeit der Verbindungspartikel ﻭ
ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISSE
LITERATURVERZEICHNIS
Deutschsprachige Literatur
Fremdsprachige Literatur
Literatur aus dem Internet
Arabische Literatur
HINWEISE ZUR UMSCHRIFT
Bei der Schreibung der arabischen Begriffe und Ausdrücke wird die wissenschaftliche Umschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft verwandt. Sofern diese im allgemeinen Sprachgebrauch bereits eingedeutscht vorliegen (wie: Scharia), wird die entsprechende Schreibweise auch benutzt. Im Folgenden wird das Umschriftsystem der arabischen Buchstaben angeführt, das der 19. Internationale Orientalisten-Kongress 1935 vereinbart hat:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die langen Vokale werden durch Á, Ù, Ð wiedergegeben.1
ABKÜRZUNGEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
0 EINLEITUNG
0.1 Problemstellung
Die Ökonomie der Sprache beruht genau darauf, dass uns eine endliche Menge von Ausdrücken zur Verfügung steht, mit der sich eine viel größere Menge von Situationen aus dem (mentalen) Lexikon wiedergeben lässt. Ansonsten würde die Zahl der Sätze sehr groß oder sogar unendlich. So kann derselbe Ausdruck in verschiedenen Kontexten ganz verschiedene Bedeutungen besitzen. Deshalb kommen wir mit einem endlichen Vorrat von Zeichen aus. Fast alle Inhaltswörter und auch ganze Sätze können mehrere Lesarten haben. Der Begriff „Ambiguität“ ist der Fachausdruck für dieses Phänomen.
Ambiguität existiert auf vielen linguistischen Ebenen. Damit lässt sich z. B. zwischen lexikalischer und struktureller Ambiguität unterscheiden; aber dies sind wiederum Sammelbegriffe für eine Vielzahl unterschiedlicher Probleme. Lexikalische Mehrdeutigkeit kann die beiden Phänomene Homonymie und Polysemie betreffen. In der vorliegenden Arbeit soll die Frage beantwortet werden, ob ein mehrdeutiges Lexem der Homonymie oder Polysemie angehört, damit die beiden Begriffe voneinander abgegrenzt werden können.
Strukturelle Ambiguität lässt sich den Kernpunkt der vorliegenden Arbeit bezeichnen. Sie tritt auf, wenn Worte auf unterschiedliche Weisen gruppiert werden können, oder wenn es verschiedene Interpretationen gibt, in welcher Relation Worte oder größere Konstituenten stehen. Die Bedeutung eines Satzes bzw. eines komplexen Ausdrucks ergibt sich also nicht nur aus der Bedeutung der Einzelausdrücke, sondern auch aus der Art und Weise, wie sie syntaktisch zusammengesetzt sind (der Struktur des Gesamtausdrucks).
Betrachten wir das Beispiel
- Ich habe junge M ä dchen und Frauen gesehen,
finden wir, dass der Ausdruck junge M ä dchen und Frauen zwei mögliche Interpretationen (I1 bzw. I2) besitzt:
I1: "Ich habe junge Mädchen und junge Frauen gesehen." I2: "Ich habe Frauen und junge Mädchen gesehen."
Es ist hier nicht entschieden, ob sich das Adjektiv junge nur auf M ä dchen oder auf die beiden Substantive M ä dchen und Frauen bezieht. Bei der ersten Interpretation wird Frauen durch junge modifiziert und bei der anderen nicht.
In einer bestimmten Reihenfolge kann auch die arabische Übersetzung des obigen Beispiels mehrdeutig sein:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ra Þ aytu nis ÁÞ an wa ban Á tin Ò a È ir Á t
Die Ambiguität beruht sowohl im arabischen als auch im deutschen Beispiel darauf, dass das attributive Adjektiv nur auf eines der jeweiligen vorausgehenden bzw. nachgestellten Substantive oder auf beide zusammen Bezug nehmen kann:
I1: "Ich habe Frauen und junge Mädchen gesehen."
I2: "Ich habe junge Frauen und junge Mädchen gesehen."2
Ein sehr berühmtes Beispiel für syntaktische Ambiguität ist auch der Satz:
- Peter sah den Polizisten mit dem Fernglas.
Dieser Satz erlaubt mehrere unterschiedliche Interpretationen, die sich in der Zuordnung der Präpositionalphrase „ mit dem Fernglas “ unterscheiden. Hier ist es möglich, dass das „ Fernglas “ als Instrument zum Verb sehen verstanden wird und die entsprechende Präpositionalphrase „ mit dem Fernglas “ somit an die Verbalphrase angebunden wird, oder dass die Präpositionalphrase „ mit dem Fernglas “ als Attribut zum Akkusativobjekt „ den Polizisten “ angesehen wird und somit der Nominalphrase zugeschrieben wird. Die Ambiguität liegt hier vor, weil es für den Satz mehr als eine Strukturierungsmöglichkeit gibt, und gleichzeitig hier die semantischen Faktoren fehlen, die die eine Interpretation vor der anderen bevorzugen.
Mit anderen Worten kann die Präpositionalphrase mit dem Fernglas aufgrund ihrer semantischen Eigenschaften entweder an die VP sah oder an die unmittelbar vorangehende NP den Polizisten gebunden werden. Im ersten Fall hätte Peter selbst das Fernglas, im zweiten Fall dagegen hätte der Polizist das Fernglas. So kann die PP-Zuordnung aufgrund ihrer semantischen Faktoren, die den beiden Konstituenten gleichzeitig entsprechen, durch zwei verschiedene syntaktische Strukturen repräsentiert werden:
Das Gleiche geschieht auch bei den arabischen Beispielen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
wa Ê adtu kit Á ba a Ô - ÔÁ libi al- Þ a Ý m Á
Ich habe das Buch des blinden Studenten gefunden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
zurtu Þ ab Á a Ô - ÔÁ libi al- Þ a Ý m Á
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Obwohl das Hilfszeichen auf dem Auslaut des Adjektivs ﻰﻤﻋﻷﺍ im ersten Beispiel fehlt, kann man es leicht durch den verbalen Kontext ordnen. Der Satz lässt sich daher verstehen, wenn der Rückgriff auf semantische Informationen berücksichtigt wird, dass das Buch, das normalerweise nicht als "blind" bezeichnet werden kann, (vom Sprecher) gefunden worden ist, und dass es einem blinden Studenten gehört. Die Mehrdeutigkeit der Attribut-Zuordnung ist hingegen in beiden übrigen Sätzen weder durch den verbalen noch den nicht-verbalen Kontext zulösen. Man kann nicht bestimmen, ob ﻰﻤﻋﻷﺍ bzw. ﻰﻠﻋﻷﺍ im Akkusativ (als Attribut zum
Akkusativobjekt) oder im Genitiv (als Attribut zum 2. Glied der
Genitivverbindung) steht. Beide Attribute können wegen des in allen Kasus ständigen - Á gleichermaßen den beiden vorausgehenden Substantiven (ﺏﺃ und ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ im ersten Satz und ﻢﺳﺍ und ﺏﺭ im koranischen Vers) zugeschrieben werden, obwohl beide vorher genannten Substantive nicht im selben Kasus stehen:
أ ﺎﺑا ﺐﻟﺎﱠﻄﻟا:ﻰﻤﻋﻷ
I1: "Ich besuchte den blinden Vater des Studenten."
I2: "Ich besuchte den Vater des blinden Studenten."
زرت
اْﻷَ:ﻰﻠﻋ رﻚﱢﺑ ﺢﺒﺳاﺳْﻢ
I1: "Preise den Namen deines höchsten Herrn."
I2: "Preise den höchsten Namen deines Herrn."3
0.2 Forschungsgegenstand
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Problem der angewandten Linguistik. Sie behandelt die Frage der mehrfachen Analysierbarkeit beliebiger syntaktischer Strukturen im Deutschen und im Arabischen. Die Interpretation komplexer Ausdrücke in den beiden Sprachsystemen orientiert sich an deren syntaktischer Struktur. Parallel zu den syntaktischen Regeln gibt es entsprechende semantische Regeln zur Berechnung der Bedeutung eines komplexen Ausdrucks aus den Bedeutungen seiner Bestandteile. Dieser Prozess bedürft also drei Quellen:
1- die lexikalische Bedeutung der Grundausdrücke,
2- die grammatische Bedeutung ihrer Form,
3- die syntaktische Struktur des komplexen Ausdrucks.
Im Verlauf der Arbeit sollen die Formen der syntaktischen Ambiguität im Deutschen und im Arabischen anhand ausgewählter Beispiele dargestellt werden. Dabei werden die drei Grundtypen der syntaktischen Ambiguität im Deutschen weiter in Untertypen aufgespaltet, d. h., diese drei Grundtypen können in verschiedenen Formen vorkommen, denen die Wortklassenfolge zugrunde gelegt wird. In Bezug auf die syntaktische Ambiguität im Arabischen wird dagegen die Typisierung syntaktischer Ambiguität anders vorgestellt. Die arabischen Sprachwissenschaftler haben die Formen der syntaktischen Ambiguität im Arabischen in Anlehnung an die Quellen der syntaktischen Ambiguität dargestellt.
0.3 Ziel der Arbeit
Diese Studie befasst sich, wie der Titel lautet, mit den Formen der syntaktischen Ambiguität im Deutschen und im Arabischen. Deshalb zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden
Sprachsystemen hinsichtlich dieses Phänomens (der syntaktischen Ambiguität) darzulegen und zu erklären. Hieraus lassen sich die Ziele der vorliegenden Arbeit im Folgenden zusammenfassen:
1- verschiedene Definitionen der Linguisten für „Ambiguität“, den wichtigsten Terminus der vorliegenden Arbeit, darzustellen.
2- eine terminologische Differenzierung und Abgrenzung der „Ambiguität“ von den benachbarten Begriffen zu finden.
3- eine angemessene Typisierung sprachlicher Ambiguitäten im Deutschen sowie im Arabischen zu gewinnen.
4- Die Haupttypen syntaktischer Ambiguität (sowie ihre häufigen Kombinationen von Wortklassenfolgen) im Deutschen zu analysieren.
5- die Quellen, nach denen die Formen der syntaktischen Ambiguität im Arabischen in Erscheinung treten, anzuführen.
6- Auf Möglichkeiten und Mittel zur Aufhebung "Disambiguierung" oder "Übersetzung" solcher syntaktischen Mehrdeutigkeiten im Deutschen und im Arabischen hinzuweisen.
0.4 Forschungsstand
Die Existenz von Ambiguität in natürlicher Sprache ist seit Aristoteles bekannt, der den Begriff „Ambiguität“ zum ersten Mal in die philosophischen und sprachwissenschaftlichen Auseinandersetzungen eingeführt hatte. Auch in der modernen Sprachwissenschaft gibt es zahlreiche Publikationen, bei denen sprachliche Ambiguität den zentralen Untersuchungsgegenstand bildet. Während sich Agricolas Monografie mit den syntaktisch mehrdeutigen Beispielen bei der Analyse des Deutschen und des Englischen befasst, wird syntaktische Ambiguität von Ernst auf der Basis des Französischen und Spanischen typisiert.
Manche Autoren schränken ihren Ambiguitätsbegriff auf eine bestimmte Untermenge sprachlicher Entitäten ein. Beispielsweise untersucht Kooij das Phänomen „Ambiguität“ in Bezug auf den Satz. Taha spricht nur im Zusammenhang mit Wörtern und Wortsequenzen innerhalb eines Satzes von Ambiguität.4 In der vorliegenden Arbeit wird keine Veranlassung gesehen, solche Einschränkungen einzuführen. Deshalb kann sich hier die Ambiguität auf sprachliche Ausdrücke beliebigen Grades beziehen.
0.5 Methode und Gliederung der Arbeit
Die wissenschaftliche Methode, die in dieser Arbeit angewandt wird, ist die deskriptiv-analytische Methode, wobei die Erscheinung und Typisierung sprachlicher Ambiguität in den drei ersten Kapiteln unter deskriptivem Aspekt dargestellt werden. Im vierten und fünften Kapitel werden die Erscheinungsformen struktureller Ambiguität im Deutschen und im Arabischen analysiert. Erwähnenswert ist auch, dass die Übersetzung der Koranverse, die in der vorliegenden Arbeit als Beispiele angeführt werden, der Koranübersetzung Frank Bubenheims entnommen ist, die vom König Fahd Komplex in Saudi Arabien veröffentlicht wurde.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, fünf Kapitel, eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis:
Die Einleitung befasst sich mit der Auswahl des Themas, indem Forschungsgegenstand, -ziel, -stand, -methode und Gliederung der Arbeit dargestellt werden.
Das erste Kapitel stellt verschiedene Definitionen und Auffassungen der Sprachwissenschaftler für den zentralen Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit „Ambiguität“ dar. Insbesondere wird die Frage zu untersuchen sein, ob Ambiguität als Eigenschaft des Sprachsystems oder als Ergebnis des Sprachgebrauchs angesehen werden soll. Dabei werden auch die Ebenen sprachlicher Ausdrücke, auf denen die Ambiguität erfolgt, untersucht.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Typisierung sprachlicher Ambiguität im Deutschen. Es wird hier so weit wie möglich versucht, einen umfassenden Rahmen darzustellen, in den die Linguisten alle sprachlichen Ambiguitäten im Deutschen eingeordnet haben. Ein derartiger Rahmen soll hier durch die Zuordnung sprachlicher Ambiguitäten zu den traditionellen Beschreibungsebenen Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik konstruiert werden.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Arten der sprachlichen Ambiguität im Arabischen, die vielleicht die gleichen Bezeichnungen, wie im Deutschen, haben, aber aufgrund der Unterschiede zwischen den beiden Sprachsystemen ganz andere Eigenschaften und Kriterien besitzen.
Das vierte Kapitel stellt mit dem fünften Kapitel den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit dar. In diesem Kapitel werden zuerst zwei prinzipielle Möglichkeiten der Definition des Begriffs „syntaktische Ambiguität“ einander gegenübergestellt, die „intuitive“ und die „formale“ Definition, dann folgt eine Darstellung der Grundtypen syntaktischer Ambiguität im Deutschen, wobei die syntaktischen Strukturen durch hierarchisch organisierte Relationen zwischen Einzelelementen dargestellt werden. Anschließend werden die häufigen Kombinationen von Wortklassenfolgen, die syntaktische Mehrdeutigkeiten erlauben, dargestellt und analysiert.
Im fünften Kapitel werden die Formen der syntaktischen Ambiguität im Arabischen in Anlehnung an die Quellen struktureller (syntaktischer) Ambiguität angegangen. Dabei gelten u. a. Anbindung (besonders Präpositionalphrasen-Anbindung und Anbindung des attributiven Adjektivs), Referenz des Personalpronomens, Genitivverbindung, und Koordination als Paradebeispiele für strukturelle Mehrdeutigkeiten.
Zusammenfassung und Ergebnisse der Arbeit
Das Literaturverzeichnis
ALAA ABDELAZIZ
Kairo, Ṣafar 1434 n. H./Januar 2013 n. Chr.
Erstes Kapitel: AMBIGUITÄT IN NATÜRLICHER SPRACHE
1.1 Terminologie und Abgrenzung
1.1.1 Der Begriff Ambiguität
Zu Beginn jeder wissenschaftlichen Arbeit bietet sich normalerweise die Klärung der zentralen Fachbegriffe an. Bei der Definition des wichtigsten Terminus der vorliegenden Arbeit, „Ambiguität“, treten viele Probleme aufgrund der Unterschiedlichkeit der Begriffsverwendung von den Autoren auf. Es muss also geklärt werden, dass „Ambiguität“ von unterschiedlichen Autoren in unterschiedlicher Weise verwendet wird. Das scheint auch bei anderen sprachwissenschaftlichen Fachbegriffen ebenfalls der Fall zu sein. Noch dazu begegnet man dem Problem, dass bei der Definition eines Begriffs andere Bezeichnungen verwendet werden, die auch einer Präzisierung bedürfen.5
Ernst hat eine Definition von „Ambiguität“ gefunden, die seines Erachtens hinreichend genau sei, um als Basis seiner Analyse dienen zu können:
„Eine kommunikative Form heißt „ambig“, wenn sie mehr als eine Bedeutung hat.“6
Genau wie Ernst hatte vorher auch Hadumod Bußmann die beiden Bezeichnungen „Ambiguität“ und „Mehrdeutigkeit“ als Synonyme betrachtet:
„Ambiguität [lat. ambiguitās „Doppelsinn“- Auch: Amphibole (veraltet), Mehrdeutigkeit]. Eigenschaft von Ausdrücken natürlicher Sprachen, denen mehrere Bedeutungen zukommen.“7
Fries hingegen weicht von den Betrachtungen der beiden obigen Linguisten ein wenig ab, indem er die „Ambiguität“ als einen Unterbegriff betrachtet, der dem Oberbegriff „Mehrdeutigkeit“ untergeordnet sei:
„Unter „Mehrdeutigkeit“ sei im folgenden die Möglichkeit verstanden, ein Morphem, ein Wort, ein Sequenz, einen Satz usw. in mehrfacher Weise zu interpretieren, zu verstehen u.z. unabhängig davon, ob diese mehrfache Interpretationsweise auf eine bestimmte grammatische Beschreibung bezogen ist oder ob sie beispielsweise auf die betreffenden Lautketten nur in Isolation oder auch in sprachlichen bzw. situativen Kontexten zutrifft. „Mehrdeutigkeit“ ist demnach der Begriff, den es zu unterteilen gilt. Als ein solcher Oberbegriff gestattet er uns, Phänomene der „Mehrdeutigkeit“ entsprechend unterschiedlichen Auffassungen über die Aufgaben- und Objektbereiche der Grammatik und ihrer Komponenten zu differenzieren.
Unter „Ambiguität“ verstehe ich demgegenüber eine Mehrdeutigkeit, welche im Rahmen eines vorausgesetzten Grammatikmodells mittels unterschiedlicher Beschreibungen lexikalischer, syntaktischer, phonologischer, morphologischer usw. Art repräsentiert wird.“8
Es sieht aber so aus, als würden die meisten Linguisten in der modernen Sprachwissenschaft in einer Vielzahl linguistischer Untersuchungen die beiden Begriffe „Ambiguität“ und „Mehrdeutigkeit“ als Synonyme auffassen.
„Ein Ausdruck oder eine Äußerung ist ambig9, wenn er auf mehrere Weisen interpretiert werden kann.“10
Während Löbner den Begriff „Ambiguität“ als Fachbegriff dieses Phänomens betrachtet, spricht Ulmann dennoch einfach von „Mehrdeutigkeit“:
„Mehrdeutige Situationen können sich in der Sprache auf vielfältige Weise ergeben. Für die Dichtung hat W. Empson sieben verschiedene Typen herausgearbeitet. Rein sprachlich betrachtet gibt es drei Hauptformen der Mehrdeutigkeit: phonetische, grammatische und lexikalische.“11
Wie wir bereits gesehen haben, hatte Ulmann das englische „Ambiguity“ von Empson, der sieben Typen unterscheidet,12 mit dem Begriff „Mehrdeutigkeit“ übersetzt.
1.1.2 Ambiguität und Vagheit
Es kann mit den Ausdrücken Mehrdeutigkeit, Ambiguit ä t, Polysemie und auch Homonymie auch auf sprachliche Vagheit bzw. Unbestimmtheit referiert werden. Diese selbst mehrdeutigen und vagen Termini können in vielen unterschiedlichen Auffassungen verwendet werden. Es geht bei ihnen um mehrdeutige lexikalische Einheiten, Wortbildungen, Phrasen, Sätze und auch ganze Texte.13 Ich möchte es hier auch nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesen genannten Termini bzw. Erscheinungen jedoch nicht genau um dieselben handelt, obwohl sie einander nicht gegenseitig ausschließen und sich teilweise überlagern. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht werden diese Termini häufig nach grundverschiedenen Kriterien voneinander abgegrenzt. Die terminologische Differenzierung und die Abgrenzung der Ambiguit ä t von dem benachbarten Ausdruck Vagheit sind daher dringend, um die beiden Erscheinungen so gut wie möglich zu klären und die möglichen Verwirrungen zu vermeiden.14
Wie oben gesagt, ist hier zu betonen, dass Vagheit und Ambiguit ä t nicht in Opposition zueinander stehen. Sie bezeichnen jedoch zweifellos verschiedene Dinge.15
„'Vagheit' bezeichnet im Gegensatz [zur vorher definierten Ambiguität] hierzu eine Mehrdeutigkeit, welche zwar unter Umständen vorausgesagt wird, jedoch nicht mit Hilfe unterschiedlicher Beschreibungen im Grammatikmodell repräsentiert wird.“16
Fries meint, dass die Vagheit eine Art der Mehrdeutigkeit ist, die aber nicht mittels u. a. lexikalischer, morphologischer, phonologischer, syntaktischer Beschreibungen repräsentiert wird. Fries kommt mit dieser Definition der Auffassung von Pinkal (1985) bei der Abgrenzung von Vagheit und Ambiguit ä t sehr nahe. Trotzdem hatte Fries nicht in Betracht gezogen, eine Klassifikation möglicher Fälle von Mehrdeutigkeit, Ambiguität oder Vagheit zu liefern:17
„Ebenso wie sich die Begriffe 'Syntax', 'Semantik' usw. in verschiedenen Grammatikmodellen auf unterschiedliche Phänomene beziehen können, sind die Begriffe 'Ambiguität', 'Vagheit' usw. in vorausgesetzten Theorien verankert. Hieraus folgt, dass es keine absoluten Kriterien zu einer Unterscheidung geben kann.“18
Für eine befriedigende Abgrenzung von den beiden Begriffen Vagheit und 19 Mehrdeutigkeit hat Pinkal die Farbadjektive als typische Beispiele für semantische Vagheit und die ambigen Substantive wie z. B. Bank 20 (Sitzbank/Geldinstitut) als Beispiele für Ambiguität angeführt, indem er die Indefinit- und Definitbereiche als Basis für die Vergleichung zwischen den vagen und mehrdeutigen Ausdrücken
eingesetzt hat. Die Farbadjektive wie gr ü n und rot oder auch die randbereichsunscharfen Adjektive wie teuer und gro ß lassen gradweise Abstufungen zu. Eine Sache kann groß für einen Betrachter und nicht groß für einen anderen sein.
- Ich habe ein gro ß es Haus gekauft.
Diesen Satz betrachte ich nicht als ambigen, sondern vager Satz. Der Satz kann zwar gut vom Kommunikationspartner verstanden werden, aber der Grad der Hausgröße ist unbestimmt. Deshalb nimmt das unbestimmte Adjektiv gro ß eine unbestimmte Präzisierung an. Aber im Fall der ambigen Ausdrücke wie Bank
Dem Oberbegriff Unbestimmtheit hat Pinkal (1985) Vagheit und Mehrdeutigkeit (, die sich seines Erachtens in Ambiguit ä t und Verwendungsvielfalt gliedert) zugeordnet. Als Berührungspunkt zwischen Mehrdeutigkeit und Vagheit betrachtet Pinkal die Verwendungsvielfalt, indem er die Ambiguit ä t wie folgend für einen Unterteil der Mehrdeutigkeit hält: ergeben sich nur zwei Lesarten. Jede von diesen Lesarten ist ganz bestimmt und schließt die andere aus. 21 Hieraus folgt, dass die vagen Ausdrücke unendlich viele mögliche Präzisierungen erlauben, während die ambigen Ausdrücke endlich viele Lesarten annehmen.22 Es ist ferner in Betracht zu ziehen, dass vage Ausdrücke nur ein unbestimmtes Denotat (nur eine unbestimmte Proposition) (vgl.: gro ß) haben. Ambige Ausdrücke besitzen dagegen mehrere alternative Denotate/Propositionen (vgl.: Bank). Diese Beziehung zwischen den beiden Phänomenen hat Pinkal (1991) in Anlehnung an Kit Fine charakterisiert:
„ […] Ambiguity is like the super-imposition of several Pictures, vagueness like an unfinished Picture, with marginal notes for completion. “23
Hier ist auch zu erwähnen, dass die Vagheit z. B. nicht allen Adjektiven eigen ist. Hier können die Gradajektive wie teuer, schnell, gro ß usw. als Beispiele für eine typische semantische Vagheit angeführt werden. Bei diesen Gradadjektiven ist jeder Anwendungsfall durch alternative Präzisierung relativierbar.24 Wenn ich z. B. ein Auto für 100,000 € für teuer halte, dann ist für mich auch ein Auto für 120,000 € teuer. Die beiden Autos betrachte ich in beiden Fällen als teuer, obwohl die beiden nicht dieselbe Summe kosten. Der Grund dafür liegt darin, dass sich hier Interpretationsspielräume ergeben, die man auf verschiedene Weise ausnützen kann. Diese Art von Adjektiven kann von den referentiellen Adjektiven offensichtlich abgegrenzt werden; wenn ich z. B. ledig bin, dann kann niemand lediger als ich sein, eine verheiratete Frau ist eine Frau, die verheiratet ist. Es gibt also keine andere Interpretationsmöglichkeit für solche nicht-graduierbaren Adjektive. Auch alle andere Adjektive wie rechteckig, kinderlos, viert ü rig, dreizeilig, tot, lebend u. a. haben stabile Bereiche definiter Anwendbarkeit.25
Hiermit scheint der Begriff „Ambiguität“ selbst in seiner Bedeutung äußerst unbestimmt. Er unterscheidet sich nicht von Begriffen wie z. B. 'Wort', 'Satz', 'Thema' usw.; diese Termini können auch als wissenschaftliche Begriffe sinnvoll nur unter Bezug auf eine bestimmte vorausgesetzte Grammatiktheorie verwendet werden.26
Ich möchte hier darauf aufmerksam machen, dass die Begriffe Ambiguität und Mehrdeutigkeit in dieser Arbeit als Synonyme betrachtet werden. Von den beiden Begriffen spricht man also, wenn ein Zeichen mehrere Bedeutungen hat. Auch auf der Ebene der literarischen Ambiguität ist ein Vexierbild zum Beispiel mehrdeutig (ambig), wenn es als mindestens zwei verschiedene Bilder gedeutet werden kann.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass Ambiguität ein Charakteristikum von Zeichen ist, vor allem von sprachlichen Zeichen. Sie entsteht, wenn ein sprachliches Zeichen auf verschiedene Weise interpretiert werden kann. Sprachliche Zeichen unterschiedlicher Komplexität (Ausdruck, Satz, Äußerung) können mehrdeutig sein. Die Ambiguität dient hiermit zur Bezeichnung mehrdeutiger lexikalischer Einheiten, Wortbildungen, Phrasen, Sätze als auch ganzer Texte.
1.2 Die Existenz der Ambiguität
Auf die Frage, ob „Ambiguität“ überhaupt existiert und wenn ja, in welchem Umfang, hat Ernst mit drei kontroversen Standpunkten aus der Antike geantwortet:
Diodoros Chronos (um 400 v. Chr.) behauptete, kein Ausdruck sei ambig, weil der Sprecher ja immer wisse, was er mit einem sprachlichen Ausdruck sagen wolle.
Der Hörer könne diesen Gedanken (was der Sprecher meint) dann erfassen oder eben nicht. Jeder Ausdruck ist daher nach der Meinung von Chronos eindeutig.
Zur selben Auffassung kommen auch Claudius Galenus (2. Jh. n. Chr.) und Simplikios (5./6. Jh. n. Chr.). Die Auffassung, dass falsch verstandene, mehrdeutige Äußerungen mit gar nicht verstandenen Äußerungen zusammengefasst werden, scheint aus heutiger Sicht jedoch nicht überzeugend.27 Als eine der bekanntesten Arten von Ý ilm al-bad ÐÝ (Teilgebiet der arabischen Rhetorik) betrachten die Sprachwissenschaftler „ at-tawriya “ (Zweideutigkeit/beabsichtigte Mehrdeutigkeit), deren Idee darin besteht, dass der Sprecher mit seiner mehrdeutigen Äußerung nicht die meist wahrscheinliche und vom Rezipienten erreichte Bedeutung meint, d. h., der Expedient erfüllt absichtlich die Funktion der sprachlichen Form nicht völlig und nicht eindeutig.28
Die ganz entgegengesetzte Meinung, nämlich dass jedes Wort ambig sei, wurde von Chrysippos (3. Jh. v. Chr.) dargestellt. Auch von Agricola würde wahrscheinlich dieser Variante beigepflichtet. Agricola stellt beispielsweise fest:
„Bei einem bestimmten Prozentsatz von Äußerungen läßt sich feststellen, dass die Form neben dem gewollten und erreichten Kommunikationseffekt einen weiteren, unter Umständen sogar mehrere zusätzliche Effekte auslöst, die in diesem verbalen oder/und situativen Kontext von Expedienten nicht beabsichtigt sind. Die Äußerung ist also für den Perzipienten und für die Analyse mehrdeutig. [...] Werden Zeichen isoliert betrachtet oder unter Gegebenheiten untersucht, wo die Art der Analyse eine isolierte Behandlung der Ebenen notwendig macht, ist die Mehrfachfunktion mit der Wirkung der Mehrdeutigkeit bei allen Bedeutungstypen so häufig, dass sie nahezu als eine reguläre Eigenschaft des Zeichens angesehen werden darf.“29
Die oben erwähnte Auffassung wurde auch von Wolfgang Klein und Susanne Winkler vertreten:
„Dass ein Wort mehrdeutig ist, ist kein Unfall der deutschen Sprache. Fast alle Ausdrücke einer Sprache, einfach oder zusammengesetzt, sind mehrdeutig.“30
Als Beispiel dafür haben Winkler und Klein die Schlusszeile des Gedichts "Auf eine Lampe" von Eduard M ö rike angeführt:
- „ Was aber sch ö n ist, selig scheint es in ihm selbst “
Um die rechte Deutung dieses Verses entspann sich vor sechzig Jahren eine berühmte Diskussion zwischen dem Literaturwissenschaftler Emil Staiger und dem Philosophen Martin Heidegger. Der Streitpunkt ist das mehrdeutige Wort „scheint“, das nach der Auffassung von Steiger im Sinne von „ videtur “ = [einen bestimmten Eindruck erwecken]31 aufzufassen sei, während Heidegger meint, man solle es im Sinne von „ lucet “ = [(von Lichtquellen) anhaltend Licht ausstrahlen u. irgendwohin gelangen lassen]32 verstehen.33
Was Winkler und Klein noch weiter erörtern, ist der Umstand, dass alle Wörter dieser Zeile mehrdeutig seien. Selig sind z. B. die 1268 Personen, die Papst Johannes Paul II. selig gesprochen hat; und das ist wohl hier nicht gemeint, ebenso wenig wie selig im Sinne von „ in gehobener Stimmung “ oder wie in meine Schwiegermutter selig. Das Wort muss in Mörikes Gedicht eine andere, wenn auch verwandte Bedeutung haben. Das Wort es wird in verschieden grammatischen Funktionen verwendet, wie in es schneite oder aber zur Referenz auf eine Person, einen Gegenstand, einen Begriff, über die der Kontext Näheres sagt: das Kind...es, das Messer ...es, das Lied...es. Man denkt, dass das Wort in ein räumliches Enthaltensein ausdrückt; aber dieses ist bei er hatte ein Bonbon im Mund anders als bei er hatte eine Zigarette im Mund oder Lass mich in Ruhe. Auch was in ihm selbst bedeutet, ist nicht eben deutlich. Das Wort ihm kann sich auf alles beziehen, das sich mit einem Neutrum oder einem Maskulinum beschreiben lässt. Und was bedeutet selbst ? Man kann sagen: Selbst Goethe hat das gesagt, aber auch Goethe selbst hat das gesagt. Diese Mehrdeutigkeit für selbst wird meistens - aber nicht immer - durch die Stellung aufgelöst, und hier ist offenbar die zweite Lesart gemeint.34
Eine Art der Zwischenposition haben die Stoiker vertreten. Sie meinen, dass es sowohl eindeutige als auch mehrdeutige Ausdrücke gibt.35
Die unterschiedlichen Ergebnisse sind eine Folge der unterschiedlichen Annahmen bezüglich des Forschungsgegenstandes. Während Diodoros Chronos die konkrete Äußerung inklusive des Sprechers und Hörers betrachtet, basiert Chrysippos Auffassung auf „ expressions simples “, d. h. Wortformen. Die Stoiker sprechen aber allgemein von Ausdrücken. So beruhen die Differenzen über die Existenz der sprachlichen Ambiguität in der Antike darauf, welche Entitäten zu betrachten sind. Die drei Standpunkte werden von Ernst in der folgenden Tabelle einander gegenübergestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 36
1.3 Ambiguität auf den drei Ebenen der Bedeutung
Die Semantik ist ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft, das sich mit der Bedeutung beschäftigt. Diese Art von Definition mag vielleicht jemandem genügen, der sich nicht für die Sprachwissenschaft interessiert, aber in solchen wissenschaftlichen Arbeiten muss es natürlich präziser erklärt werden, was der Gegenstand dieser Wissenschaft ist. Der Begriff „Bedeutung“ hat verschiedenartige Anwendungen; einige davon fallen in den Bereich der Semantik, andere fallen heraus.37 In erster Linie ist „Bedeutung“ die Bedeutung von etwas. Natürlich haben Wörter Bedeutungen, ebenso zusammengesetzte Ausdrücke, die in der Linguistik „Phrasen“ genannt werden, und auch ganze Sätze. Man kann aber auch Handlungen eine Bedeutung zuordnen. Wenn sich jemand zum Beispiel in bestimmter Weise verhält, kann man sich fragen, welche Bedeutung das hat.
Die Semantik beschäftigt sich nur mit der Bedeutung von sprachlichen Einheiten wie Wörtern, Phrasen und Sätzen. Sie beschäftigt sich aber nicht mit der Bedeutung von Handlungen.
1.3.1 Bedeutungsebenen
„Der Sprachphilosoph H.P. Grice (1913-1988) hat in einer Reihe von Beiträgen seit 1957 das Verhältnis von wörtlicher Bedeutung und den kommunikativen Intentionen des Sprechers erhellt. Er nennt erstere linguistic meaning, letztere speaker’s meaning.“38
In diesem Zusammenhang unterscheidet man zwischen der wörtlichen Bedeutung (der Bedeutung von Ausdrücken) und der Bedeutung, die der Sprecher mit seiner Äußerung meint, was der Sprecher eigentlich mit dem Ausdruck bezweckt hat (dem kommunikativen Sinn). Um den kommunikativen Sinn eines Ausdrucks zu begreifen, sollen wir auch die Situation, in der der Ausdruck geäußert wurde, erfassen. Man kann dieses Verhältnis als Dreiecksbeziehung zwischen Ausdruck, Bedeutung und Situation darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.3.1.1 Die Ausdrucksbedeutung
- Ich kenne das Buch.
Diesen normalen deutschen Satz kann man ohne große Schwierigkeiten verstehen. Diese Bedeutung bekommt der Satz durch die einzelnen Ausdrücke, aus denen der Satz besteht - Ich, kenne und das Buch - und die Art und Weise, wie sie zusammengesetzt sind.
Hier findet man ein finites Verb kenne, das für die Bedeutung eine Schlüsselposition im Satz hat. Es bedeutet, dass der Sprecher zum Sprechzeitpunkt über dieses Wissen verfügt. Es hat ein direktes Akkusativobjekt das Buch, das vom Hörer bestimmbar ist und über das bereits gesprochen wurde. Die beiden Wörter kenne und Buch bilden die Hauptinformationen in dem Satz; sie sind sogenannte Inhaltswörter. Die anderen Elemente des Satzes sind alle nicht von dieser Art. Solche Wörter nennt man Funktionswörter; dazu gehören Artikel,
Pronomina, Präpositionen, Konjunktionen und andere kleine Wörter39. Der Ausdruck ich bezieht sich auf eine bestimmte Person, hier den Sprecher der Äußerung. Der Fachausdruck dafür ist die Referenz. Die Funktion des Pronomens ich besteht also in der Referenz auf den Sprecher des Satzes. Auch die Tempusform des Verbs spielt bei der Bedeutungsbestimmung des Satzes eine entscheidende Rolle.
„Tempus [lat., ›Zeit‹; engl. tense ]. Grundlegende (morphologisch-) gramm. Kategorie des Verbs, die ... das jeweils angesprochene Geschehen zu der zeitlichen Perspektive des Sprechenden in Beziehung setzt.“40
Damit kann man verstehen, dass das Tempus eine Form des Verbs ist, die anzeigt, auf welche Zeit sich die Situation bezieht. In unserem Satz bezieht sich die beschriebene Situation auf die Gegenwart, das heißt auf die Zeit, zu der der Satz ausgesprochen wird.
Es fällt aber schwer, indexikalische Ausdrücke einer Bedeutungszuweisung zuzuordnen. Indexikalische Ausdrücke wie ich, du, hier, da, dort, gestern, morgen usw. haben zwar eine kontextunabhängige wörtliche Bedeutung41 (mit ich referiert der Sprecher zum Beispiel auf sich selbst). Mit der wörtlichen Bedeutung wissen wir allerdings noch nicht, welche Person spricht und welcher Ort mit hier oder dort ist. Erst nachdem die Referenz dieser Ausdrücke im Äußerungskontext festgelegt ist, können wir den propositionalen Gehalt des Satzes verstehen.
1.3.1.2 Die Äußerungsbedeutung
Wenn aber ein solcher Satz mit seiner Ausdrucksbedeutung in einem bestimmten Kontext geäußert und interpretiert wird, erhält der Satz eine konkrete Bedeutung, die er für sich genommen nicht hat. Die Referenzen werden dadurch auch festgelegt. D. h., wir müssen für viele sprachliche Ausdrücke bestimmen, auf wen oder was sie referieren. Als Beispiel dafür können wir uns diese folgende Situation vorstellen:
Hans unterhält sich mit seiner Kommilitonin Monika über einen Vortrag, den ein bekannter Professor letzte Woche gehalten hat. Hans und Monika sind sich einig, dass ihnen der Vortrag sehr gut gefallen hat und dass es schön wäre, wenn bald eine Fortsetzung stattfindet. Hans fällt plötzlich ein, dass dieser Professor all seine Vorträge in einem Buch zusammengeschrieben hat. Monika hört gespannt zu und sagt darauf: „ Ich kenne das Buch. “
Das Personalpronomen referiert hier auf Monika, die über ein bestimmtes Buch spricht, in dem alle Vorträge eines bekannten Professors zusammengefasst sind. Anhand dieses gegebenen Kontextes erhält der Satz „ Ich kenne das Buch “ eine völlig neue Bedeutung, weil wir wahrnehmen können, worauf sich seine einzelnen Teile beziehen. Wir benötigen also Informationen über die Umstände, unter denen ein Ausdruck geäußert wurde, um die Äußerungsbedeutung eines Ausdrucks ermitteln zu können. Zu diesen Aspekten der Situation, in der ein Ausdruck geäußert wurde, gehört:
Sprecher/in der Äußerung, Adressat/in der Äußerung, Zeitpunkt der Äußerung, Ort an dem die Äußerung stattfindet und die gegebenen relevanten situativen Fakten zum Zeitpunkt der Äußerung.
Hätte Hans im vorigen Beispiel seinen Satz in einer anderen Situation geäußert, dann hätte der Satz eine neue Bedeutung gehabt. So hat Sebastian Löbner den Begriff Äußerungsbedeutung definiert:
„Sie ist die Bedeutung eines Ausdrucks, die sich aus seiner Verwendung und Interpretation in einem gegebenen ÄK42 ergibt.“43
Jeder Satz hat also eine wörtliche Bedeutung, die auch Satzbedeutung genannt wird und sich aus den Bedeutungen der einzelnen Wörter und der Konstruktion des Satzes ergibt. Die Satzbedeutung ist unabhängig vom Äußerungskontext. Um die Bedeutung eines komplexen sprachlichen Ausdrucks genau zu begreifen, benötigen wir allerdings Disambiguierungs- und Anreicherungsprozesse.44 Das zeigt sich in den folgenden Beispielen. Die möglichen Bedeutungen stehen in den Klammern hinter den jeweiligen Beispielen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein Farbadjektiv kann also je nach Bezugswort und Kontext unterschiedlich interpretiert und verstanden werden. Beispielsweise ist der Ausdruck „ ein roter Stift “ ambig und muss im Kontext disambiguiert werden, weil es dabei mehrere Teile geben kann, die rot sein können. Entweder ist die Oberfläche rot oder der Stift schreibt rot. Um eine der beiden Bedeutungen dieses komplexen Ausdrucks zu bestimmen, müssen wir zuerst entscheiden, welcher Teil des Stiftes rot sein kann. Die zweite Bedeutung kann zum Beispiel in der Situation beabsichtigt werden, in der man rot schreiben möchte. Wissen wir z. B., dass die Lehrerin die Klassenarbeiten korrigieren möchte, dann liegt es nahe, dass sie einen Stift haben möchte, der rot schreibt. Diese Art von semantischer Anreicherung ist auch bei der Interpretation bei N+N-Komposita nötig:
Petra hat neue Hausschuhe/Fu ß ballschuhe/Lederschuhe/Damenschuhe.
Das Erstglied von Fu ß ballschuhe bezeichnet, wozu diese Schuhe gemacht werden, nicht aber das Material, aus dem die Schuhe gemacht sind, wie es der Fall von Lederschuhe ist. Und im Gegensatz zum Erstglied von Damenschuhe bezeichnet das Erstglied von Hausschuhe, wo diese Schuhe angezogen werden können und nicht, für wen diese Schuhe gemacht worden sind. Dies ergibt sich nicht allein aus der Bedeutung der Teile Haus/Fu ß ball/Leder/Damen und Schuhe, sondern auch aus unserem enzyklopädischen Wissen.45
1.3.1.3 Der kommunikative Sinn
Wir können zwischen den drei Ebenen der Bedeutung durch die folgenden drei Fragen unterscheiden:
- Was bedeutet die Äußerung allgemein, d. h. ausschließlich bezogen auf ihre grammatische Struktur? (Ausdrucksbedeutung)
- Was bedeutet die Äußerung selbst in dieser Situation? (Äußerungsbedeutung)
- Was meint ein Sprecher in seiner bestimmten Situation mit einer Äußerung zu einem bestimmten Adressaten? (Der kommunikative Sinn)
Anhand des Beispiels „ Ich bin ein Berliner “ können wir klar die Unterscheidung zwischen den drei Ebenen begreifen. Auf der Ebene des Ausdrucks bedeutet dieser Satz, dass der Sprecher die Eigenschaft hat, ein Bürger von Berlin zu sein. Diese Bedeutung bekommt der Satz, wie oben gesagt, durch die Ausdrücke, aus denen er besteht - ich, bin, ein und Berliner - und die Art und Weise, wie sie zusammengesetzt sind. Derselbe Satz hat aber eine neue Bedeutung, wenn man ihn auf der Äußerungsebene interpretiert. Die berühmteste Situation, in der dieser Satz geäußert worden ist, fand am 26. Juni 1963 statt, durch den Präsidenten der USA John F. Kennedy, der den Satz während seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus geäußert hat. In dieser Situation und unter diesen Umständen (Äußerungskontext) hat der Satz die folgende Bedeutung:
John F. Kennedy hat (am 26. Juni 1963) die Eigenschaft, zu der Stadt Berlin zu gehören.
Wir alle wissen, dass John F. Kennedy nicht die wahre, sondern die metaphorische Bedeutung des Satzes gemeint hatte. Er war sicher nicht zum angegebenen Zeitpunkt ein Berliner. John F. Kennedy wollte aber am 26. Juni 1963 versprechen, die Bevölkerung von West-Berlin mit allen Mitteln zu unterstützen, als wäre sie seine eigene. Dies ist der beabsichtigte Zweck der Äußerung (der kommunikative Sinn), der die Sprecherintention wiedergibt und der vom Sprecher nicht wörtlich ausgesprochen wurde.
Mit dem folgenden Satz können wir einerseits jemanden darüber informieren, dass es in einem bestimmten Ort/in einer bestimmten Richtung im Raum eine Tür gibt. Andererseits können wir mit demselben Satz jemanden auffordern, den Raum zu verlassen.
- Das ist die T ü r.
Im Fall der Ironie kann die Sprecherbedeutung (der kommunikative Sinn) sogar das Gegenteil der Äußerungsbedeutung sein:
- Das hast du aber toll gemacht.
Äußern wir diesen Satz, nachdem der Adressat alle Gläser runtergeworfen hat, wollen wir ihn damit sicher nicht loben.
„Der kommunikative Sinn einer Äußerung ist also die vom Sprecher in der Kommunikation intendierte Bedeutung.“46
1.4 Lexikalische & kompositionale Bedeutung
Die Bedeutungen von Wörtern und Sätzen unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt: Bedeutungen von Wörtern, die wir im Laufe unseres Lebens erlernen, werden im Langzeitgedächtnis unseres Gehirns in einem Lexikon, sozusagen „in unserem mentalen Lexikon“ abgespeichert. Diese im Kopf gespeicherten Bedeutungen von diesen Wörtern werden als lexikalische Bedeutungen bezeichnet.47
Dagegen haben wir fast keine vollständigen Satzbedeutungen in unserem mentalen Lexikon gespeichert. Wir bilden Sätze in der Regel mittels der schon im Kopf gespeicherten lexikalischen Bedeutungen spontan und situationsgemäß. Dieser Prozess, also aus den Einzelbedeutungen der Lexeme die Gesamtbedeutung einer Wortgruppe oder eines Satzes herzuleiten, wird Komposition genannt.48 Diese zusammengesetzten Ausdrücke (Wortgruppen und alle normalen Sätze), deren Bedeutung nicht im mentalen Lexikon gespeichert ist, haben daher die sogenannte kompositionale Bedeutung. Das heißt: Diese Konstruktionen sind kompositional analysierbar.
Von diesem Verfahren ausgeschlossen sind zusammengesetzte Ausdrücke (auch komplette Sätze), die eine feste „idiomatische“ Bedeutung haben, wie z. B. Sprichwörter, Phraseologismen, Metaphern o. ä., deren Bedeutung oftmals nicht aus der Zusammenfügung von Bedeutungen der Einzelbestandteile erschlossen wird.49
- Die Flinte ins Korn werfen.
Die Bedeutung dieser Phrase im Sinne von „aufgeben, Bemühungen einstellen“ lässt sich nicht aus der Zusammensetzung der einzelnen lexikalischen Bedeutungen erschließen.50
Es sind häufig zusammen erscheinende Wörter, deren Bedeutung nicht (immer) von den einzelnen Wörter ableitbar ist. Idiomatischen Komposita mit einem metaphorischen Zusammenhang wie z. B. Hochschule, L ö wenzahn wird daher auch der Begriff kompositionale Bedeutung nicht zugesprochen. Es handelt sich hier aber um Wortverbindungen mit lexikalisierten Metaphern, also Metaphern, die einen festen Platz in der Sprache einnehmen. Es sind also keine lebendigen Metaphern mehr, bei denen zwei Konzepte miteinander verknüpft werden.51
Wir können aber auch Wörter gut verstehen, die wir zuvor vielleicht noch nie gehört oder gelesen haben. Ein Beispiel dafür sind solche Wörter, deren Form und Bedeutung man aufgrund der Kenntnis der Grundbedeutung ableiten kann.
Die Bedeutung des Verbs bereifen z. B. ist für uns aufgrund unserer Kenntnis des Substantivs Reifen erschließbar, wenn wir mit den Regeln der Ableitung unserer Sprache vertraut sind. Auch die Bedeutung des Kompositums Fensterblume können wir mühelos verstehen, denn wir kennen sicher seine Einzelwörter, als Fenster und Blume.
1.5 Kompositionalitätsprinzip & Kompositionale Ambiguität
Im Gegensatz zur Bedeutung vieler Wörter ist die Bedeutung von Sätzen nicht im Lexikon abgespeichert. Im vorigen Abschnitt wurde darauf hingewiesen, wie die Bedeutung beliebiger neuer Sätze verstanden werden kann, die wir vorher noch nie gehört haben. Die Bedeutung eines beliebigen Satzes wird durch die Bedeutung der darin enthaltenen Teile und durch die Art ihrer Verknüpfung bestimmt. Das heißt, dass die Bedeutung eines beliebigen komplexen sprachlichen Ausdrucks bzw. eines Satzes kompositional aus den Bedeutungen der einzelnen Wörter ermittelt werden kann. Dieses Prinzip ist unter dem Namen Frege- oder Kompositionalit ä tsprinzip bekannt worden.52
„Kompositionalitätsprinzip [Auch: Fregesches Prinzip der Bedeutung, Funktionalitätsprinzip, Kompositionalitätsprinzip]. Ein meist G. Frege (1848- 1925) zugeschriebenes Prinzip, dem zufolge die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks eine Funktion der Bedeutung seiner Teile und der Art ihrer syntaktischen Kombination ist.“53
Das Kompositionalitätsprinzip scheint vielen Linguisten ein sehr plausibles Prinzip zu sein, weil es erklärt, weshalb man überhaupt eine Sprache lernen kann. Menschliche Sprachen zeichnen sich ja dadurch aus, dass man in ihnen eine ungeheure Menge von Sätzen bilden kann. Das liegt daran, dass es in menschlichen Sprachen keinen „längsten“ Satz gibt. Es ist immer möglich, einen schon sehr langen Satz weiter zu verlängern. Wenn die Zahl der Sätze aber sehr groß oder sogar unendlich ist, dann ist es unmöglich, dass wir, wenn wir eine Sprache lernen, alle möglichen Sätze und ihre Bedeutungen „auswendig“ lernen und dieses Wissen im Kopf zur Verfügung stellen und bei Bedarf abrufen. Vielmehr lernen wir die Bedeutungen der einfachen Wörter, das Lexikon einer Sprache. Wir lernen die Regeln, nach denen Wörter zu größeren Ausdrücken und diese zu immer größeren Ausdrücken zusammengefügt werden - die Syntax einer Sprache, vielleicht einige Dutzend oder hundert Regeln. Diese Regeln sind vielleicht noch immer recht komplex, aber in endlicher Zeit zu bewältigen, da es sich um endliche Datenmengen handelt. Auf diese Weise kann man verstehen, wie die Sprache „unendlichen Gebrauch von endlichen Mitteln“ macht. Damit wird das Problem des Lernens einer unendlichen Sprache im Prinzip lösbar. Und wir lernen schließlich, wie die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks aus der Bedeutung der Teile und der Art ihrer syntaktischen Kombination errechnet werden kann. Dies sind die semantischen Regeln einer Sprache.54
Die Bedeutung eines Satzes bzw. eines komplexen Ausdrucks ergibt sich also aus der Bedeutung der Einzelausdrücke und der Art und Weise, wie sie syntaktisch zusammengesetzt sind (der Struktur des Gesamtausdrucks). Die Interpretation eines Satzes orientiert sich also dabei an dessen syntaktischer Struktur. Parallel zu den syntaktischen Regeln gibt es entsprechende semantische Regeln zur Berechnung der Bedeutung eines komplexen Ausdrucks aus den Bedeutungen seiner Bestandteile. Dieser Prozess benötigt also drei Quellen:
4- die lexikalische Bedeutung der Grundausdrücke,
5- die grammatische Bedeutung ihrer Form,
6- die syntaktische Struktur des komplexen Ausdrucks.55
[...]
1 Übernommen von Mansour, Mohammed Ahmed: Einführung in die Methodik und Terminologie der HadithWissenschaft. 2., verbesserte Auflage,. dÁr al-kamÁl-Verlag, Kairo 2003, S. 7f
2 Vgl. Abschnitt 4.3, 4.8 Form 26.
3 As- SuyuÔÐ, ÉalÁl ad-DÐn ÝAbd ar-RaÎmÁn ibn AbÐ Bakr: al-ÞitqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn. Bearbeitet von SaÝÐd al-MandÙb, erste Auflage, dÁr al-fikr-Verlag, Beirut 1996, Band 1, S. 532
4 Vgl. Taha, Abdul Karim: Types of syntactic ambiguity in English. In IRAL (International Review of Applied Linguistics in Language Teaching/Internationale Zeitschrift für Angewandte Linguistik in der Spracherziehung), 21, Heidelberg 1983, S. 251
5 Vgl. Ernst, Martin: Syntaktische Ambiguität. Eine sprachübergreifende Typisierung auf der Basis des Französischen und Spanischen. Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissenschaft, Frankfurt am Main 2003, S. 7
6 Ebenda, S. 7
7 Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. 3, völlig aktualisierte und erweiterte Aufl., Kröner, Stuttgart 2002, S. 73
8 Fries, Norbert: Ambiguität und Vagheit. Einführung und kommentierte Bibliographie. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1980, S. 4
9 Der Meinung Löbners zufolge ist das Wort „mehrdeutig“ die umgangssprachliche Entsprechung von „ambig“
10 Löbner, Sebastian: Semantik. Eine Einführung. Walter de Gruyter, Berlin 2003, S. 53 19
11 Ulmann, Stephen: Semantik. Eine Einführung in die Bedeutungslehre. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1973, S. 197
12 Empson, William: Seven Types of Ambiguity, London 1947
13 Vgl. Fries: Ambiguität und Vagheit. S. 3. Auch: Dönninghaus, Sabine: Die Vagheit der Sprache. Begriffsgeschichte und Funktionsbeschreibung anhand der tschechischen Wissenschaftssprache. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden 2005. S. 210
14 Es wird auf die Abgrenzung von Homonymie und Polysemie im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit ausführlich zu sprechen gekommen.
15 Vgl. Pinkal, Manfred: Logik und Lexikon - Die Semantik des Unbestimmten. Walter de Gruyter. Berlin. New York 1985. S. 61
16 Vgl. Fries: Ambiguität und Vagheit. S. 4
17 Vgl. Ebenda. S. 5
18 Ebenda. S. 5
19 Pinkal: Vagheit und Ambiguität. In: Stechow, Armin & Wunderlich, Dieter: Semantik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Walter de Gruyter Berlin, New York 1991, S. 266
20 Pinkal 1985 hat das Wort Katze als Beispiel dafür angeführt.
21 Vgl. Pinkal: Logik und Lexikon - Die Semantik des Unbestimmten. S. 61 ff 22
22 Vgl. Black, Max.: Vagueness: An exercise in logical analysis. Philosophy of Science 4, 1937 S. 430, 441, zitiert aus Pinkal 1985: 63
23 Fine, Kit: Vagueness, Truth, and Logic. Syntese 30, 1975, 265-300. S. 282 f. zitiert aus Pinkal 1991: 264
24 Vgl. Pinkal: Logik und Lexikon - Die Semantik des Unbestimmten. S. 53
25 Vgl. Ebenda. S. 53
26 Vgl. Fries: Ambiguität und Vagheit. S. 3
27 Vgl. Ernst: Syntaktische Ambiguität. S. 8
28 Vgl. al-MaraÈÐ, MaÎmÙd AÎmad Îasan: Ýilm al-badÐÝ fÐ al-balaÈa al-Ýarabiya. erste Auflage, dÁr al-ÝulÙm al-Ýarabiya, Beirut 1991, S. 77
29 Agricola, Erhard: Syntaktische Mehrdeutigkeit (Polysyntaktizität) bei der Analyse des Deutschen und Englischen. Akademie Verlag, Berlin 1968, S. 13 f
30 Klein, Wolfgang/Winkler, Susanne: Ambiguität. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Heft 158. Verlag J. B. Mezler, Stuttgart 2010, S. 5
31 Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage Mannheim 2006 [CD-ROM]. Unter „scheinen"
32 Ebenda. Unter „scheinen"
33 Vgl. Klein / Winkler: Ambiguität. S. 5
34 Vgl. Klein / Winkler: Ambiguität. S. 5
35 Ernst hat das zwar offensichtlich nicht formuliert, aber er versuchte nach (Ebbesen 1988) das stoische Gedankengut zu fassen.
36 Ernst: Syntaktische Ambiguität. S. 9
37 Vgl. Löbner: Semantik. S. 3
38 Krifka, Manfred: Semantik, Sommersemester 2007. S. 2 Quelle: http://amor.cms.hu- berlin.de/~h2816i3x/Lehre/2007_GK_Semantik/GK_Semantik_2007.pdf Zugang am 25.03.2010
39 Vgl. Löbner: Semantik. S. 5
40 Bußmann: Lexikon der Sprachwissenschaft. S 361
41 Vgl. Meibauer, Jörg, u. a.: Einführung in die germanistische Linguistik, J. B. Metzler, Stuttgart. Weimar, 2007, S. 176
42 Äußerungskontext
43 Löbner: Semantik. S. 11
44 Vgl. Meibauer: Einführung in die germanistische Linguistik, S. 175 32
45 Vgl. ebenda. S. 175
46 Vgl. Dölling, Johannes: Semantik und Pragmatik. Quelle: http://www.uni- leipzig.de/~doelling/veranstaltungen/semprag2.pdf Zugang am 23.02.2012
47 Vgl. Löbner: Semantik. S. 14
48 Vgl. Eberhardt, Stefan: Komposition und Dekomposition - Möglichkeiten und Ansätze der Bedeutungsanalyse. Magisterarbeit, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2009. S. 4
49 Vgl. Cruse, Alan: Meaning in language: an introduction to semantics and pragmatics. 2. Aufl. Oxford: Oxford University Press 2004. S. 68
50 Vgl. Eberhardt: Komposition und Dekomposition. S. 4
51 Vgl. Tostlebe, Elisa, u. a.: Idiomatische Wendungen und Phraseodidaktik. Quelle: http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03031.pdf Zugang am: 17.03.2012
52 Dieses Prinzip wird oft als „Fregeprinzip“ dem deutschen Philosophen, Logiker und Mathematiker Gottlob Frege (1848-1925) zugeschrieben. Frege hat zwar offensichtlich dieses Prinzip angenommen, aber es gibt keine genaue Stelle in seinem Werk, die man als Formulierung des Prinzips zitierten könnte. Vgl. Krifka: Semantik. S. 11
53 Bußmann: Lexikon der Sprachwissenschaft. S 361
54 Vgl. Krifka: Semantik. S. 11
55 Vgl. Löbner: Semantik. S. 18
- Quote paper
- Alaa Abdelaziz Ali (Author), 2013, Formen der syntaktischen Ambiguität im Deutschen und im Arabischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265125