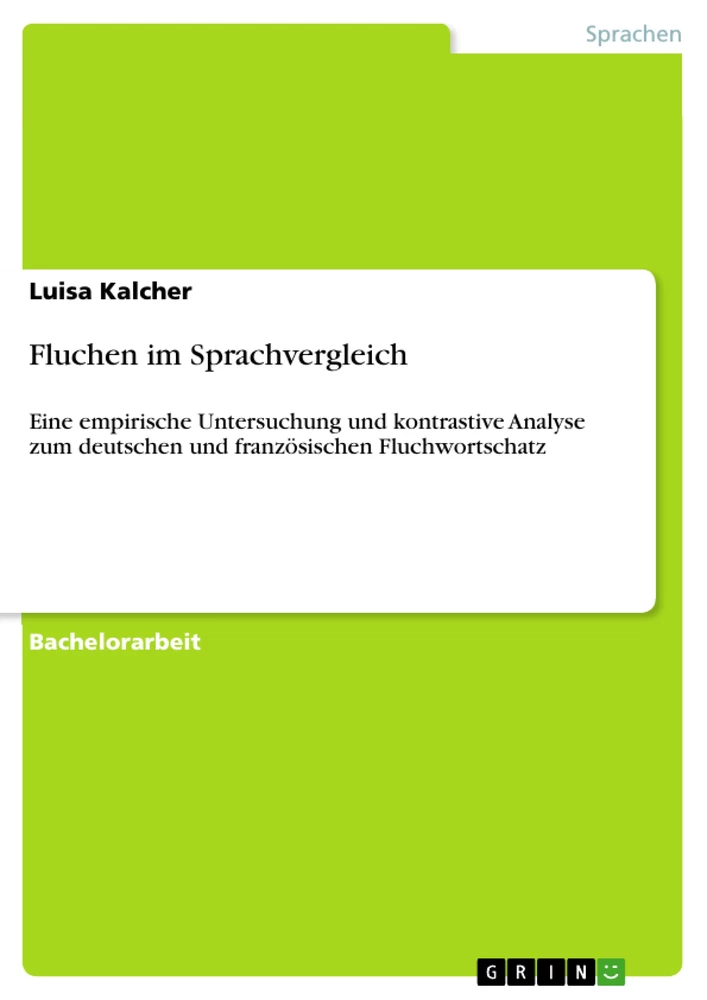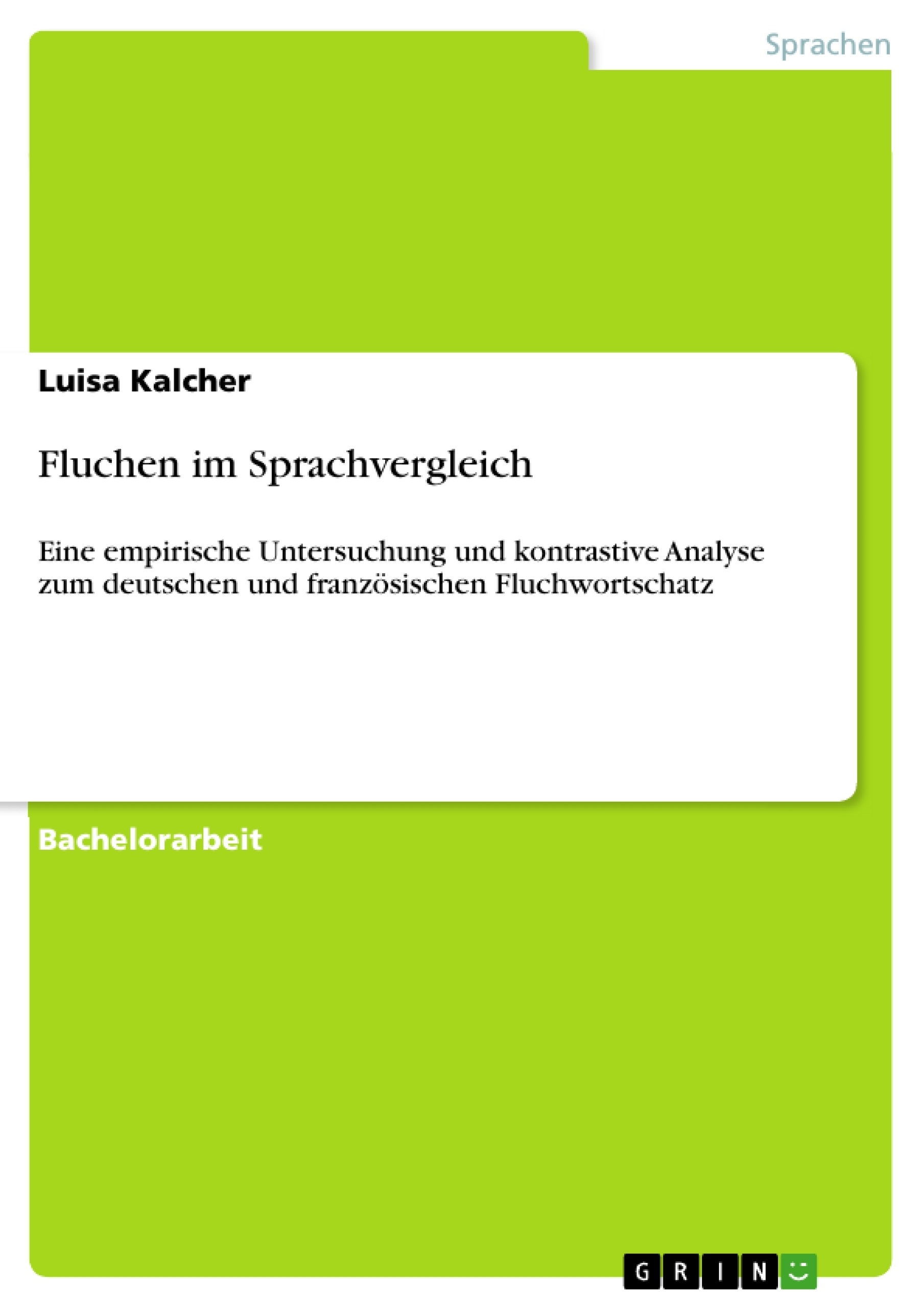Menschen fluchen und schimpfen. Das ist ein menschlicher Urtrieb und zudem Balsam für die Seele. Fluchen ist heutzutage kein Tabuthema mehr und findet in allen sozialen Schichten statt. Fluchen kann man im Dialekt und in der Landessprache. Es ist allgegenwärtig. (Vgl. Achilles / Pighin:141)
„Es begleitet den Menschen als Ausdruck des Unwillens oder der aggressiven Stimmung durch das ganze Leben, seit er Sprache benützt. Überall, wo Menschen miteinander zu tun haben und sich gegenseitig auf die Nerven gehen, wird geschimpft und beschimpft, wird geschmäht und gescholten.“ (Kiener 1983:122)
Fluchen ist zu einem geringen Teil gewiss immer noch ein verpönter Bereich. Das rührt wahrscheinlich daher, dass viele Flüche starke vulgäre Ausdrücke beinhalten und den Außenstehenden unangenehm sind. Zudem gehört es einfach nicht zum guten Ton.
Der Psychologe und Professor Dr. Timothy Jay fand jedoch heraus, dass jeder Mensch durchschnittlich 80 bis 90 Tabuwörter verwendet (vgl. 2009:155). Ein Tabuwort ist ein anderes Wort für ein Fluchwort. Aus diesem Grund erscheint eine kontrastive Analyse von Fluchwörtern und -wendungen nicht nur interessant, sondern auch aufschlussreich.
Diese Arbeit soll nun einen konkreten Vergleich der Fluchwortschätze des Deutschen und Französischen liefern. Dabei handelt es sich zwar um zwei „benachbarte“ Sprachen, jedoch sind sie von Grund auf unterschiedlich. Die kontrastive Analyse einer germanischen und einer romanischen Sprache, die durch ihre geografische sowie geschichtsträchtige Nähe einige Gemeinsamkeiten birgt, ist gerade im Hinblick auf die verbale Aggressionsentladung interessant.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Hintergrund und Stand der Forschung
- Fluchen im Sprachwandel
- Vorhandene Studien
- Theoretische Grundlagen und Methodik
- Begriffsdefinition
- Fluchen in den Wörterbüchern und Begriffsabgrenzung
- Fluchen in der wissenschaftlichen Literatur
- Fluchen als Interjektion oder Exklamation
- Probleme der Abgrenzung zu Schimpfwörtern
- Kurzdefinition
- Fluchwortvarietäten
- Diatopische Varietäten
- Diastratische Varietäten
- Diaphasische Varietäten
- Der Wortschatz des Fluchens
- Funktionen von Fluchwörtern und -wendungen
- Begriffsdefinition
- Empirische Untersuchung
- Informationsbedarf
- Konzeption und Durchführung der Untersuchung
- Vorgehensweise bei der Datenerhebung
- Konzeption des Fragebogens
- Datenerhebung
- Vorbereitung der Daten
- Beschreibung der erhobenen Datensätze
- Aufbereitung und Bereinigung der Datensätze
- Zusammenfassung der bereinigten Datensätze
- Korpusanalyse
- Statistische Befunde zu Wortschatzvarietäten
- Diatopische Varietäten
- Diastratische Varietäten
- Diaphasische Varietäten
- Analyse des klassifizierten Wortschatzes
- Deutsches Korpus
- Französisches Korpus
- Funktionsanalyse
- Deutsches Korpus
- Französisches Korpus
- Kontrastive Analyse
- Statistische Befunde zu Wortschatzvarietäten
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede im deutschen und französischen Fluchwortschatz mittels empirischer Forschung und kontrastiver Analyse. Das Ziel ist, ein umfassendes Bild der jeweiligen Fluchkulturen zu zeichnen und deren Besonderheiten aufzuzeigen.
- Kontrastive Analyse des deutschen und französischen Fluchwortschatzes
- Untersuchung diatopischer, diastratischen und diaphasischer Varietäten
- Empirische Erhebung und Auswertung von Daten zu Fluchwortgebrauch
- Analyse der Funktionen von Fluchwörtern
- Begriffsdefinition und Abgrenzung von Fluchwörtern zu ähnlichen Ausdrücken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Fluchen ein und erläutert dessen Relevanz als sprachliches Phänomen. Sie beschreibt Fluchen als allgegenwärtiges Element der Kommunikation, das trotz seiner oft vulgären Natur von beinahe jedem Menschen genutzt wird. Die Arbeit kündigt eine kontrastive Analyse des deutschen und französischen Fluchwortschatzes an, wobei die geografische und geschichtliche Nähe beider Sprachen als Grundlage für einen interessanten Vergleich dient. Die Zielsetzung der Arbeit und die zentralen Forschungsfragen werden formuliert.
Historischer Hintergrund und Stand der Forschung: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Wandel des Fluchens und analysiert bereits bestehende Studien zu diesem Thema. Es setzt den Fokus auf die Entwicklung und den Gebrauch von Fluchwörtern im Zeitverlauf, um den aktuellen Stand der Forschung zu kontextualisieren und einen fundierten Ausgangspunkt für die eigene Untersuchung zu schaffen. Die Analyse vorhandener Studien dient dazu, die Lücken in der Forschung zu identifizieren, die diese Arbeit zu schließen versucht.
Theoretische Grundlagen und Methodik: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Fluchen" und grenzt ihn von verwandten Begriffen ab, beispielsweise Schimpfwörtern. Es erörtert unterschiedliche Varietäten des Fluchwortschatzes (diatopisch, diastratisch, diaphasisch) und analysiert die Funktionen, die Fluchwörter in der Kommunikation erfüllen können. Dieser Abschnitt bildet die theoretische Basis für die empirische Untersuchung. Die methodischen Ansätze und die gewählte Vorgehensweise werden präzise dargelegt, um die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Studie zu gewährleisten.
Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Konzeption und Durchführung der empirischen Untersuchung, die die Grundlage für die spätere Korpusanalyse bildet. Detailliert wird auf die Vorgehensweise bei der Datenerhebung, die Konzeption des Fragebogens sowie die Methoden der Datenerhebung und -aufbereitung eingegangen. Die Beschreibung der erhobenen Datensätze und die detaillierte Darstellung der Datenaufbereitung und -bereinigung unterstreichen die methodische Stringenz der Arbeit. Die Transparenz des Vorgehens ermöglicht eine kritische Beurteilung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Fluchen, Sprachvergleich, Deutsch, Französisch, Empirische Untersuchung, Kontrastive Analyse, Fluchwortschatz, Diatopie, Diastratie, Diaphasie, Varietäten, Funktionen, Korpusanalyse, Aggression, Tabuwörter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kontrastive Analyse des deutschen und französischen Fluchwortschatzes
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede im deutschen und französischen Fluchwortschatz mittels empirischer Forschung und kontrastiver Analyse. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der jeweiligen Fluchkulturen zu zeichnen und deren Besonderheiten aufzuzeigen.
Welche Aspekte des Fluchwortschatzes werden untersucht?
Die Arbeit analysiert diatopische (geographische), diastratische (sozial) und diaphasische (situative) Varietäten des Fluchwortschatzes in beiden Sprachen. Sie untersucht außerdem die Funktionen von Fluchwörtern in der Kommunikation und definiert den Begriff "Fluchen" präzise, wobei eine Abgrenzung zu ähnlichen Ausdrücken (z.B. Schimpfwörter) erfolgt.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit einer empirischen Untersuchung. Die empirische Untersuchung beinhaltet die Entwicklung und Anwendung eines Fragebogens zur Datenerhebung, die Aufbereitung und Bereinigung der Daten sowie eine Korpusanalyse des gesammelten Materials (deutsches und französisches Korpus). Eine kontrastive Analyse der Ergebnisse bildet den Kern der Auswertung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Hintergrund und Stand der Forschung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen und der Methodik, ein Kapitel zur empirischen Untersuchung, ein Kapitel zur Korpusanalyse und abschließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter erleichtern die Orientierung.
Welche konkreten Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die folgenden Punkte: Kontrastive Analyse des deutschen und französischen Fluchwortschatzes, Untersuchung diatopischer, diastratischen und diaphasischer Varietäten, empirische Erhebung und Auswertung von Daten zu Fluchwortgebrauch, Analyse der Funktionen von Fluchwörtern und Begriffsdefinition und Abgrenzung von Fluchwörtern zu ähnlichen Ausdrücken.
Welche Daten wurden erhoben und wie wurden sie analysiert?
Die Datenerhebung erfolgte mittels eines Fragebogens. Die Daten wurden anschließend aufbereitet und bereinigt, bevor sie in einer Korpusanalyse statistisch ausgewertet wurden. Die Analyse umfasst sowohl die Betrachtung von Wortschatzvarietäten als auch die Funktionsanalyse der Fluchwörter in beiden Sprachen.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert statistische Befunde zu den Wortschatzvarietäten (diatopisch, diastratisch, diaphasisch) im deutschen und französischen Korpus. Die Ergebnisse der Funktionsanalyse werden ebenfalls detailliert dargestellt und kontrastiv verglichen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Sprachwissenschaftler, Soziolinguisten und alle, die sich für die sprachliche und kulturelle Bedeutung von Fluchen interessieren. Die Ergebnisse können auch für die Erstellung von Wörterbüchern, die Entwicklung von Sprachlehrmaterialien und die interkulturelle Kommunikation von Bedeutung sein.
- Quote paper
- Luisa Kalcher (Author), 2013, Fluchen im Sprachvergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265046