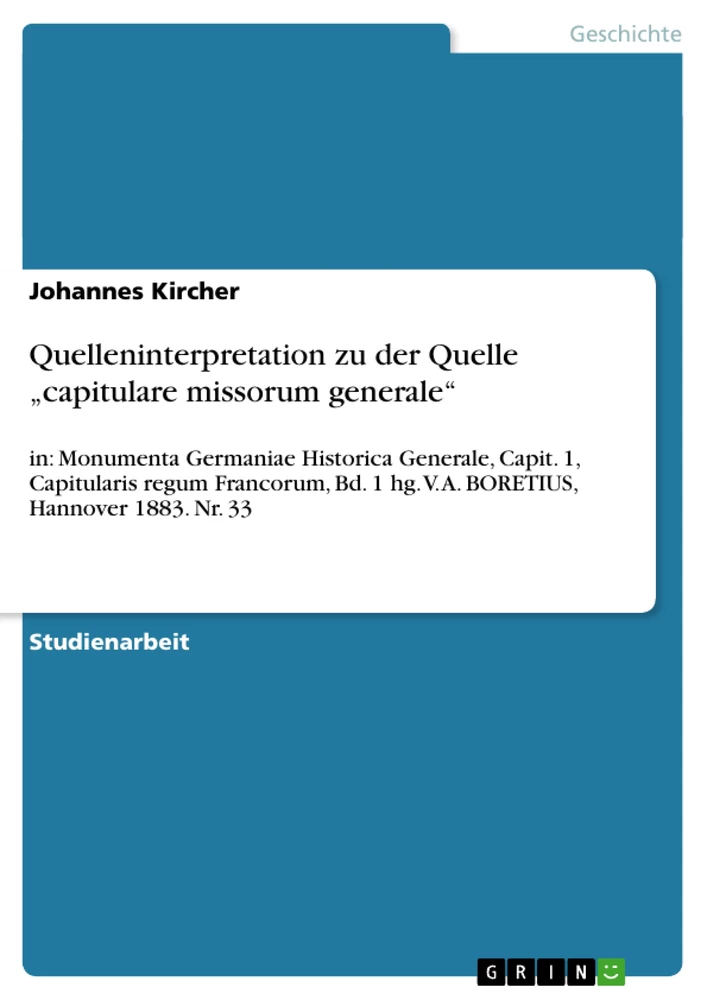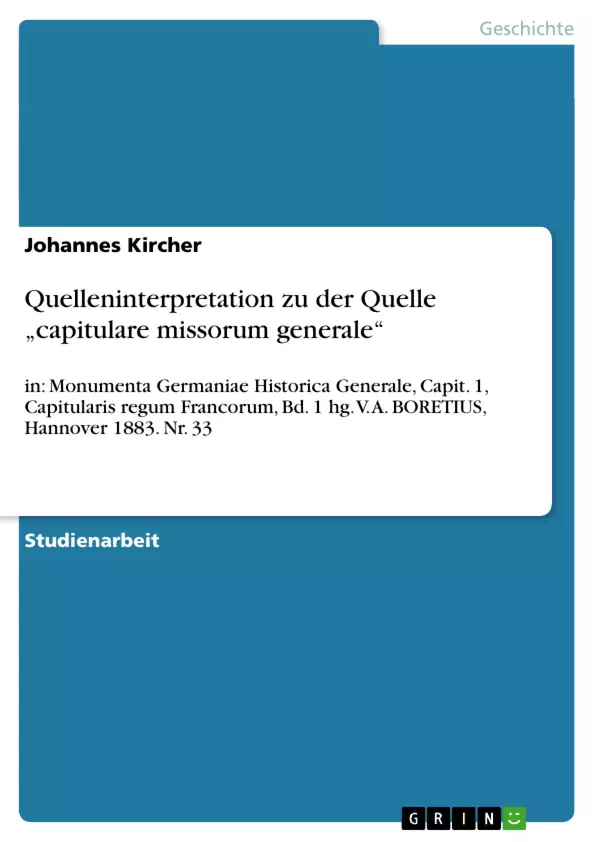Karl der Große war ein besonderer Herrscher, der in die Geschichte einging als ein
Regent, der ein Großreich durch Kriege erschuf und festigte. Seine tiefe Religiosität war
Vorbild für viele Herrscher. Die Berufung darauf, dass sein Amt Gottes Wille sei, zieht
sich wie ein roter Faden durch das gesamte Mittelalter und wurde erst mit der
Französischen Revolution, jedenfalls in Frankreich, beendet. Dieses ideologische
Konstrukt gab ihm die Sicherheit nichtchristliche Völker zu unterwerfen und zu
Christianisieren. Diese tiefe Religiosität spiegelt sich auch in dem sehr guten Verhältnis
zum Papst wieder, das schon sein Vater zu pflegen verstand. Aber wie regiert man ein
solches Großreich, mit den vielen verschiedenen Kulturen und lokalen Herrschern? Wie
die Römer konnte es Karl der Große nicht machen. Sie unterwarfen zwar im größeren
Maßstab fast ganz Europa, aber sie beließen den lokalen Völkern ihren Glauben und ihre
Riten. Dadurch blieb der Rebellionslevel geringer. Karl der Große aber, der sich
„allerchristliche Herr Kaiser“ nannte, war ein Missionarseiferer. Eine typische Form des
Katholizismus ist das massive Sendungsbewusstsein der Gläubigen. So unterwarf er
nicht nur die Sachsen, sondert Christianisiert sie auch. Damit sah sich Karl der Große mit
einem Problem konfrontiert: Wie soll ein großes Reich mit den vielen verschiedenen
Kulturen nach Gottes Wille regiert werden und welche Maßnahmen hat er veranlasst?
Das Kapitular „capitulare missorum generale“, welches ich bearbeiten werde, gibt da
einen Einblick in die Verwaltung des Frankenreiches. Dabei ist auch zu klären, ob die
Quelle Antwort darauf gibt, wie ein monotheistisches Großreich zu regieren ist. Lebten
dabei alle mit gleichem Recht, nach heutigem Sinne, oder wurde unterschieden zwischen
den verschiedenen Stämmen und zwischen Adel, Klerus und Laien?
1. Quellenkritik
1.1 Quellenbeschreibung
Die Quelle, die ich interpretieren werde ist ein Kapitular mit dem Namen „capitulare missourum generale“, aus dem Jahre 802. Das Original ist in lateinischer Schrift verfasst und kommt aus dem Umfeld von Karl den Großen. Sie beschreibt Verhaltensweisen für missi dominici, also Königsboten, die in das Herrschaftsgebiet Karl des Großen entsandt wurden, um das gültige Rechtssystem lokal zu überprüfen und umzusetzen. Aber was ist ein Kapitular? Kapitularien sind Erlasse der Staatsgewalt, „um Maßnahmen der Gesetzgebung oder der Verwaltung bekanntzumachen“[1] Die Regierung um Karl des Großen verwendete erstmals häufig das Wort „Capitular“, welches auch eine Straftat bedeuten konnte, wie im „Capitular Saxonicum“ aus dem Jahre 797.[2] Schon Chlodovech I. erließ ein Kapitular zwischen 507 und 511.[3] Nach Sören Kaschke wurden die Kapitularien benutzt, um das pluralistische Großreich rational zu korrigieren und zu ordnen.[4] Denn durch die massive Expansion, die daraus resultierende Zunahme an verschiedener Kultur, sowie die voranschreitende Christianisierung, benötigte eine neue Form der Regelung innerhalb des Rechtssystems. Ganshof glaubt dabei, dass die „bindende Kraft der Kapitularien[…] ausschließlich vom König oder Kaiser“[5] ausgeht. Dies ergibt auf jeden Fall einen Sinn, da der König oder Kaiser die Banngewalt inne hatte. Er konnte „seines Rechts zu befehlen, zu verbieten und zu strafen“.[6] Für Uwe Wesel sind die Kapitularien „ ein riesiges Konglomerat von Allgemeinen und Besonderen, weltlich und kirchlich, wichtig und unwichtig, in jedem Fall aber unübersichtlich, denn amtliche Sammlungen gab es nicht.“[7] Natürlich kann man den heutigen Standard der Rechtgeschichte mit der des frühen 9. Jahrhunderts nicht vergleichen, denn mit den Kapitularien waren es die ersten Versuche das Reich einheitlich und mit gleichem Recht zu regieren. Aber es gab auch Sondergesetze, wie das „capitulare de partibus Saxoniae“, die den Sachsen vorgaben, wie sie zu leben und sich zu verhalten haben.[8] Auf jeden Fall stellen das „capitula missorum“ eine Sonderform dar[9], welche auch die „capitulare missorum generale“ umfasst. „Capitula missorum“ sind Anweisungen an Königsboten, die ins Reich geschickt wurden, um diese zum Teil auch zu publizieren.[10] Diese Kapitulariengesetzgebung ist ein wesentliches Merkmal des „karolingischen Staatszentralismus“.[11]
Das Kapitular „Capitulare missorum generale“ ist uns vollständig erhalten und ist in der Monumenta Germaniae Historica auf Latein zusammengefasst. [12] In dem Hilfsmittel „ Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta“ist zu lesen dass, „trotz seines bedeutenden Inhalts“ es nur in der Monumenta Germaniae Historica überliefert ist. [13] Dies ist aber kein Original sondern eine Abschrift. Wilfried Hartmann hingegen behauptet in „Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen“: „Das hier wiedergegebene Kapitular ist nur noch in einer Handschrift erhalten.“ [14] Wo es sich befindet wurde leider nicht erwähnt. Boretius erwähnt als Einleitung von dem „capitulare missorum generale“ in der Monumenta Germaniae Historica, dass es einzig im „codici parisieni 4613“ (fol. 91) existiert. [15] Boretius Stand der Dinge ist aber nun 130 Jahre her und in der Zeit kann viel passiert sein. Es kann sein, dass das Original in der „Bibliothéque nationale de France“ noch vorhanden ist, da dort der Pariser Kodex (codici parisieni) verwahrt wird. In dem Pariser Kodex sind unter anderem fränkischen Reichsannalen aus dem 9. Jahrhundert vorhanden, [16] aber ob das gesuchte Dokument auch dort vorhanden ist, ist Spekulation. Die Faktenlage ob es das Original noch gibt, ist dementsprechend diffus und kann auch nach bemühter Recherche nicht geklärt werden. Auf jeden Fall war oder ist es ein in lateinischer Handschrift verfasstes Kapitular, welches im Rahmen einer Reichsversammlung im Jahre 802 von Karl des Großen erlassen wurde. [17]
[...]
[1] Ganshof, Francois-Louis, Was waren die Kapitularien?, Darmstadt 1961. S. 13
[2] Ebd. S. 17
[3] Lautemann, Wolfgang, Geschichte in Quellen und Darstellungen, Bd. 1: Frühes und hohes Mittelalter 750-1250, Stuttgart 1995, S. 914
[4] Kaschke, Sören, Die karolingischen Reichsteilungen bis 831, Hamburg 2006. S 38
[5] Ganshof, Francois-Louis, Was waren die Kapitularien?, Darmstadt 1961. S. 52
[6] Ebd. S. 52
[7] Wesel, Uwe, Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart, München 20063. S. 291
[8] Vgl. Ebd. S. 291
[9] Vgl. Volkert, Wilhelm, Kleines Lexikon des Mittelalters. München 1999. S. 130
[10] Vgl. ebd. S. 130
[11] Ebd. S. 130
[12] Monumenta Germaniae Historica, Capit. 1, Capitularis regum Francorum, Bd. 1 hg. V. A. Boretius, Hannover 1883. Nr. 33, S. 91
[13] Vgl. Mordek, Hubert, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta, München 1995. S. 474
[14] Hartmann, Wolfgang (Hg.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen, Bd. 1: Frühes und hohes Mittelalter 750 – 1250, Stuttgart 1995. S. 59
[15] Monumenta Germaniae Historica, Capit. 1, Capitularis regum Francorum, Bd. 1 hg. V. A. Boretius, Hannover 1883. Nr. 33, S. 91
[16] Vgl. Egger, Christoph, Weigel, Herwig, Text – Schrift – Codex, Quellenurkundliche Arbeiten aus dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Oldenburg 1999. S. 75
[17] Hartmann, Wolfgang (Hg.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen, Bd. 1: Frühes und hohes Mittelalter 750 – 1250, Stuttgart 1995. S. 59
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 'capitulare missorum generale'?
Es ist ein im Jahr 802 von Karl dem Großen erlassenes Kapitular, das Verhaltensregeln für Königsboten (missi dominici) festlegt, um das Recht im Reich zu sichern.
Wer waren die 'missi dominici'?
Die 'missi dominici' waren Königsboten, die in das Herrschaftsgebiet entsandt wurden, um das gültige Rechtssystem lokal zu überprüfen und umzusetzen.
Was war der Zweck der Kapitularien Karls des Großen?
Sie dienten dazu, das pluralistische Großreich mit seinen vielen Kulturen rational zu ordnen, zu korrigieren und eine einheitliche Verwaltung zu schaffen.
Wie hängen Religion und Herrschaft bei Karl dem Großen zusammen?
Karl sah sein Amt als Gottes Wille an. Seine tiefe Religiosität und sein Sendungsbewusstsein führten zur Christianisierung unterworfer völker wie der Sachsen.
Existiert das Original des Kapitulars von 802 noch?
Die Quellenlage ist diffus; erhalten sind vor allem Abschriften, wie sie in der Monumenta Germaniae Historica auf Basis eines Pariser Kodex dokumentiert sind.
- Quote paper
- Johannes Kircher (Author), 2011, Quelleninterpretation zu der Quelle „capitulare missorum generale“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265017