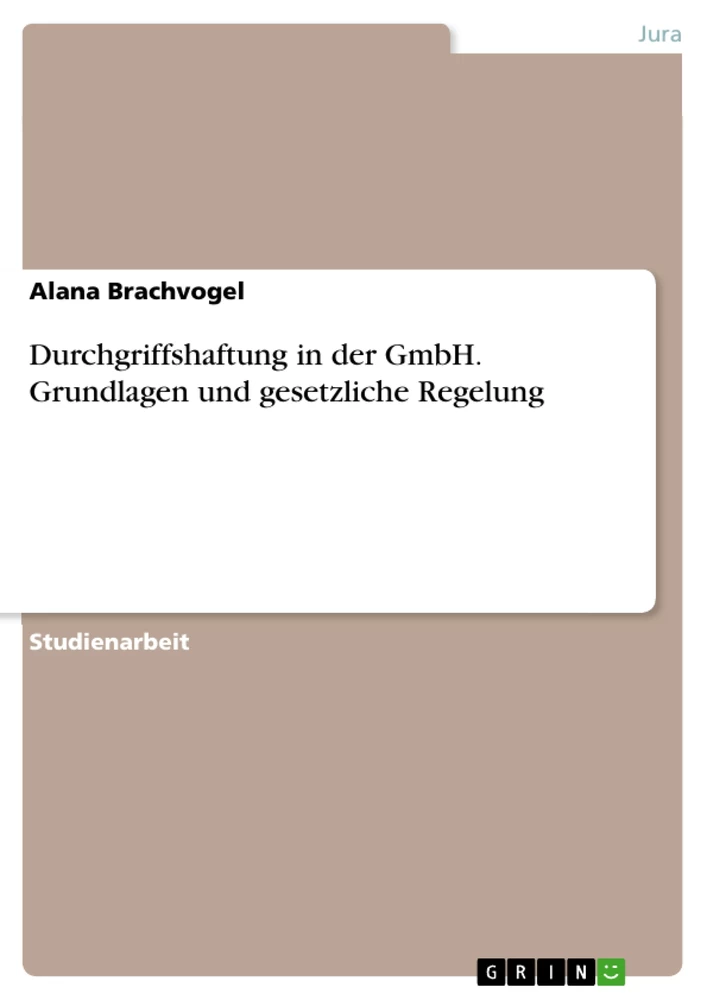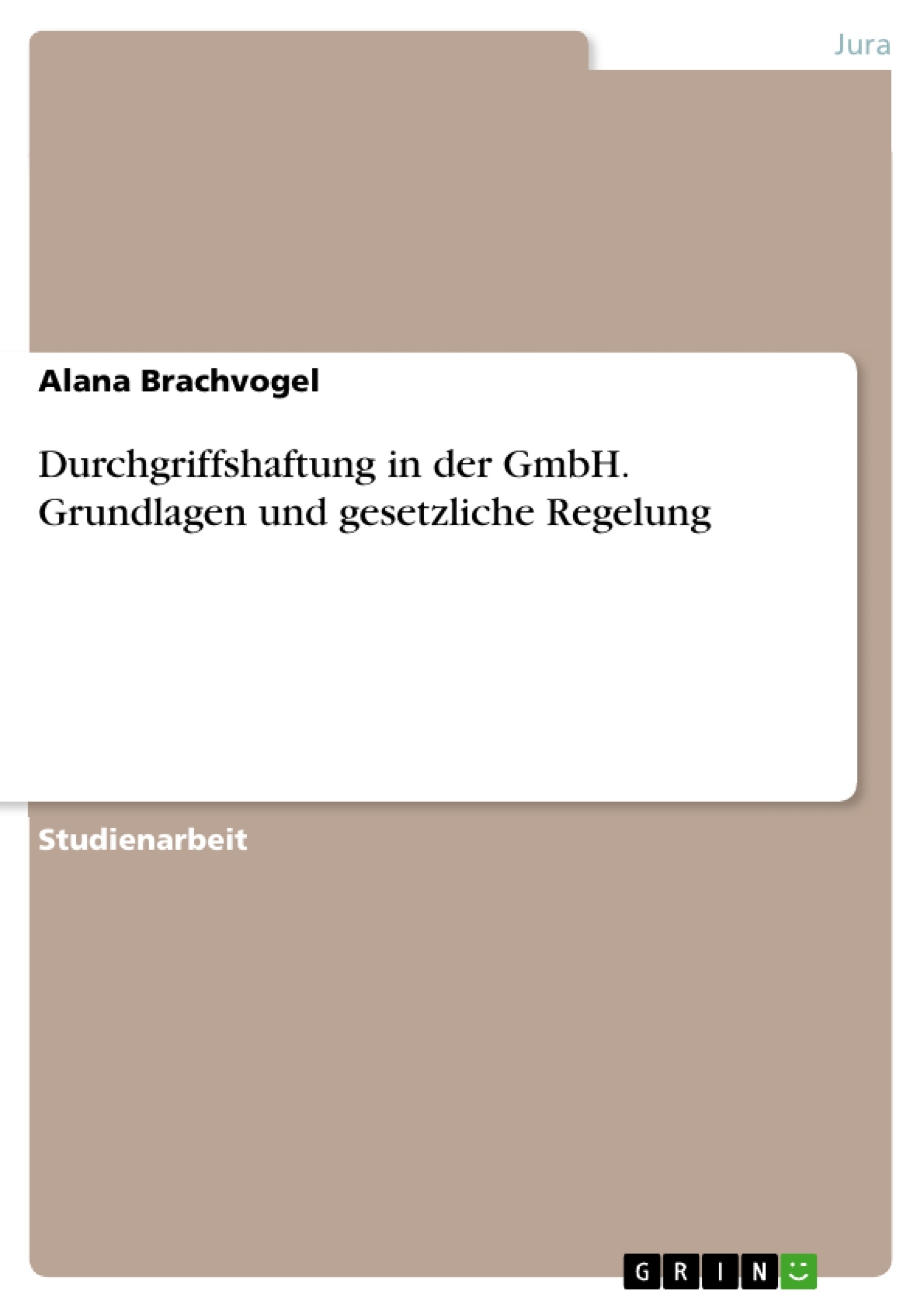Die GmbH ist eine „juristische Person“ und hat ihre eigene Rechtspersönlichkeit. Die Haftungsbeschränkung einer GmbH ist ein wichtiger Bestandteil dieser und ein Privileg. Gemäß § 13, Abs. 2, GmbHG haftet die GmbH mit ihrem Gesamtvermögen und nicht der Gesellschafter mit seinem Privatvermögen.
Bei einer OHG vergleichend gilt gemäß § 128 HGB, dass der Gesellschafter persönlich mit seinem Vermögen haftet.
Der Gesellschafter einer GmbH erkauft sich das Haftungsprivileg der Rechtsform dadurch, dass er die GmbH mit dem Stammkapital, wie im Gesellschaftsvertrag festgelegt, ausstattet.
Diese eben genannte Haftungsbeschränkung bringt Probleme mit sich. Aufgrund dessen kommt die Durchgriffshaftung ins Spiel. Sie gilt als Rechtsinstrument, um die Trennung zwischen Gesellschafter und GmbH aufzuheben und greift durch die „juristische Person“ auf den im Hintergrund agierenden Gesellschafter zu.
Die Durchgriffshaftung ist nicht gesetzlich geregelt, das heißt es ist der Rechtsprechung überlassen angemessen zu reagieren. Die Entscheidung über einen Durchgriff ist im wesentlichen Richterrecht. Die Rechtsprechung verwendet fallweise unterschiedliche Begründungselemente für ihre Entscheidung. Insgesamt gibt es strenge Anforderungen, nach denen der Bundesgerichtshof entscheidet, da die Haftungsbeschränkung einer GmbH nicht leichtfertig aufgehoben werden darf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Haftung einer GmbH
- 1.1 Haftungsgrundlagen in der GmbH
- 1.2 Trennungsprinzip
- 2. Haftungsdurchgriff
- 2.1 Vermögensvermischung
- 2.2 Unterkapitalisierung
- 3. Deliktische Innenhaftung
- 3.1 Existenzvernichtungseingriff
- 4. Deliktische Außenhaftung
- 5. Unechter Durchgriff
- 5.1 Vertragsauslegung
- 5.2 Zurechnungsdurchgriff
- 5.3 Umgekehrter Durchgriff
- 6. Gesetzliche Regelung
- 6.1 Vorteile
- 6.2 Nachteile
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Durchgriffshaftung in der GmbH und analysiert die verschiedenen Konstellationen, in denen eine Haftung des Gesellschafters trotz der beschränkten Haftung der GmbH in Betracht kommt. Die Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und die verschiedenen Formen der Durchgriffshaftung.
- Haftungsgrundlagen der GmbH und das Trennungsprinzip
- Verschiedene Formen des Haftungsdurchgriffs (Innen- und Außenhaftung)
- Deliktische Haftung und deren Voraussetzungen
- Vermögensvermischung und Unterkapitalisierung als Auslöser für Durchgriffshaftung
- Gesetzliche Regelungen und deren Vor- und Nachteile
Zusammenfassung der Kapitel
1. Haftung einer GmbH: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der GmbH-Haftung dar. Es erklärt die beschränkte Haftung der GmbH gemäß § 13 Abs. 2 GmbHG und den Unterschied zur persönlichen Haftung des Gesellschafters in einer OHG gemäß § 128 HGB. Der Fokus liegt auf der Haftungsbeschränkung als Privileg, das durch die Ausstattung der GmbH mit dem im Gesellschaftsvertrag festgelegten Stammkapital erkauft wird. Das Kapitel führt ein in das Thema der Durchgriffshaftung als Instrument zur Aufhebung der Trennung zwischen Gesellschafter und GmbH und betont den richterrechtlichen Charakter dieser Haftung.
2. Haftungsdurchgriff: Dieses Kapitel beschreibt die Voraussetzungen für einen Haftungsdurchgriff, nämlich den Missbrauch der Rechtsform und ein zurechenbares Verhalten des Gesellschafters. Unternehmerische Fehlentscheidungen allein genügen nicht. Es werden wichtige Fallgruppen wie Vermögensvermischung und Unterkapitalisierung vorgestellt, die die Rechtsprechung als Indizien für einen Missbrauch der Rechtsform wertet. Der Abschnitt betont, dass die Durchgriffshaftung nicht gesetzlich geregelt ist und auf der Rechtsprechung basiert.
3. Deliktische Innenhaftung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die deliktische Innenhaftung, insbesondere den Existenzvernichtungseingriff. Hier wird der Fall beschrieben, in dem der Gesellschafter der GmbH derart Vermögen entzieht, dass diese ihre Verbindlichkeiten nicht mehr erfüllen kann. Es wird auf die Rechtsprechung eingegangen, die die Gefahr des Vermögensentzugs zum Nachteil der Gläubiger erkannt hat und dies als missbräuchlich einstuft. Das Kapitel beinhaltet die Fallstudie der Bremer Vulkan-Werft als Beispiel für einen Durchgriff aufgrund von §242 BGB und die darauffolgende Änderung des Haftungskonzepts durch den BGH.
Schlüsselwörter
Durchgriffshaftung, GmbH, Haftungsgrundlagen, Trennungsprinzip, Vermögensvermischung, Unterkapitalisierung, deliktische Haftung, Innenhaftung, Außenhaftung, Existenzvernichtungseingriff, Missbrauch der Rechtsform, Richterrecht, § 13 GmbHG, § 826 BGB, § 242 BGB.
FAQs: Durchgriffshaftung in der GmbH
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Durchgriffshaftung in der GmbH. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Konstellationen, in denen eine Haftung des Gesellschafters trotz der beschränkten Haftung der GmbH möglich ist.
Welche Themen werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Haftungsgrundlagen der GmbH, das Trennungsprinzip, verschiedene Formen des Haftungsdurchgriffs (Innen- und Außenhaftung), deliktische Haftung und deren Voraussetzungen, Vermögensvermischung und Unterkapitalisierung als Auslöser für Durchgriffshaftung, sowie die gesetzlichen Regelungen und deren Vor- und Nachteile. Es werden Beispiele aus der Rechtsprechung, wie der Fall Bremer Vulkan, erläutert.
Was ist Durchgriffshaftung?
Durchgriffshaftung bedeutet, dass der Gesellschafter einer GmbH trotz der beschränkten Haftung der Gesellschaft persönlich für die Schulden der GmbH haftet. Dies geschieht in Ausnahmefällen, wenn die Rechtsform der GmbH missbräuchlich genutzt wird, z.B. durch Vermögensvermischung oder Unterkapitalisierung.
Welche Voraussetzungen müssen für einen Haftungsdurchgriff vorliegen?
Ein Haftungsdurchgriff setzt in der Regel den Missbrauch der Rechtsform und ein zurechenbares Verhalten des Gesellschafters voraus. Unternehmerische Fehlentscheidungen allein reichen nicht aus. Indizien für einen Missbrauch können Vermögensvermischung und Unterkapitalisierung sein.
Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenhaftung?
Die Innenhaftung betrifft die Haftung des Gesellschafters gegenüber der GmbH selbst (z.B. bei Verstößen gegen Treuepflichten). Die Außenhaftung betrifft die Haftung des Gesellschafters gegenüber den Gläubigern der GmbH.
Welche Rolle spielt die Vermögensvermischung und Unterkapitalisierung?
Vermögensvermischung und Unterkapitalisierung sind wichtige Indizien für einen Missbrauch der Rechtsform und können einen Haftungsdurchgriff auslösen. Sie zeigen an, dass die Trennung zwischen Gesellschafter und GmbH nicht mehr gewahrt ist.
Welche gesetzlichen Regelungen gibt es zur Durchgriffshaftung?
Die Durchgriffshaftung ist nicht gesetzlich im Detail geregelt, sondern basiert maßgeblich auf der Rechtsprechung. Das Dokument analysiert jedoch die relevanten Paragraphen und deren Bedeutung im Kontext der Durchgriffshaftung (z.B. § 13 GmbHG, § 826 BGB, § 242 BGB).
Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus den gesetzlichen Regelungen?
Das Dokument beleuchtet die Vor- und Nachteile der (fehlenden) gesetzlichen Regelungen der Durchgriffshaftung. Vorteile liegen möglicherweise in der Flexibilität der Rechtsprechung, Nachteile in der Unsicherheit und mangelnden Vorhersehbarkeit.
Was ist der Fall Bremer Vulkan und seine Bedeutung?
Der Fall Bremer Vulkan dient als Beispiel für einen Haftungsdurchgriff aufgrund von § 242 BGB (Vertrauensmissbrauch) und zeigt, wie die Rechtsprechung das Haftungskonzept im Laufe der Zeit angepasst hat. Er illustriert die Konsequenzen von Existenzvernichtungseingriffen.
Welche Schlüsselwörter sind im Zusammenhang mit der Durchgriffshaftung relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Durchgriffshaftung, GmbH, Haftungsgrundlagen, Trennungsprinzip, Vermögensvermischung, Unterkapitalisierung, deliktische Haftung, Innenhaftung, Außenhaftung, Existenzvernichtungseingriff, Missbrauch der Rechtsform, Richterrecht, § 13 GmbHG, § 826 BGB, § 242 BGB.
- Quote paper
- Alana Brachvogel (Author), 2013, Durchgriffshaftung in der GmbH. Grundlagen und gesetzliche Regelung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265014