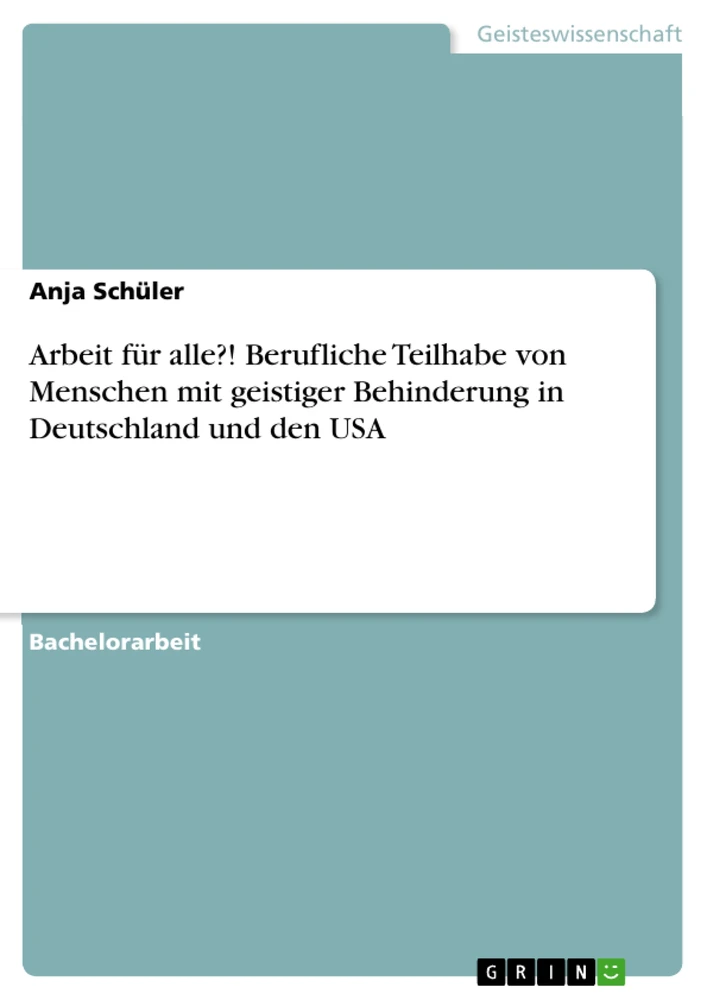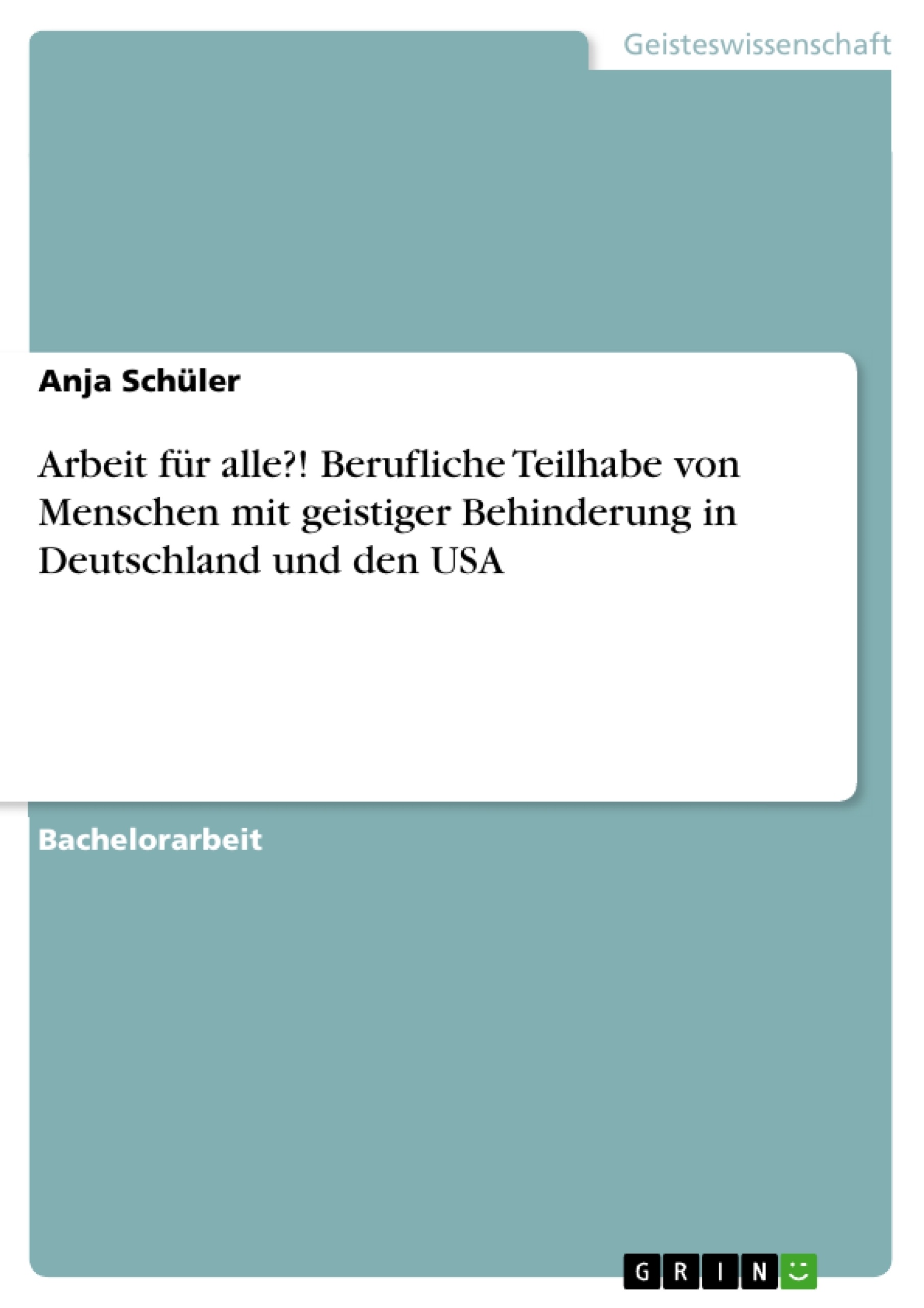Die Mitglieder der Vereinten Nation haben sich in der UN Behinderten
Rechtskonvention in Artikel 27 darauf verständigt, dass Menschen mit Behinderung ein Recht auf Arbeit und Beschäftigung (auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt) haben und auch durch Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen
dürfen und sollten. Arbeit hat in der modernen Gesellschaft eine Vielzahl
von Funktionen und nimmt einen großen zeitlichen Anteil in unserem
Leben ein. Grundlegend gilt regulär, dass in westlichen Gesellschaften nur
Erwerbsarbeit als „echte“ Arbeit anerkannt wird. Arbeit soll materiell absichern.Daneben hat Arbeit eine strukturierende Funktion, denn sie teilt das
Leben räumlich in den Wohnbereich und in den Arbeitsbereich und trennt
ebenso zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Durch diese Trennung kommt ihr
ein bedeutendes Gewicht im Rahmen der Normalisierungsidee zu.
Neben der strukturierenden Funktion hat Arbeit auch eine soziale Funktion.
Dadurch, dass Menschen viel Zeit in ihrer Arbeitsstätte verbringen (2008
arbeiteten die deutschen Arbeitnehmer im Schnitt 41,2 Std pro Woche),
geschieht dort weit mehr als die reine Arbeitstätigkeit, es findet dort Kommunikation und Austausch statt und es können unter anderem auch private
relevante Kontakte entstehen. Erwerbsarbeit ist bedeutend für die soziale
Anerkennung und somit für die Stellung der eigenen Rolle in der Gesellschaft.
Die Erwerbsarbeit definiert zu weiten Teilen den sozialen Status.
Letztlich ist Erwerbsarbeit auch Aktivität und sie macht deutlich, dass man
durch seine Tätigkeit zu etwas im Arbeitsleben beiträgt und sich in die Gesellschaft mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringt...
Um die Schlaglichter auf mögliche Schritte dieser Entwicklung hinwerfen zu
können, wird zunächst die Begrifflichkeit der beruflichen Teilhabe dargestellt.
Im Anschluss daran werden die Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe
in Deutschland skizziert, d.h. das ursprüngliche Werkstattsystem der
Nachkriegszeit und die entwickelten Ergänzungen zu diesem System und
danach wird die Situation der beruflichen Teilhabe in den USA dargestellt,
um mögliche Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung in Deutschland
ziehen zu können. Zum Abschluss werden Möglichkeiten für die Optimierung
der Integration bzw. der inklusiven Arbeitsbedingungen im Rahmen
eines Fazits dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von beruflicher Teilhabe
- 3. Möglichkeiten von beruflicher Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland
- 3.1 Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- 3.2 Exkurs Integrationsfachdienste
- 3.3 Ausgelagerte Werkstattarbeitsplätze
- 3.4 Integrationsbetriebe bzw. Integrationsfirmen
- 3.5 Supported Employment als Integrationsmöglichkeit
- 3.6 Persönliches Budget als Lösungsansatz
- 3.6.1 JobBudget
- 3.6.2 Budget für Arbeit
- 3.7 Zwischenfazit
- 4. Möglichkeiten von beruflicher Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung in den USA
- 4.1 Rechtlicher Rahmen
- 4.2 Sheltered Workshops
- 4.3 Supported Employment
- 4.4 Zwischenfazit
- 5. Fazit
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der beruflichen Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung im internationalen Vergleich. Ziel ist es, die verschiedenen Modelle der beruflichen Teilhabe in Deutschland und den USA zu analysieren und Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen und Chancen der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in den Arbeitsmarkt und die Rolle des Werkstattsystems in beiden Ländern.
- Definition von beruflicher Teilhabe
- Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe in Deutschland und den USA
- Rechtlicher Rahmen und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung
- Werkstattsystem und Supported Employment als Integrationsmodelle
- Herausforderungen und Chancen der Inklusion im Arbeitsleben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Arbeit in der modernen Gesellschaft und die Problematik der fehlenden Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Kapitel 2 definiert den Begriff der beruflichen Teilhabe. Kapitel 3 geht detailliert auf die verschiedenen Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe in Deutschland ein, darunter Werkstätten für behinderte Menschen, Integrationsfachdienste, ausgelagerte Werkstattarbeitsplätze, Integrationsbetriebe, Supported Employment und das Persönliche Budget.
Kapitel 4 widmet sich den Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe in den USA. Der Fokus liegt dabei auf dem rechtlichen Rahmen, den Sheltered Workshops und Supported Employment. Das Zwischenfazit in Kapitel 4 stellt einen Vergleich der beiden Länder dar.
Schlüsselwörter
Berufliche Teilhabe, geistige Behinderung, Inklusion, Integration, Werkstattsystem, Supported Employment, Deutschland, USA, Rechtlicher Rahmen, Arbeitsmarkt, Lebensunterhalt, soziale Integration.
- Quote paper
- Anja Schüler (Author), 2013, Arbeit für alle?! Berufliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland und den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264757