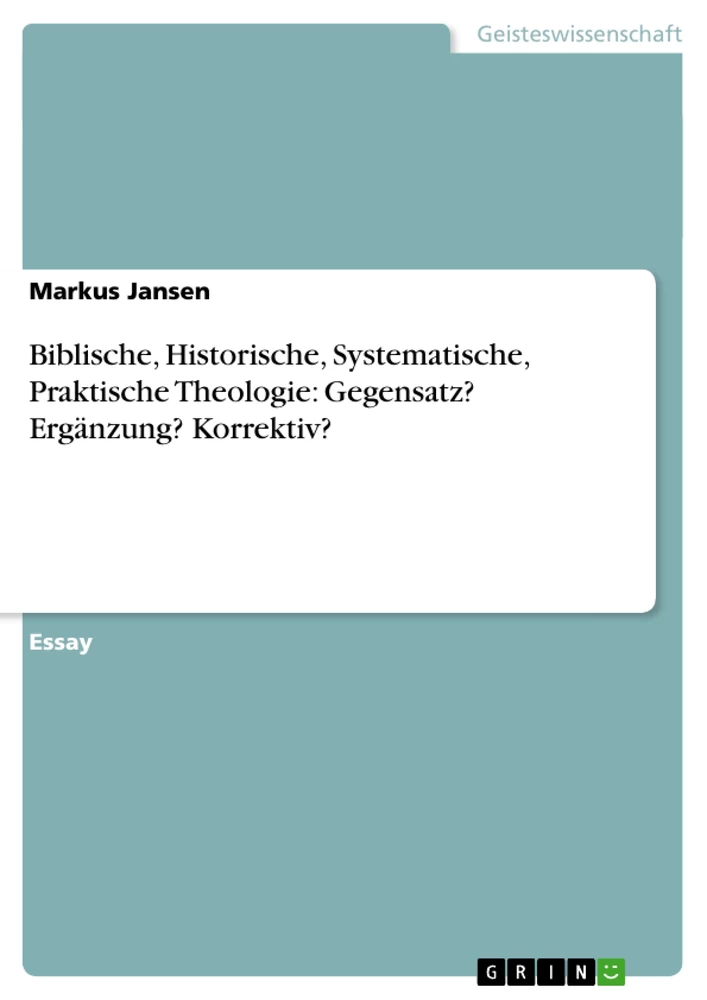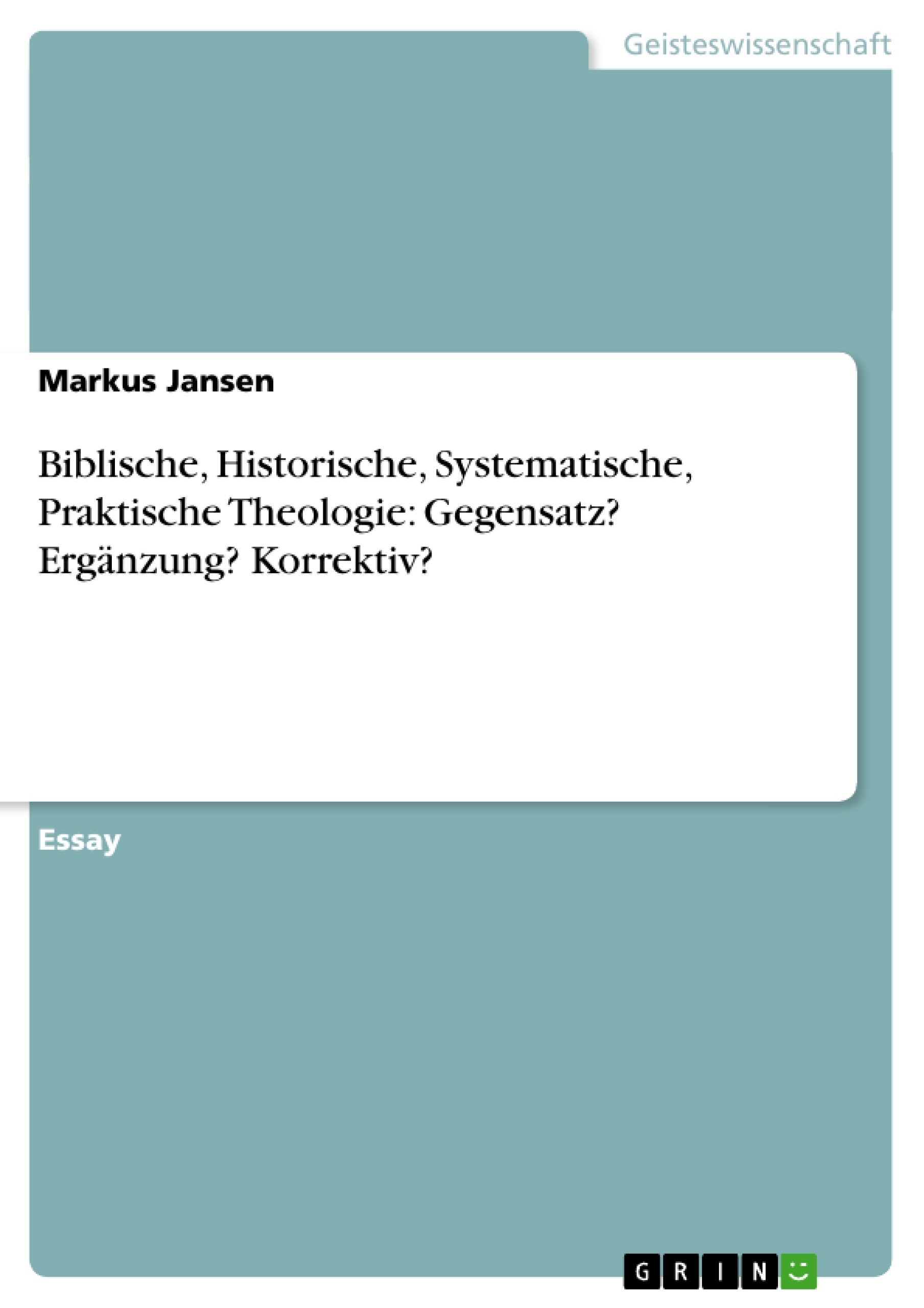Bis ins 12./13. Jahrhundert ist die Theologie noch relativ undifferenziert, zugleich Schriftauslegung, Glaubensverständnis und Einweisung in die gläubige und kirchliche Praxis. Auf dem Hintergrund früh- und hochmittelalterlicher Differenzierungsbewegungen mit ihrer Problematisierung der Traditionsautorität treten im 12. und noch stärker im 13. Jahrhundert biblische und systematische Theologie auseinander.
So beschreibt Wiedenhofer die Anfänge der heutigen Teildisziplinen der Theologie. Gab es bis zum zwölften Jahrhundert vielfach Universaltheologen, die sich mit allen Bereichen der Theologie auseinandergesetzt und zugleich praktiziert haben – Thomas von Aquin wäre hier als herausragendes Beispiel zu nennen – so sind seit dem Beginn des zwölften Jahrhunderts die einzelnen Teildisziplinen der Theologie immer stärker auseinandergerückt. Wiedenhofer führt weiter aus, dass sich die Spannung zwischen den historisch-theologischen Disziplinen und den systematisch-theologisch Disziplinen durch die neuzeitliche Ausbildung der historisch-kritischen Forschung noch verstärken wird, sodass die Fragestellung der Einheit in der Theologie eines der größten theologischen Probleme darstellt. Ist es aber nicht möglich, dass die Trennung der einzelnen Disziplinen Vorteile zu bieten hat, dass die Theologie ihren Platz im Orchester der Wissenschaft dadurch festigen kann? Schließlich sind die einzelnen Stimmen in einem Orchester ebenfalls mehrfach besetzt, ein einzelner Geiger kann nicht das benötigte Volumen aufbringen, um den wundervollen Melodien einer Beethovensymphonie gerecht zu werden. Er benötigt die Unterstützung weiterer Musiker, die mit ihm auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, auch wenn sie das Stück selber vielleicht ein klein wenig anders interpretieren.
Bis ins 12./ 13. Jahrhundert ist sie (sc. die Theologie) noch relativ undifferenziert, zugleich Schriftauslegung, Glaubensverständnis und Einweisung in die gläubige und kirchliche Praxis. Auf dem Hintergrund früh- und hochmittelalterlicher Diffe- renzierungsbewegungen mit ihrer Problematisierung der Traditionsautorität treten im 12. und noch stärker im 13. Jahrhundert biblische und systematische Theologie auseinander [. . . ]1
So beschreibt Wiedenhofer die Anfänge der heutigen Teildisziplinen der Theologie. Gab es bis zum zwölften Jahrhundert vielfach Universaltheologen, die sich mit allen Bereichen der Theologie auseinandergesetzt und zugleich praktiziert haben - Thomas von Aquin wäre hier als herausragendes Beispiel zu nennen - so sind seit dem Beginn des zwölften Jahrhunderts die einzelnen Teildisziplinen der Theologie immer stärker auseinandergerückt. Wiedenhofer führt weiter aus, dass sich die Spannung zwischen den historisch-theologischen Disziplinen und den systematisch-theologisch Disziplinen durch die neuzeitliche Ausbildung der historisch- kritischen Forschung noch verstärken wird, sodass die Fragestellung der Einheit in der Theo- logie eines der größten theologischen Probleme darstellt. Ist es aber nicht möglich, dass die Trennung der einzelnen Disziplinen Vorteile zu bieten hat, dass die Theologie ihren Platz im Orchester der Wissenschaft dadurch festigen kann? Schließlich sind die einzelnen Stimmen in einem Orchester ebenfalls mehrfach besetzt, ein einzelner Geiger kann nicht das benötigte Volumen aufbringen, um den wundervollen Melodien einer Beethovensymphonie gerecht zu werden. Er benötigt die Unterstützung weiterer Musiker, die mit ihm auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, auch wenn sie das Stück selber vielleicht ein klein wenig anders interpretieren.
Auch andere Wissenschaftler waren früher auf vielen verschiedenen Feldern vertreten. So war etwa Pythagoras nicht nur ein Mathematiker, er war Philosoph und Politiker und beschäftigte sich auch mit der Astronomie und der Musiklehre. Leonardo da Vinci schuf bedeutende Meis- terwerke der Kunst, beschäftigte sich mit der Medizin und Anatomie des Menschen, betätigte sich als Ingenieur und Architekt und war neben der Philosophie noch auf einigen weiteren Ge- bieten tätig. Auch Gottfried Wilhelm Leibniz, welcher als einer der letzten Universalgelehrten angesehen wird, betätigte sich auf den verschiedensten Gebieten. Neben seinen umfassen- den Beiträgen zur Mathematik und Physik, beschäftigte sich Leibniz mit philosophischen und theologischen Fragestellungen. Heutzutage gibt es kaum noch solche Universalgenies, die in nahezu sämtlichen wissenschaftlichen Disziplinen großartige Leistungen vollbrachten. Statt- dessen orientiert man sich zielgerichtet und konzentriert sich auf einen wissenschaftlichen
Zweig. Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung könnte die stetig wachsende Menge an Wissen sein. Dadurch ist eine immer größere Menge an Vorwissen nötig, welches man er- langt haben muss, um neue Forschungen anstellen zu können. Dadurch werden der Aufwand für neue Entwicklungen und der Bedarf an Spezialisten in den einzelnen Teilgebieten immer größer. Desweiteren entwickeln sich immer mehr neue Zweige der Wissenschaft; beispiels- weise hat sich aus den anfänglichen Heilkünsten der Ärzte in der Antike ein breit fassendes Spektrum an den unterschiedlichsten medizinischen Disziplinen gebildet. Für jede einzelne Disziplin werden eigens ausgebildete Spezialisten benötigt, einen allwissenden Arzt für jede Gelegenheit und Krankheit gibt es nicht mehr. Mit der Renaissance wurde ein immer stärke- rer Fokus auf die Naturwissenschaften gelegt, die Vorgänge in der Welt sollten mit rationalen Argumenten erklärt und begründet werden. Als Reinform der Naturwissenschaften kann die Mathematik angesehen werden, sie verlässt sich nicht auf Experimente und Beobachtungen, vielmehr schafft sie sich ein rationales Universum der Logik, welches nicht durch zufällige Umwelteinflüsse gestört werden kann. Diese bemüht sich in ihren Aussagen um Exaktheit und Absolutheit, eine mathematisch korrekt bewiesene Aussage gilt immer und überall. Al- lerdings ist auch die Mathematik aufgeteilt in verschiedene Teilgebiete, dabei sind Analysis und Algebra die wohl bekanntesten Teilgebiete. Heutzutage gibt es kaum noch Mathematiker, die auf mehreren oder gar jedem Gebiet der Mathematik aktiv arbeiten oder auch nur weit rei- chende Kenntnisse haben, vielmehr spezialisieren sie sich auf ein Feld, welches sie dann zum Teil mit ihren ganz eigenen Methoden bearbeiten. Dabei bedienen sie sich aber des Öfteren an Vorgehensweisen und vor allem Ergebnissen anderer Teilgebiete. Es gibt sowohl einen analyti- schen als auch einen algebraischen Zugang zum Feld der Zahlentheorie und sowohl Methoden der Analysis als auch der Algebra werden in der Physik verwendet. Trotz ihrer Abstraktheit hat die Mathematik also Einfluss auf unser alltägliches Leben; sind ihre Anwendungen doch so vielfältig in der Physik, der Medizin und Informatik zu finden, ganz zu schweigen von ihrer Bedeutung für die Wirtschaft. Ohne eine Unterteilung in Teilgebiete und tiefgehende Forschung auf jedem dieser Teilgebiete, wären viele Ergebnisse und Anwendungen aber nicht ermöglicht worden. Allerdings gibt es auch in der Mathematik einige Problemstellungen, bei denen sich Differenzen unter Mathematikern verschiedener Teilgebiete ergeben (die Existenz beziehungsweise die Gültigkeit des Auswahlaxioms wäre ein hier zu nennendes Beispiel). Somit ist man sich selbst in der reinsten aller Naturwissenschaften uneinig und hat Diskussi- onsbedarf, was diverse Grundzüge der Mathematik angeht.
[...]
1 Wiedenhofer (2000)
- Quote paper
- Markus Jansen (Author), 2012, Biblische, Historische, Systematische, Praktische Theologie. Gegensatz? Ergänzung? Korrektiv?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264550