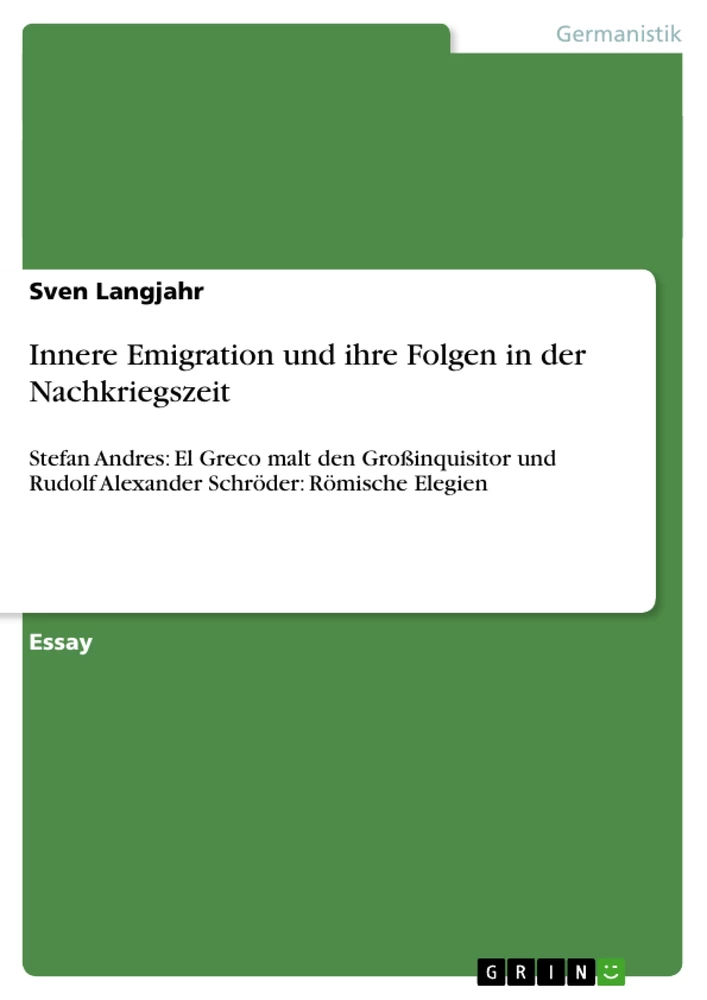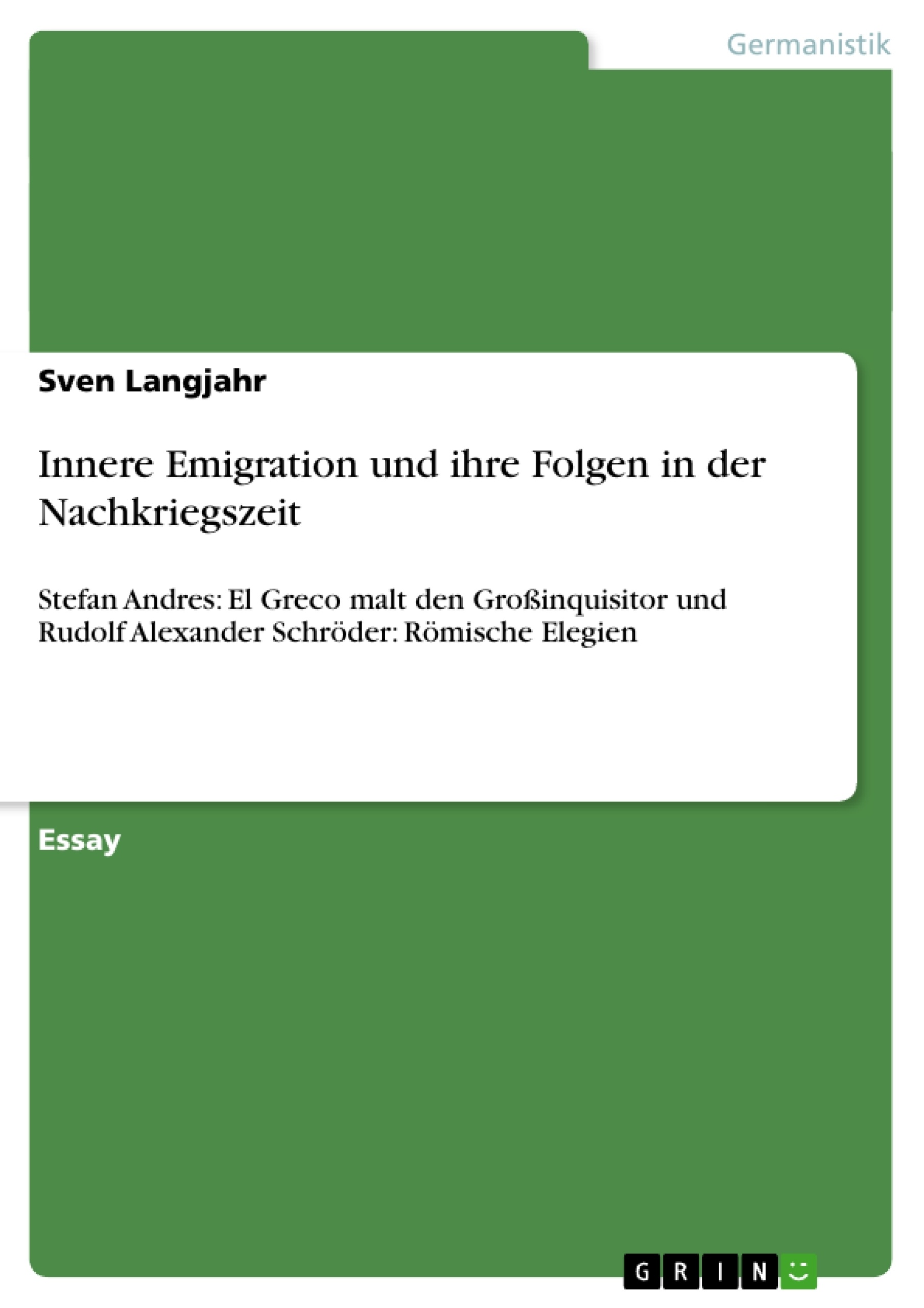Ein Essay zur Vorlesung
Deutschsprachige Literatur nach 1945
Thema: Innere Emigration und ihre Folgen
Mit dem Thema "Innere Emigration" gehen wir noch einmal ein Schritt zurück, raus aus dem Feld der Gegenwartsliteratur, der Literatur nach 1945.
Epochen gliedern sich nach epochalen Einschnitten; man geht also davon aus, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Zäsur/ein Einschnitt gegeben hat der die Literatur die davor produziert wurde, von der die danach produziert wurde abgrenzt. Das Jahr 1945 ist ein solcher epochaler Einschnitt, in dem Sinne als dass die nationalsozialistischen Autoren (deren Namen wir Heute übrigens kaum noch kennen) größtenteils von der Bildfläche verschwunden sind. Es bildeten sich neue literarische Zirkel (etwa die Gruppe 47). Mit Blick auf das Neue wurde das Jahr 1945 auch als Stunde Null bezeichnet. Dass die Stunde Null aber keine wirkliche Stunde Null war, sondern dass es neben den NS-Schriftstellern noch andere Autoren gab, die ihr Ansehen weniger eingebüßt hatten, und die nach 1945 auf dem literarischen Markt eben auch noch eine Rolle spielten, wird in der heutigen Sitzung gezeigt.
Teil 1: Die "Große Kontroverse"
Auf das Vorhandensein dieser Gruppe, die wir heute "Innere Emigranten" nennen (später wird auf die Problematik des Begriffes eingegangen), hat ein öffentlicher Briefwechsel zwischen hauptsächlich zwei Vertretern dieser "Inneren Emigration" und Thomas Mann aufmerksam gemacht. Die Briefe die in verschiedenen Zeitungen ab Sommer 1945 abgedruckt werden und sich bis ins Jahr 1946 ziehen, wurden vom Herausgeber der Sammlung, Johannes Grosser, als "Große Kontroverse" bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1: Die "Große Kontroverse"
- Teil 2: Was heißt nun "Innere Emigration"?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die „Innere Emigration“ in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Er analysiert den öffentlichen Briefwechsel zwischen Vertretern der Inneren Emigration und Thomas Mann, bekannt als die „Große Kontroverse“, um die Definition und Bedeutung dieses Phänomens zu ergründen.
- Die „Große Kontroverse“ und ihre Bedeutung für das Verständnis der Inneren Emigration
- Definition und Abgrenzung der Inneren Emigration im Kontext der NS-Zeit
- Die unterschiedlichen Positionen von Exilanten und Inneren Emigranten
- Die Rolle der Zensur und der Möglichkeiten zur literarischen Produktion im NS-Regime
- Die Herausforderungen der Forschung bei der Einordnung von Schriftstellern als Innere Emigranten
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 1: Die "Große Kontroverse": Dieser Teil analysiert den öffentlichen Briefwechsel zwischen Walter von Molo, Frank Thieß und Thomas Mann, der als „Große Kontroverse“ bekannt wurde. Molos Brief an Mann fordert dessen Rückkehr ins Nachkriegsdeutschland zur moralischen Heilung der Nation. Thieß verteidigt in einem nachfolgenden Artikel die Haltung der Inneren Emigranten, die sich selbst als immanente Kritiker des Nationalsozialismus, aber gleichzeitig von den Exilanten abgrenzen. Er betont die Bewahrung der Persönlichkeit im Angesicht des Regimes als eine Form des Widerstands. Thomas Manns Antwort betont den erzwungenen Charakter seines Exils und kritisiert scharf die in Deutschland unter dem NS-Regime produzierte Literatur als verdorben. Der Briefwechsel zeigt die grundlegend unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen von Exilanten und den in Deutschland verbliebenen Schriftstellern und verschärft die Kontroverse um die Definition und Bedeutung der Inneren Emigration.
Teil 2: Was heißt nun "Innere Emigration"?: Dieser Teil beleuchtet die Forschungsgeschichte zum Thema „Innere Emigration“ und die Schwierigkeiten bei der Definition und Einordnung von Schriftstellern. Die Forschung hat gezeigt, dass die Begriffe „Innere Emigration“ und „das andere Deutschland“ bereits in den 1930er Jahren verwendet wurden. Nach dem Krieg zerbricht die anfängliche Einheit von Inneren und Äußeren Emigranten aufgrund gegensätzlicher Erfahrungen. Die Einordnung von Autoren wird erschwert, da die Abgrenzung zu bloßen Opportunisten schwierig ist und Verhaltensanalysen im Kontext eines totalitären Systems oft keine eindeutigen Ergebnisse liefern. Die neuere Forschung konzentriert sich deshalb verstärkt auf die Analyse der Texte selbst, um die Haltung der Autoren zum NS-Regime zu bestimmen, da eine Schwarz-Weiß-Malerei des Verhaltens im NS-Regime nicht angebracht ist.
Schlüsselwörter
Innere Emigration, Exil, Thomas Mann, Walter von Molo, Frank Thieß, „Große Kontroverse“, Nationalsozialismus, Widerstandsliteratur, Zensur, Literaturpolitik im Dritten Reich, Gleichschaltung, Oppositionshaltung, Heimatbegriff.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Essay: Innere Emigration nach 1945
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht das Phänomen der „Inneren Emigration“ in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Im Mittelpunkt steht die Analyse des öffentlichen Briefwechsels zwischen Vertretern der Inneren Emigration und Thomas Mann, bekannt als die „Große Kontroverse“, um die Definition und Bedeutung dieses Phänomens zu ergründen.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt die „Große Kontroverse“ und ihre Bedeutung für das Verständnis der Inneren Emigration. Er beleuchtet die Definition und Abgrenzung der Inneren Emigration im Kontext der NS-Zeit, die unterschiedlichen Positionen von Exilanten und Inneren Emigranten, die Rolle der Zensur und der Möglichkeiten zur literarischen Produktion im NS-Regime, sowie die Herausforderungen der Forschung bei der Einordnung von Schriftstellern als Innere Emigranten.
Was ist die „Große Kontroverse“?
Die „Große Kontroverse“ bezeichnet den öffentlichen Briefwechsel zwischen Walter von Molo, Frank Thieß und Thomas Mann. Molo fordert Manns Rückkehr nach Deutschland zur moralischen Heilung der Nation. Thieß verteidigt die Inneren Emigranten als immanente Kritiker des Nationalsozialismus, die sich von den Exilanten abgrenzen. Mann kritisiert die in Deutschland unter dem NS-Regime produzierte Literatur scharf und betont den erzwungenen Charakter seines Exils. Dieser Briefwechsel verdeutlicht die gegensätzlichen Perspektiven von Exilanten und in Deutschland verbliebenen Schriftstellern.
Wie wird die „Innere Emigration“ definiert?
Der Essay beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition der „Inneren Emigration“. Die Forschung zeigt, dass die Begriffe bereits in den 1930er Jahren verwendet wurden. Nach dem Krieg zerbrach die anfängliche Einheit von Inneren und Äußeren Emigranten aufgrund gegensätzlicher Erfahrungen. Die Einordnung von Autoren ist schwierig, da die Abgrenzung zu Opportunisten schwer fällt und Verhaltensanalysen im Kontext eines totalitären Systems oft keine eindeutigen Ergebnisse liefern. Neuere Forschung konzentriert sich deshalb auf die Analyse der Texte selbst.
Welche Schlüsselpersonen werden im Essay behandelt?
Zentrale Figuren sind Thomas Mann, Walter von Molo und Frank Thieß, deren Briefwechsel die „Große Kontroverse“ bildet. Der Essay analysiert deren unterschiedliche Positionen und Perspektiven zur Inneren Emigration.
Welche Herausforderungen stellt die Forschung zur Inneren Emigration dar?
Die Einordnung von Schriftstellern als Innere Emigranten ist herausfordernd. Die Abgrenzung zu bloßen Opportunisten ist schwierig, und Verhaltensanalysen im Kontext des NS-Regimes liefern oft keine eindeutigen Ergebnisse. Die neuere Forschung vermeidet eine Schwarz-Weiß-Malerei und konzentriert sich auf die Analyse der Texte selbst, um die Haltung der Autoren zum NS-Regime zu bestimmen.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay besteht aus zwei Teilen: Teil 1 analysiert die „Große Kontroverse“, während Teil 2 die Definition und die Schwierigkeiten der Forschung zur Inneren Emigration beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Essay?
Schlüsselwörter sind: Innere Emigration, Exil, Thomas Mann, Walter von Molo, Frank Thieß, „Große Kontroverse“, Nationalsozialismus, Widerstandsliteratur, Zensur, Literaturpolitik im Dritten Reich, Gleichschaltung, Oppositionshaltung, Heimatbegriff.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Sven Langjahr (Autor), 2012, Innere Emigration und ihre Folgen in der Nachkriegszeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264499