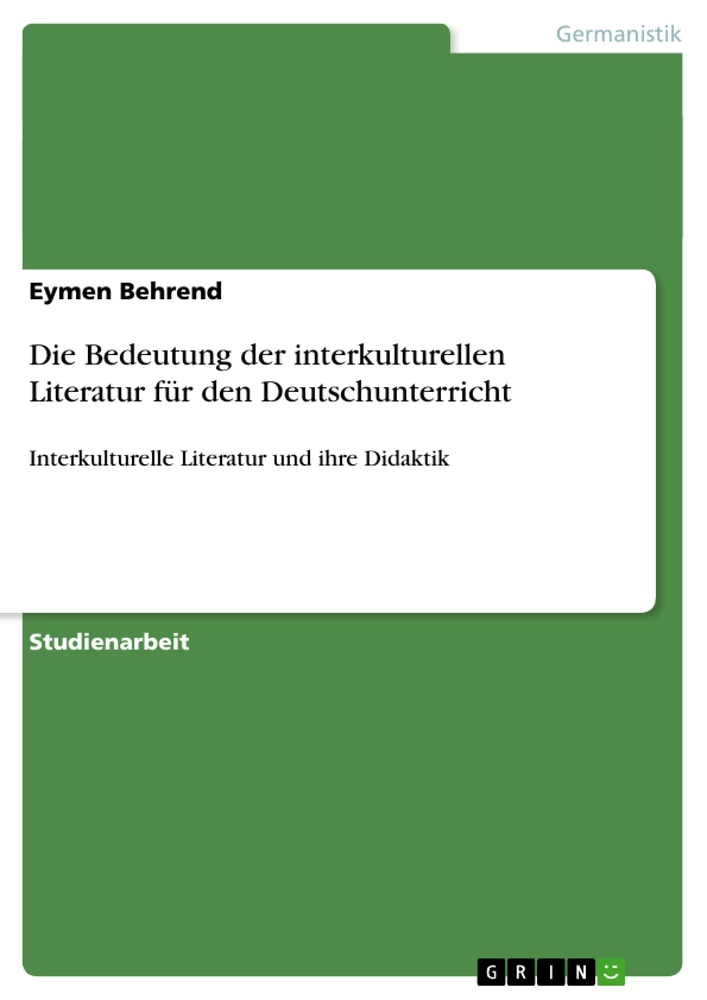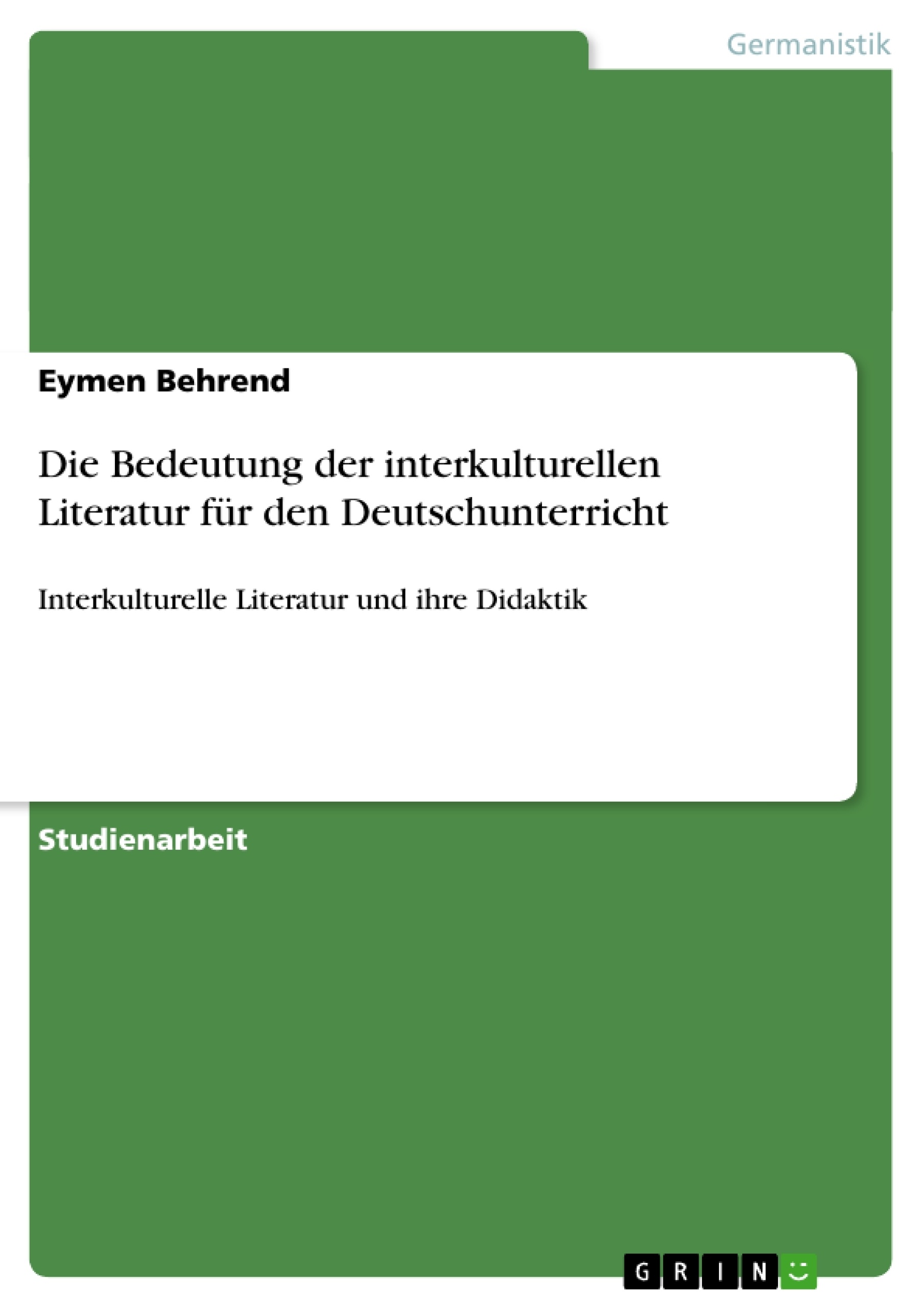In unserer heutigen Zeit begegnen wir immer häufiger dem Begriff der Interkulturalität. Von interkultureller Handlungskompetenz, interkulturellem Management oder interkultureller Rhetorik ist die Rede. Bereits der inflationäre Gebrauch dieses Begriffs zeigt, wie wichtig die Interkulturalität in unserer heutigen Gesellschaft geworden ist. Auch in der Literaturwissenschaft rückt der Umstand der Interkulturalität immer stärker ins Zentrum, besonders in Bezug auf Deutsch als Zweitsprache bzw. Deutsch als Fremdsprache. Im gängigen Deutschunterricht hingegen wird der Aspekt der Interkulturalität nur selten umgesetzt, obwohl „doch niemand mehr bezweifle, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei.“ Doch gerade in Klassen mit einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund wäre ein verstärkter Fokus auf den interkulturellen Aspekt der Literatur wünschenswert. Aus Sicht der Toleranzentwicklung wäre dies ein wichtiger Schritt, da sowohl deutsche als auch Schüler mit Migrationshintergrund durch Vergleiche in der Literatur in ihrer Empathie gefördert würden. Um mit Esselborns Worten zu sprechen:
„[D]ie Migranten- und Minderheitenliteratur [könnte] einen wichtigen Beitrag zu Austausch und Verständigung zwischen Mehrheits- und Minderheitenkultur bzw. zur Erkenntnis ihrer Interdependenz und Vermischung und damit zu Selbstverständnis und kultureller Orientierung der Immigranten leisten.“
Ziel dieser Arbeit ist es deswegen, den zusätzlichen Nutzen der interkulturellen Literaturdidaktik gegenüber herkömmlicher Literatur herauszuarbeiten. Ausgehend von einer Definition der interkulturellen Literatur wird auf die Stereotype in und den Perspektivenwechsel durch diese Art der Literatur eingegangen. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit praktischen Möglichkeiten zur Umsetzung im Unterricht, die sich vornehmlich auf die Arbeiten Skinners stützen. Eine weitere Unterteilung in Unterrichtsformate für reguläre Deutschklassen und DaF-Klassen findet bewusst nicht statt, da die interkulturelle Literatur in einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft für beide Bereiche ähnliche Vorteile bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Allgegenwärtige Interkulturalität - auch im Deutschunterricht?
- Interkulturelle Literatur - Versuch einer Definition
- Stereotype in der Literatur und ihre Potentiale für den Unterricht
- Förderung von Empathie durch interkulturelle literarische Texte
- Praktische Anregungen zur Umsetzung eines Literaturunterrichts am Beispiel der Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht”
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den zusätzlichen Nutzen interkultureller Literaturdidaktik im Deutschunterricht. Sie definiert interkulturelle Literatur, analysiert Stereotype und Perspektivwechsel in solchen Texten und präsentiert praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht. Der Fokus liegt auf den Vorteilen für sowohl reguläre Deutschklassen als auch DaF-Klassen in einer multikulturellen Gesellschaft.
- Definition und Abgrenzung interkultureller Literatur
- Analyse von Stereotypen und deren didaktisches Potential
- Förderung von Empathie durch interkulturelle Literatur
- Praktische Unterrichtsmethoden und -materialien
- Der Beitrag interkultureller Literatur zur Toleranzentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Allgegenwärtige Interkulturalität – auch im Deutschunterricht?: Der Text beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Interkulturalität in der heutigen Gesellschaft und deren bisherige geringe Umsetzung im Deutschunterricht, insbesondere in Klassen mit Schülern mit Migrationshintergrund. Er betont den wichtigen Beitrag interkultureller Literatur zur Toleranzentwicklung und Förderung von Empathie bei Schülern mit und ohne Migrationshintergrund, unter Bezugnahme auf Esselborn's Argumentation über den Beitrag von Migranten- und Minderheitenliteratur zum Austausch und Verständnis zwischen Kulturen. Die Arbeit argumentiert für eine verstärkte Berücksichtigung interkultureller Literatur im Unterricht, um den zusätzlichen Nutzen gegenüber herkömmlicher Literatur aufzuzeigen.
Interkulturelle Literatur - Versuch einer Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, interkulturelle Literatur präzise zu definieren. Es beschreibt die historische Entwicklung vom Konzept der monolingualen Nationalliteratur hin zu einer interkulturell orientierten deutschsprachigen Literatur, beeinflusst durch Gastarbeiterliteratur und Globalisierung. Der Text diskutiert die Unklarheiten des Begriffs "interkulturell" im Kontext von Literatur und die verschiedenen Kriterien, die zur Definition herangezogen werden könnten (Autorenschaft, Protagonist, Thematik, Sprache). Letztendlich wird eine vereinfachte Definition vorgeschlagen, die interkulturelle Literatur als Literatur beschreibt, die im Einflussbereich verschiedener Kulturen entstanden ist und auf diese bezogen ist, während die anhaltende Debatte um eine exakte Eingrenzung anerkannt wird.
Stereotype in der Literatur und ihre Potentiale für den Unterricht: Dieses Kapitel definiert Stereotype als vereinfachte, schematisierte Vorstellungen von Gruppen und erklärt ihre Entstehung als kognitive Strategie der Komplexitätsreduktion. Es wird der Unterschied zwischen Stereotypen und Schemata erläutert, wobei der Fokus auf der kognitiven und sozialen Orientierungsfunktion von Schemata liegt. Der Text betont die enge Verknüpfung von Selbst- und Fremdbildern von Nationen und wie Einzelbeobachtungen oft selektiv zur Bestätigung von Stereotypen verwendet werden, während abweichende Beobachtungen ignoriert werden. Das Kapitel legt den Grundstein für die Diskussion, wie Stereotype in der Literatur didaktisch genutzt werden können, um kritisches Denken und Empathie zu fördern.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Literatur, Deutschunterricht, Didaktik, Stereotype, Empathie, Migrationshintergrund, Toleranzentwicklung, Mehrsprachigkeit, Globalisierung, kulturelle Identität.
Häufig gestellte Fragen zu: Interkulturelle Literatur im Deutschunterricht
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Nutzen interkultureller Literaturdidaktik im Deutschunterricht. Sie definiert interkulturelle Literatur, analysiert Stereotype und Perspektivwechsel in solchen Texten und zeigt praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht auf. Der Fokus liegt auf den Vorteilen für reguläre Deutschklassen und DaF-Klassen in einer multikulturellen Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu: Allgegenwärtiger Interkulturalität im Deutschunterricht; Definition interkultureller Literatur; Stereotype in der Literatur und deren didaktisches Potential; Förderung von Empathie durch interkulturelle Literatur; praktische Umsetzung am Beispiel von „Tausendundeiner Nacht“; und ein Resümee.
Wie wird interkulturelle Literatur definiert?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten, interkulturelle Literatur präzise zu definieren. Sie beschreibt die historische Entwicklung und die verschiedenen Kriterien (Autorenschaft, Protagonist, Thematik, Sprache), die zur Definition herangezogen werden können. Letztendlich wird eine vereinfachte Definition vorgeschlagen: Literatur, die im Einflussbereich verschiedener Kulturen entstanden ist und auf diese bezogen ist. Die anhaltende Debatte um eine exakte Eingrenzung wird anerkannt.
Welche Rolle spielen Stereotype in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Stereotype als vereinfachte Vorstellungen von Gruppen und deren Entstehung. Sie erläutert den Unterschied zwischen Stereotypen und Schemata und betont die enge Verknüpfung von Selbst- und Fremdbildern von Nationen. Es wird gezeigt, wie Stereotype in der Literatur didaktisch genutzt werden können, um kritisches Denken und Empathie zu fördern.
Wie können interkulturelle Texte im Unterricht eingesetzt werden?
Die Arbeit präsentiert praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht, insbesondere die Förderung von Empathie und Toleranzentwicklung bei Schülern mit und ohne Migrationshintergrund. Es werden konkrete Methoden und Materialien vorgestellt, unter anderem am Beispiel von Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht“.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte den zusätzlichen Nutzen interkultureller Literaturdidaktik im Deutschunterricht aufzeigen. Sie will den Beitrag interkultureller Literatur zur Toleranzentwicklung und zur Förderung von Empathie bei Schülern mit und ohne Migrationshintergrund verdeutlichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Die Arbeit ist relevant für Deutschlehrer, DaF-Lehrer und alle, die sich mit interkultureller Bildung und Literaturdidaktik beschäftigen. Sie bietet praktische Anregungen für den Unterricht in multikulturellen Kontexten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Literatur, Deutschunterricht, Didaktik, Stereotype, Empathie, Migrationshintergrund, Toleranzentwicklung, Mehrsprachigkeit, Globalisierung, kulturelle Identität.
- Quote paper
- Eymen Behrend (Author), 2011, Die Bedeutung der interkulturellen Literatur für den Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264149