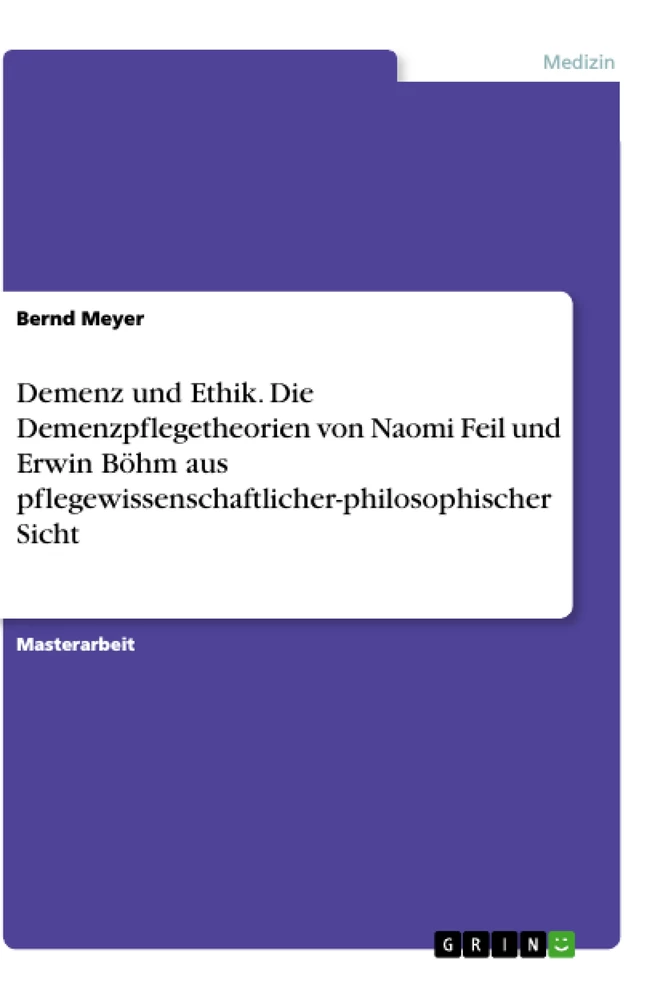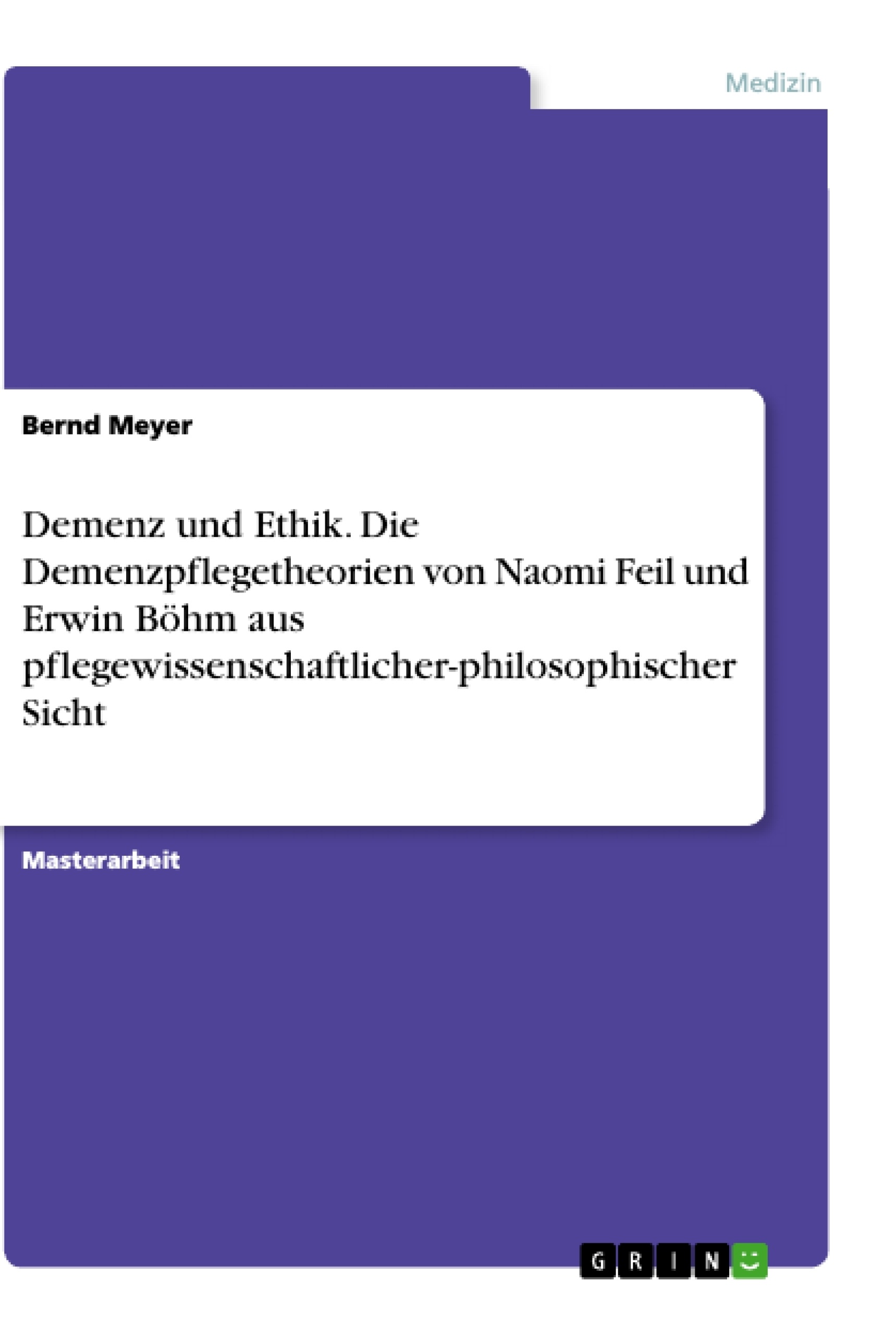In der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen in Bezug auf die Begleitung von Menschen mit Demenz wird ersichtlich, dass unterschiedliche Betrachtungsweisen nicht nur möglich, sondern auch notwendig sind (vgl. Meyer; 2008). So einmalig jeder Mensch ist, so individuell muss die Beziehungsgestaltung gelebt werden. Die Begleitung von Menschen mit Demenz gleicht dabei, auch aus einer ethischen Perspektive, einer Gradwanderung, bei der die unterschiedlichsten Anforderungen, die an die Begleitenden gestellt werden, manchmal den Blick auf die Person, die begleitet wird, verstellen.
Menschen mit fortgeschrittener Demenz leben im Augenblick, ihr Dasein und ihr Erleben findet im „Jetzt“ statt (vgl. Wojnar, 2001/2), wenn dieses auch häufig Jahrzehnte zurückliegt. Das Erleben der Situation scheint in enger Verbindung zu stehen mit emotionalen Erinnerungen, die im Sinne eines Déjà–vu-Erlebnisses (ebd.) präsent und handlungsleitend werden. Gleichzeitig, so Wojnar (ebd.), entfernen sie sich aus unserer Kultur, gehen zurück in kulturgeschichtlich frühere Zeiten der menschlichen Entwicklung. Die Befriedigung des Bedürfnisses „zu Hause oder bei sich zu sein“ (Wojnar, 2006: 81) schafft „Vertrautheit“ (Bosch, 1998: 123) und bildet die Grundlage für Lebensqualität.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Ausgangslage
- 2 Grundlagen der Konzeptualisierung
- 2.1 Entwicklung und Begründung eines Untersuchungsinstrumentes
- 3 Konzeptauswahl und Begründung
- 4 Validation nach Feil
- 4.1 Ursprung und theoretischer Hintergrund
- 4.2 Zentrale Aussagen
- 4.3 Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit
- 4.3.1 Quellenkritik
- 4.3.2 Inhaltliche Kritik
- 4.4 Philosophische Ausrichtung und ethische Positionen
- 4.5 Anforderungsprofil
- 4.6 Zusammenfassung
- 5 Das psychobiographische Pflegemodell nach Böhm
- 5.1 Ursprung und theoretischer Hintergrund
- 5.2 Zentrale Aussagen
- 5.2.1 Zusammenfassung der zentralen Aussagen
- 5.2.2 Kritik
- 5.3 Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit
- 5.4 Philosophische Ausrichtung und ethische Positionen
- 5.5 Anforderungsprofil
- 5.6 Zusammenfassung
- 6 Diskussion und Vergleich
- 6.1 Theoretische Haltbarkeit
- 6.2 Praktische Brauchbarkeit
- 7 Zusammenfassung
- 8 Ausblick
- 8.1 Persönliche Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die pflegewissenschaftlichen und philosophischen Grundlagen der Demenzpflegetheorien von Naomi Feil und Erwin Böhm. Ziel ist es, die Konzepte zu evaluieren und ihre praktische Anwendbarkeit zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der ethischen Dimension der Demenzpflege und der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen.
- Ethische Aspekte der Demenzpflege
- Vergleichende Analyse der Pflegemodelle von Feil und Böhm
- Menschenbild und Verständnis von Gesundheit und Krankheit in der Demenzpflege
- Theoretische und praktische Brauchbarkeit der Konzepte
- Individuelle Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Ausgangslage: Das Kapitel beleuchtet die ethischen Herausforderungen in der Begleitung von Menschen mit Demenz. Es wird die Notwendigkeit individueller Beziehungsgestaltungen betont und die Schwierigkeit, die Anforderungen an die Begleitenden mit dem Fokus auf die Person mit Demenz in Einklang zu bringen. Der Fokus liegt auf der situativen Handlungsweise und der Herausforderung, die Grenzen zwischen Paternalismus, Fürsorge, Autonomie und Verantwortung zu definieren. Das Kapitel führt ein in die Thematik der individuellen Bedürfnisse und der Bedeutung des "im Augenblick leben" für Menschen mit fortgeschrittener Demenz.
4 Validation nach Feil: Dieses Kapitel beschreibt den Ursprung und den theoretischen Hintergrund des Validationsansatzes von Naomi Feil. Es werden die zentralen Aussagen des Modells zusammengefasst, sowie das Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit im Kontext der Validation erläutert. Der Abschnitt beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit Quellen und Inhalten des Ansatzes. Abschließend wird die philosophische Ausrichtung, die ethischen Positionen, sowie das Anforderungsprofil für Pflegende dargelegt.
5 Das psychobiographische Pflegemodell nach Böhm: Das Kapitel präsentiert das psychobiographische Pflegemodell von Erwin Böhm. Es beschreibt den Ursprung, die zentralen Aussagen, das Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Modell sowie die philosophische Ausrichtung und ethische Positionen werden detailliert dargelegt. Das Kapitel schließt mit der Beschreibung des Anforderungsprofils für Pflegende und einer Zusammenfassung des Modells.
6 Diskussion und Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die beiden vorgestellten Pflegemodelle von Feil und Böhm. Es analysiert sowohl die theoretische Haltbarkeit als auch die praktische Brauchbarkeit der Ansätze. Dieser Vergleich beinhaltet eine umfassende Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen beider Modelle im Hinblick auf die ethischen und praktischen Herausforderungen der Demenzpflege.
Schlüsselwörter
Demenz, Ethik, Pflegewissenschaft, Pflegemodelle, Naomi Feil, Validation, Erwin Böhm, Psychobiographisches Pflegemodell, Menschenbild, Gesundheit, Krankheit, Altenhilfe, ethische Dilemmata, individuelle Bedürfnisse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Vergleich der Pflegemodelle von Feil und Böhm
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die pflegewissenschaftlichen und philosophischen Grundlagen der Demenzpflegetheorien von Naomi Feil (Validation) und Erwin Böhm (psychobiographisches Pflegemodell). Sie evaluiert die Konzepte und beleuchtet deren praktische Anwendbarkeit, mit besonderem Fokus auf die ethische Dimension der Demenzpflege und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt ethische Aspekte der Demenzpflege, eine vergleichende Analyse der Pflegemodelle von Feil und Böhm, das Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit in der Demenzpflege, die theoretische und praktische Brauchbarkeit der Konzepte und die individuellen Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst folgende Kapitel: Vorwort, Ausgangslage, Grundlagen der Konzeptualisierung (inkl. Entwicklung eines Untersuchungsinstrumentes), Konzeptauswahl und Begründung, Validation nach Feil (inkl. Ursprung, theoretischem Hintergrund, zentralen Aussagen, Kritik, Menschenbild, ethischer Position und Anforderungsprofil), Das psychobiographische Pflegemodell nach Böhm (inkl. Ursprung, zentralen Aussagen, Kritik, Menschenbild, ethischer Position und Anforderungsprofil), Diskussion und Vergleich (inkl. theoretischer und praktischer Brauchbarkeit), Zusammenfassung und Ausblick (inkl. persönlicher Anmerkungen).
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Evaluierung der Pflegemodelle von Feil und Böhm und die Beleuchtung ihrer praktischen Anwendbarkeit in der Demenzpflege. Der Fokus liegt auf der ethischen Dimension und der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen.
Wie werden die Pflegemodelle von Feil und Böhm verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Modelle anhand ihrer theoretischen Haltbarkeit und ihrer praktischen Brauchbarkeit. Es werden Stärken und Schwächen beider Modelle im Hinblick auf die ethischen und praktischen Herausforderungen der Demenzpflege umfassend diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Demenz, Ethik, Pflegewissenschaft, Pflegemodelle, Naomi Feil, Validation, Erwin Böhm, Psychobiographisches Pflegemodell, Menschenbild, Gesundheit, Krankheit, Altenhilfe, ethische Dilemmata, individuelle Bedürfnisse.
Was wird in Kapitel 1 ("Ausgangslage") behandelt?
Kapitel 1 beleuchtet die ethischen Herausforderungen in der Begleitung von Menschen mit Demenz, betont die Notwendigkeit individueller Beziehungsgestaltungen und die Schwierigkeit, die Anforderungen an die Begleitenden mit dem Fokus auf die Person mit Demenz in Einklang zu bringen. Es thematisiert situative Handlungsweisen und die Abgrenzung zwischen Paternalismus, Fürsorge, Autonomie und Verantwortung sowie die Bedeutung des "im Augenblick leben" für Menschen mit fortgeschrittener Demenz.
Was wird in Kapitel 4 ("Validation nach Feil") behandelt?
Kapitel 4 beschreibt den Ursprung und den theoretischen Hintergrund der Validation nach Feil, fasst die zentralen Aussagen zusammen und erläutert das Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Es beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit Quellen und Inhalten, die philosophische Ausrichtung, die ethischen Positionen und das Anforderungsprofil für Pflegende.
Was wird in Kapitel 5 ("Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm") behandelt?
Kapitel 5 präsentiert das psychobiographische Pflegemodell von Erwin Böhm, beschreibt Ursprung, zentrale Aussagen, Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Es beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung, die philosophische Ausrichtung, ethische Positionen, das Anforderungsprofil für Pflegende und eine Zusammenfassung des Modells.
Was wird in Kapitel 6 ("Diskussion und Vergleich") behandelt?
Kapitel 6 vergleicht die Modelle von Feil und Böhm hinsichtlich ihrer theoretischen Haltbarkeit und praktischen Brauchbarkeit und analysiert Stärken und Schwächen im Hinblick auf die ethischen und praktischen Herausforderungen der Demenzpflege.
- Quote paper
- Dipl. Pflegewirt, M.A. Bernd Meyer (Author), 2013, Demenz und Ethik. Die Demenzpflegetheorien von Naomi Feil und Erwin Böhm aus pflegewissenschaftlicher-philosophischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264057