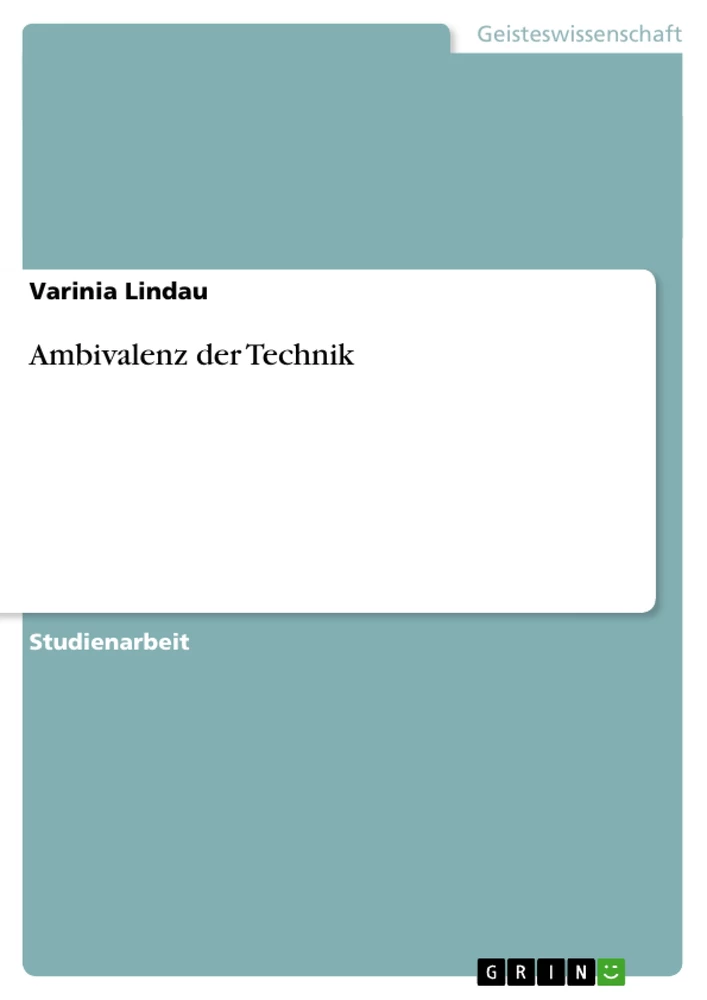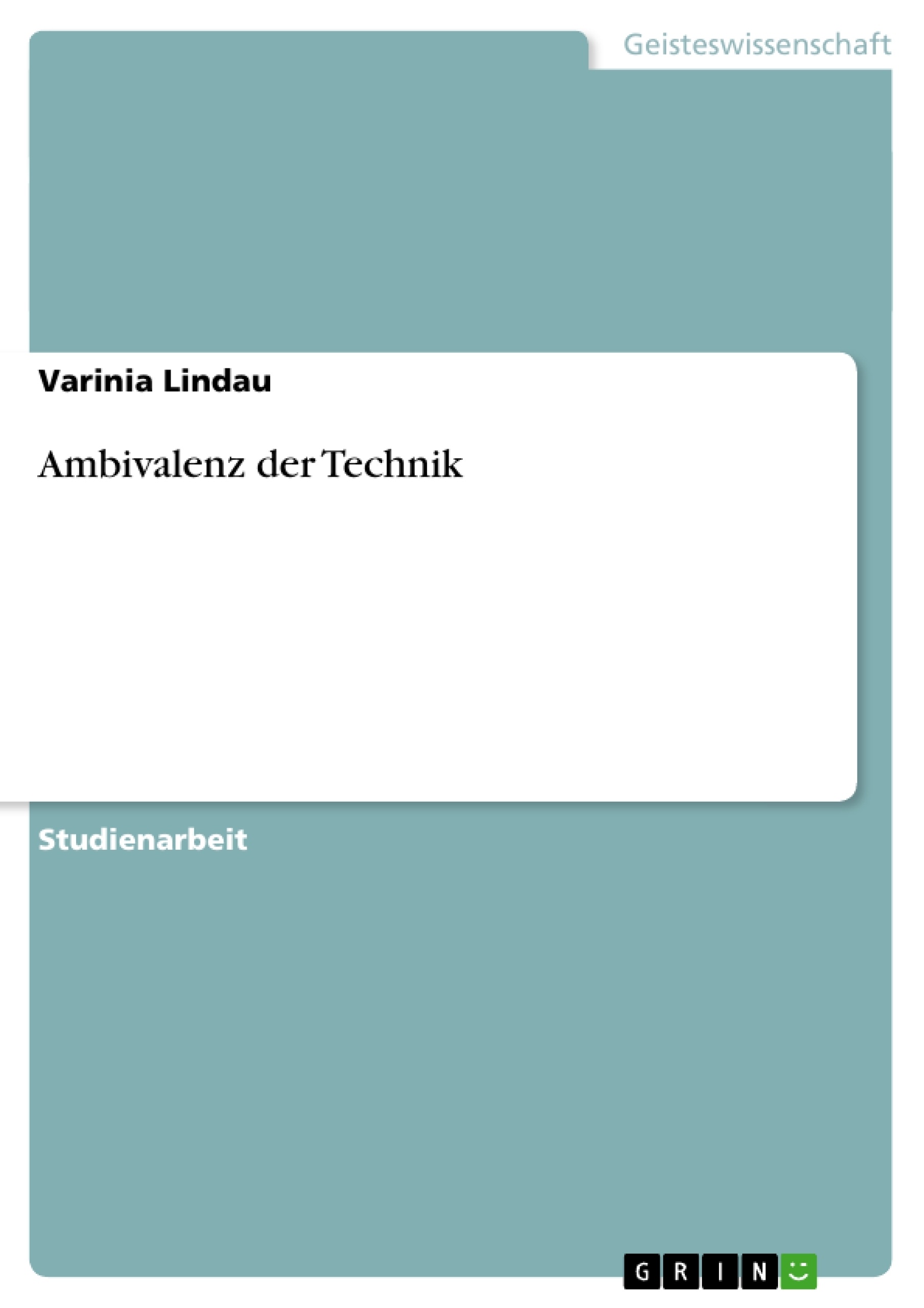„Technik im Alltag ist immer nur in einer Gemengelage greifbar. Das heißt nicht nur, daß Technisches mit ganz anders orientierten Denkformen vereinbar ist; es heißt auch, daß die Einstellungen bei verschiedenen Personen verschieden sind, daß in verschiedenen Funktionen verschiedene Attitüden zur Geltung kommen und daß diese Attitüden grundsätzlich psychisch mehrdeutig, multivalent sein können.“ (vgl.Bausinger 1981)
Ebenso vielfältig wie die Erscheinungsformen und Einsatzmöglichkeiten von Technik sind ihre sozialstrukturellen und individuellen Nutzungs-2 und Bewertungsweisen.3 Über klassenspezifische Bewertungsmuster hinaus bewerten gar einzelne Personen technische Innovationen ambivalent und betrachten sie zugleich euphorisch wie auch pessimistisch.4 So überlagern sich unterschiedliche Emotionen wie Freude, Bewunderung, Verunsicherung oder Ablehnung gegenüber technischen Innovationen.5 Im Folgenden werden die Reaktionen auf den Zeitschriftenartikel „Brauchen wir Roboterschutz-Gesetze?“6 untersucht.7 Die divergierenden Kommentare befördern diverse Einstellungen zum Thema Mensch/Maschine zutage. Da gibt es zum Einen jene, welche eher ein negatives Bild von einer gefühllosen und im schlimmsten Fall auch destruktiven Technik haben und zum anderen jene, welche die technischen Artefakte gar als „treue Diener“ behandeln, als gleichwertige soziale Akteure konstruieren oder ihre Anerkennung als Ausdruck des gesellschaftlichen Fortschritts betrachten. Zunächst werden hierfür theoretische Vorüberlegungen zur „Ambivalenz der Technik“ dargelegt. In aller Kürze wird dann das Thema des Zeitschriftenartikels grob skizziert, um im Hauptteil die Kommentare und Reaktionen diesbezüglich zu analysieren. Zum Schluss werden die gewonnenen Erkenntnisse kurz zusammengefasst und ein möglicher Ausblick auf weitere kulturwissenschaftliche Anknüpfungsmöglichkeiten gegeben.
2. Theoretische Vorüberlegungen zur „Ambivalenz der Technik“
Mit Technik – als Holonym für diverse unterschiedliche Gegenstände – kann nach Hermann Bausinger weniger von „der“ Technik als vielmehr von differenten Techniken gesprochen werden. Die Ambivalenz von Techniken und ihrer Bewertung kam schon in der industriellen Revolution um das 19.Jh. gesellschaftlich zum Ausdruck, in welcher die Maschine doppeldeutiger Träger von ambivalenten (Herrschafts-) Zuschreibungen war. Neben den abweisenden Haltungen und sozial-konservativen „Abschirmungen“ gegenüber einer als Bedrohung wahrgenommenen Technik
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Vorüberlegungen zur „Ambivalenz der Technik“
3. Zeitungsartikel „Brauchen wir Roboterschutz-Gesetze?“
5. Keine Schutz-Gesetze für „Blechkisten“
6. Roboter als (Mit-) Glieder eines sozialen Wertesystems
7. Ausblick
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Technik im Alltag ist immer nur in einer Gemengelage greifbar. Das heißt nicht nur,daß Technisches mit ganz anders orientierten Denkformen vereinbar ist; es heißt auch,daß die Einstellungen bei verschiedenen Personen verschieden sind, daß inverschiedenen Funktionen verschiedene Attitüden zur Geltung kommen und daß dieseAttitüden grundsätzlich psychisch mehrdeutig, multivalent sein können.“1
Ebenso vielfältig wie die Erscheinungsformen und Einsatzmöglichkeiten von Techniksind ihre sozialstrukturellen und individuellen Nutzungs-2 und Bewertungsweisen.3 Über klassenspezifische Bewertungsmuster hinaus bewerten gar einzelne Personentechnische Innovationen ambivalent und betrachten sie zugleich euphorisch wie auchpessimistisch.4 So überlagern sich unterschiedliche Emotionen wie Freude,Bewunderung, Verunsicherung oder Ablehnung gegenüber technischen Innovationen.5 Im Folgenden werden die Reaktionen auf den Zeitschriftenartikel „Brauchen wirRoboterschutz-Gesetze?“6 untersucht.7 Die divergierenden Kommentare beförderndiverse Einstellungen zum Thema Mensch/Maschine zutage. Da gibt es zum Einen jene,welche eher ein negatives Bild von einer gefühllosen und im schlimmsten Fall auchdestruktiven Technik haben und zum anderen jene, welche die technischen Artefakte garals „treue Diener“ behandeln, als gleichwertige soziale Akteure konstruieren oder ihreAnerkennung als Ausdruck des gesellschaftlichen Fortschritts betrachten. Zunächstwerden hierfür theoretische Vorüberlegungen zur „Ambivalenz der Technik“ dargelegt.In aller Kürze wird dann das Thema des Zeitschriftenartikels grob skizziert, um imHauptteil die Kommentare und Reaktionen diesbezüglich zu analysieren. Zum Schlusswerden die gewonnenen Erkenntnisse kurz zusammengefasst und ein möglicherAusblick auf weitere kulturwissenschaftliche Anknüpfungsmöglichkeiten gegeben.
2. Theoretische Vorüberlegungen zur „Ambivalenz der Technik“
Mit Technik - als Holonym für diverse unterschiedliche Gegenstände - kann nachHermann Bausinger weniger von „der“ Technik als vielmehr von differenten Technikengesprochen werden.8 Die Ambivalenz von Techniken und ihrer Bewertung kam schon inder industriellen Revolution um das 19.Jh. gesellschaftlich zum Ausdruck, in welcherdie Maschine doppeldeutiger Träger von ambivalenten (Herrschafts-) Zuschreibungenwar.9 Neben den abweisenden Haltungen und sozial-konservativen „Abschirmungen“gegenüber einer als Bedrohung wahrgenommenen Technik existierten zudemfortschrittsgläubige Idealisierungen, welche die Verbesserungen sozialer Verhältnissedurch technische Errungenschaften betonten.10
Im Laufe der Zeit wurden die technischen Konstrukte durch routinierte Arbeitsabläufesukzessive in die Sphäre des Selbstverständlichen und Natürlichen gehoben.11 Heutewerden sie als solche im Alltag häufig nicht mehr bewusst wahrgenommen oder erstdann bemerkt, wenn sie nicht zweckgemäß funktionieren.12 Ebenso selbstverständlichwie die technischen Produkte ist ihre einprogrammierte Kurzlebigkeit geworden;Technikprodukte sind Wegwurfprodukte, universell degradiert „zur Adhoc-Ware“.13
Doch werden sie von vielen Menschen in der Bevölkerung nicht bloß einseitig alsumweltgefährdend oder ethisch bedenklich, sondern ebenso als Grundlage desgesellschaftlichen Fortschritts betrachtet. Techniken werden zunehmend differenziert als komplexe Strukturen mit widersprüchlichen Zwecksetzungen - bewertet, wie sichbeispielsweise am Konflikt der Wirtschaftskraftsteigerung und dem Ziel derUmweltverträglichkeit zeigen lässt.14 Nach Renn impliziert Technik-Ambivalenz vorallem zwei Faktoren: „zum einen das Erlebnis von Komplexität, zum anderen dieschmerzhafte Erfahrung der Notwendigkeit von Zielkonflikten. Komplexität undZielkonflikte werden auch in der Bevölkerung als schmerzliche Begleiterscheinungender erlebten Ambivalenz wahrgenommen.“15
Renn gliedert die Einstellungen zu Techniken in drei Bereiche ein: die Produkt- und Alltagstechnik, die Arbeitstechnik und die Externe Technik.16 Privat gewinnt die Produkt- und Alltagstechnik zunehmend an materiellem Wert. Die externe Technik - wie Müllverbrennungsanlagen oder Chemiewerke - muss sich dagegen zunehmend „an den postmateriellen Werten der Umweltverträglichkeit und der Einbindung in sozial geschätzte Entwicklungen“ messen lassen.17 Gegen große Industriekomplexe werden demnach heftige Kritiken laut, während sich nur wenige Stimmen gegen die „individuelle Techniknutzung“18 auflehnen.
3. Zeitungsartikel „Brauchen wir Roboterschutz-Gesetze?“
Der Titel des Artikels „Brauchen wir Roboterschutz-Gesetze?“19 bezieht sich auf eineStudie, nach welcher Menschen emotional reagieren und Mitleid empfinden, wennRoboter 'schlecht' behandelt werden. Der Studie zufolge können Menschen es nichtertragen, wenn einem anderen Wesen Schaden zugefügt wird. Sie betrachten undempfinden demnach die Schmerzen von sich selbst ausgehend und projizieren diese auf'misshandelte' Roboter. Zum Ende des Artikels wird vorgeschlagen RoboterschutzGesetze einzuführen, damit jegliche Wesen „die mit uns sozial interagieren“, einenrespektvollen Umgang erfahren. Es geht dabei jedoch nicht um den Schutz der Roboterper se, sondern vielmehr um die Aufrechterhaltung allgemeiner „Werte unsererGesellschaft“, bzw. darum, wie die Menschen mit den 'Wesen' in ihrer Gesellschaftumgehen.20
[...]
1 Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S.227- 242, hier S.228.
2 Vgl. Reinhard Eisendle, Elfie Miklautz: Technisierung des Alltages. In: dies. u.a. (Hg.): Maschinen im Alltag. Studien zur Technkintegration als soziolkulturellem Prozeß. München 1993, S.7-26, hier S.9.
3 Bausinger, wie Anm.1.
4 Vgl. Reinhard Eisendle: Bedeutungsdimensionen von Alltagstechnik und Beurteilungsmuster deren Entwicklung. In: ders. u.a. (Hg.): Maschinen im Alltag. Studien zur Technkintegration als soziolkulturellem Prozeß. München 1993, S.157- 220, hier S.157.
5 Vgl. Thomas Hengartner: Zur „Kultürlichkeit“ von Technik. Ansätze kulturwissenschaftlicher Technik-forschung. In: Schweizerische Akademie der Geistes und Sozialwissenschaften (Hg.): Technikforschung: zwischen Reflexion und Dokumentation. Bern 2004, S.39-57, hier S.49.
6 Johannes Wendt: Brauchen wir Roboterschutz-Gesetze? In: Die Zeit Online (13. Mai 2013). http://www.zeit.de/ digital/ internet/2013-05/roboter-ethik-kate-darling [Stand 29.08.2013].
7 Die Reaktionen sind als Kommentare unter dem ZEIT-Artikel im Internet zu finden. Sie wurden als Zitate übernommen und Rechtschreibfehler wurden der Lesbarkeit halber geglättet.
8 Vgl. Bausinger, wie Anm. 1, S.228.
9 So galt die Maschine einerseits als Instrument zur Ausbeutung der Arbeitnehmerschaft und wurde andererseits selbst als von den Arbeitern beherrscht betrachtet. Vgl. Ebd., S.235ff..
10 Vgl. Ebd.
11 Vgl. Ebd., S.231
12 Vgl. Hengartner, wie Anm. 5, S.47.
13 Vgl. Bausinger, wie Anm. 1, S.240.
14 Ortwin Renn: Technikakzeptanz: Lehren und Rückschlüsse der Akzeptanzforschung für die Bewältigung des technischen Wandels. In: Technikfolgenabschätzung - Theorie und Praxis, 3/14 (2005), S.29-39.
15 Ebd., S.33.
16 Renn, wie Anm. 14, S.31f.
17 Renn führt als materialistische Werte unter anderem Faktoren wie Einkommen, Lebensqualität und Steigerung der Wirtschaftskraft auf, als postmaterialistische Werte dahingegen jene wie Familienharmonie oder Umweltverträglichkeit. Vgl. Ebd., S.32..
18 Ebd.
19 Wendt, wie Anm.6.
20 Vgl. Ebd.
- Arbeit zitieren
- Varinia Lindau (Autor:in), 2013, Ambivalenz der Technik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263989