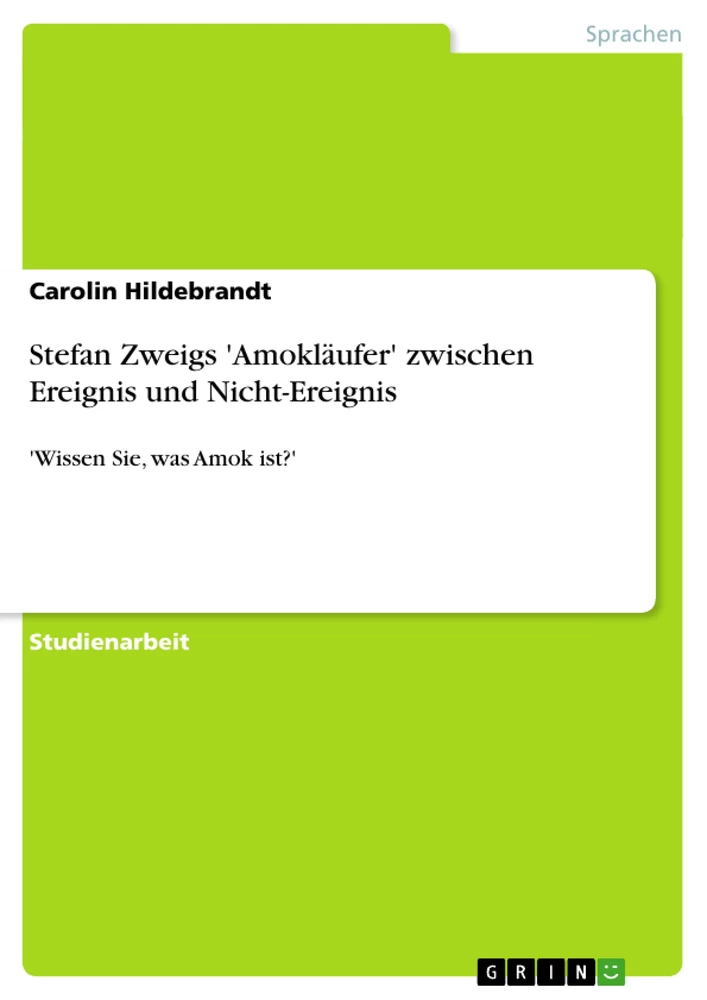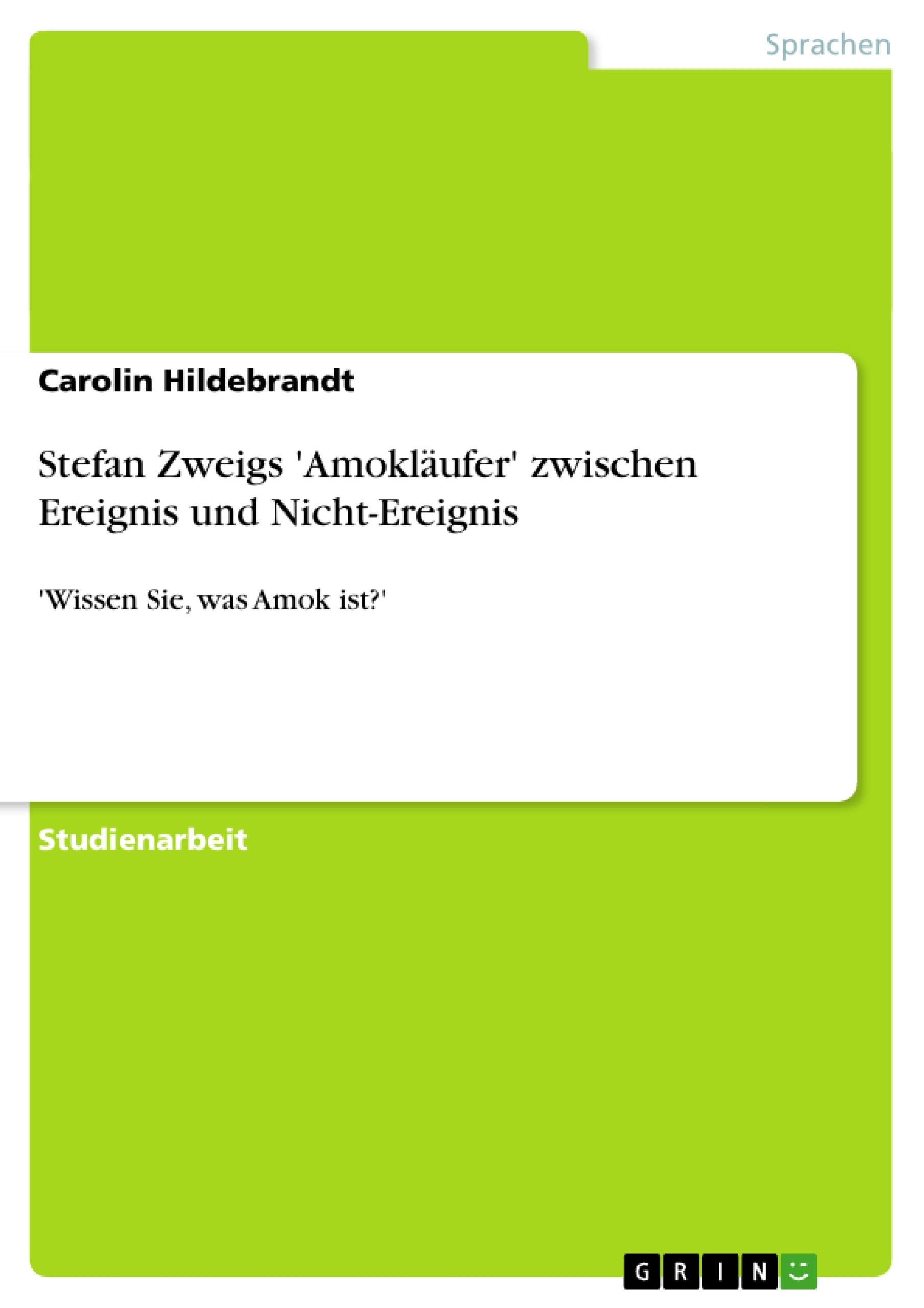Amok ist Ambivalenz:
Vergangenheit[Seite 2] und Modernität[Seite 5f.]
Krankheit[Seite 4] und Gesundung[Seite 6]
das Fremde[Seite 4] und das Eigenste[Seite 7]
passive Beobachtung[Seite 10f.] und totale Aktion[Seite 7]
Unmöglichkeit[Seite 5] und absolute Präsenz[Seite 12]
Ereignis[Seite 20] und Nachahmungsstruktur[Seite 18]
Ursache wie Symptom[Seite 17]
Wie soll ich meine Gedanken, meinen Schreibakt strukturieren, steht doch das Ereignis, der Gegner der Struktur im Fokus meines gegenwärtigen Schaffens? So sehr ich es auch versuche, alles scheint sich der Ordnung zu widersetzen; immer wieder treten neue Aspekte auf den Plan, die ihr Recht einfordern und sich ereignen wollen. Ich muss versuchen mit dem Ursprung zu beginnen…
Die Provenienz des Amok gestaltet sich (oder wird gestaltet?) ebenso uneindeutig wie der Verlauf seiner Weiterentwicklung, was in der Tatsache begründet liegen mag, dass unterschiedlichste Aktionen unter jenem Begriff zusammengefasst und transformiert wurden, deren äußere Erscheinungsbilder zwar ähnlich anmuten , deren Ursachen und - im wörtlichsten aller Sinne - Beweggründe aber in gänzlich divergierende Richtungen strömen. Schon im 16. und 17. Jahrhundert gab es Berichte europäischer (!) Reisender über ungewöhnliche, gewalttätige Verhaltensausbrüche unter den Eingeborenen Malaysias und Indiens, teilweise mit militärischem Hintergrund, teilweise eingebettet in einen religiösen Kontext oder aber besetzt mit einer gewissen gesellschaftlichen Problematik des jeweiligen Amokläufers. Stefan Zweig hält sich vordergründig mit den entworfenen Bildern in seiner Novelle an jenen idealtypischen Amokläufer, der im Zuge des Kolonialismus (wie vieles andere auch) „seiner kulturellen Bedeutung beraubt“ wurde und seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zum Inbegriff des primitiven, wilden Anderen stereotypisiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Vergangenheit und Modernität
- Krankheit und Gesundung
- Das Fremde und das Eigenste
- Passive Beobachtung und totale Aktion
- Unmöglichkeit und absolute Präsenz
- Ereignis und Nachahmungsstruktur
- Ursache wie Symptom
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Amok in Stefan Zweigs Novelle und deren Kontextualisierung innerhalb kolonialer und postkolonialer Diskurse. Ziel ist es, die Ambivalenz des Begriffs Amok aufzuzeigen und die Verschiebung seiner Bedeutung von einem kulturell spezifischen Phänomen hin zu einem Krankheitsbild zu analysieren.
- Die Ambivalenz des Amok-Begriffs
- Die koloniale und postkoloniale Konstruktion des "Amokläufers"
- Die Verschiebung des Amok von kulturellem Unterschied zu Krankheit
- Die Rolle von Wissen und Nicht-Wissen im Kontext von Amok
- Die Darstellung von Amok in Stefan Zweigs Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Vergangenheit und Modernität: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Amok-Begriffs und seine unterschiedlichen Interpretationen im Laufe der Zeit. Es beleuchtet, wie verschiedene Handlungen unter dem Begriff Amok zusammengefasst wurden, obwohl ihre Ursachen und Beweggründe stark divergieren. Die Ambivalenz des Begriffs wird hervorgehoben, indem die verschiedenen Perspektiven auf Amok, von den Berichten europäischer Reisender bis hin zu Zweigs Darstellung, analysiert werden. Die Diskussion über die koloniale Konstruktion des "Amokläufers" als primitives, wildes Gegenbild des zivilisierten Europäers legt den Grundstein für die weiteren Kapitel.
Krankheit und Gesundung: Dieses Kapitel fokussiert auf die Abgrenzung des Amok von einer bloß kulturellen Besonderheit hin zu einem Krankheitsbild. Es diskutiert, wie die westliche Gesellschaft den Amok als individuelle Krankheit oder seelischen Kurzschluss interpretiert und wie diese Interpretation die Identität des westlichen Individuums schützt. Der Prozess, in dem das Phänomen vom Fremden zum Inneren verschoben wird, wird im Detail untersucht. Das Kapitel analysiert, wie die Unfähigkeit, das Amok zu verstehen, zur Konstruktion eines Krankheitsbildes beiträgt.
Das Fremde und das Eigenste: Hier wird die Thematik der kolonialen Fremdwahrnehmung und der Konstruktion des "Anderen" im Kontext des Amok untersucht. Es wird analysiert, wie die westliche Kultur die eigenen Ängste und Sehnsüchte auf das exotische Subjekt projiziert und wie der Amok als Ausdruck des "Mangels" und der "Unvollständigkeit" des Anderen interpretiert wird. Die These, dass im Bild des Fremden die Wünsche und Ängste der eigenen Kultur kulminieren, wird anhand von Zweigs Novelle beleuchtet und die Ambivalenz dieser Begegnung zwischen dem "eigenen" und dem "fremden" Körper analysiert.
Passive Beobachtung und totale Aktion: Dieser Abschnitt analysiert die Dynamik zwischen passiver Beobachtung und plötzlicher, gewalttätiger Aktion im Kontext des Amok. Es wird untersucht, wie die passive Beobachtung des "Fremden" und dessen scheinbarer Fremdheit in eine gewalttätige Aktion umschlagen kann. Der Kontrast zwischen der scheinbaren Ereignislosigkeit und dem plötzlichen Ausbruch von Gewalt steht im Mittelpunkt der Analyse und wird in Bezug zur Wahrnehmung und Darstellung von Amok in Zweigs Novelle gesetzt.
Unmöglichkeit und absolute Präsenz: Das Kapitel beleuchtet den Widerspruch zwischen der Unmöglichkeit, Amok vorherzusagen oder zu verstehen, und seiner dennoch absoluten Präsenz. Der plötzliche Ausbruch der Gewalt wird als ein Ereignis betrachtet, das außerhalb der Ordnung des Wissens liegt und die Grenzen der menschlichen Vorhersehbarkeit und Kontrolle überschreitet. Die Unfassbarkeit des Amok wird im Kontext der philosophischen Konzepte von Ereignis und Struktur diskutiert und mit der Darstellung in Zweigs Novelle verglichen.
Ereignis und Nachahmungsstruktur: Diese Sektion erforscht den Amok als Ereignis, das sich der Ordnung und Struktur widersetzt und die Grenzen zwischen kulturellen und individuellen Phänomenen verschwimmen lässt. Die Analyse betrachtet die Problematik, ein Ereignis wie den Amok innerhalb einer strukturierten, wissenschaftlichen Betrachtung zu erfassen und zu erklären. Der Fokus liegt auf dem Konflikt zwischen dem einzigartigen, individuellen Ereignis und dem Versuch, es in bestehende Kategorien und Strukturen einzuordnen.
Ursache wie Symptom: Dieses Kapitel untersucht die vielschichtigen Ursachen und Symptome von Amok, indem es die verschiedenen Perspektiven auf die Entstehung des Verhaltens vereint. Es analysiert, wie sowohl kulturelle als auch individuelle Faktoren zur Erklärung herangezogen werden können und wie die Bedeutung von Amok sich im Laufe der Zeit verändert hat. Die komplexe Wechselwirkung von Ursache und Wirkung wird im Kontext der Darstellung in Zweigs Novelle beleuchtet.
Schlüsselwörter
Amok, Stefan Zweig, Kolonialismus, Postkolonialismus, Fremdwahrnehmung, Identität, Krankheit, Ereignis, Struktur, Ambivalenz, Gewalt, Kultur, Wissen, Nicht-Wissen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Amok-Darstellung in Stefan Zweigs Novelle
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Amok in einer Novelle von Stefan Zweig und setzt diese in den Kontext kolonialer und postkolonialer Diskurse. Sie untersucht die Ambivalenz des Begriffs "Amok" und die Verschiebung seiner Bedeutung von einem kulturell spezifischen Phänomen zu einem Krankheitsbild.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Ambivalenz des Amok-Begriffs, die koloniale und postkoloniale Konstruktion des "Amokläufers", die Verschiebung von kulturellem Unterschied zu Krankheit, die Rolle von Wissen und Nicht-Wissen im Kontext von Amok, sowie die spezifische Darstellung von Amok in Stefan Zweigs Novelle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Vergangenheit und Modernität (historische Entwicklung des Amok-Begriffs und unterschiedliche Interpretationen); Krankheit und Gesundung (Abgrenzung von kultureller Besonderheit zu Krankheitsbild); Das Fremde und das Eigenste (koloniale Fremdwahrnehmung und Konstruktion des "Anderen"); Passive Beobachtung und totale Aktion (Dynamik zwischen passiver Beobachtung und gewalttätiger Aktion); Unmöglichkeit und absolute Präsenz (Widerspruch zwischen Unvorhersehbarkeit und Präsenz von Amok); Ereignis und Nachahmungsstruktur (Amok als Ereignis, das sich der Ordnung widersetzt); Ursache wie Symptom (vielschichtige Ursachen und Symptome von Amok).
Wie wird die Ambivalenz des Amok-Begriffs analysiert?
Die Ambivalenz wird durch die Analyse verschiedener Perspektiven auf Amok untersucht, von Berichten europäischer Reisender bis hin zu Zweigs Darstellung. Es wird gezeigt, wie verschiedene Handlungen unter dem Begriff Amok zusammengefasst wurden, obwohl ihre Ursachen und Beweggründe stark divergieren. Die koloniale Konstruktion des "Amokläufers" als primitives Gegenbild des zivilisierten Europäers spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielt der Kolonialismus und Postkolonialismus?
Kolonialismus und Postkolonialismus sind zentrale analytische Kategorien. Die Arbeit untersucht, wie die westliche Kultur ihre eigenen Ängste und Sehnsüchte auf das exotische Subjekt projiziert und wie der Amok als Ausdruck des "Mangels" und der "Unvollständigkeit" des Anderen interpretiert wird. Die Konstruktion des "Amokläufers" als "Anderer" wird kritisch beleuchtet.
Wie wird die Verschiebung des Amok von kulturellem Unterschied zu Krankheit dargestellt?
Die Arbeit analysiert den Prozess, in dem das Phänomen Amok vom Fremden zum Inneren verschoben wird. Es wird untersucht, wie die westliche Gesellschaft den Amok als individuelle Krankheit oder seelischen Kurzschluss interpretiert und wie diese Interpretation die Identität des westlichen Individuums schützt. Die Unfähigkeit, Amok zu verstehen, trägt zur Konstruktion eines Krankheitsbildes bei.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Amok, Stefan Zweig, Kolonialismus, Postkolonialismus, Fremdwahrnehmung, Identität, Krankheit, Ereignis, Struktur, Ambivalenz, Gewalt, Kultur, Wissen, Nicht-Wissen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit den Themen Kolonialismus, Postkolonialismus, Literaturwissenschaft und der Analyse von Gewalt auseinandersetzt. Sie eignet sich insbesondere für die Auseinandersetzung mit der Darstellung von kulturellen Phänomenen in der Literatur.
- Quote paper
- Carolin Hildebrandt (Author), 2013, Stefan Zweigs 'Amokläufer' zwischen Ereignis und Nicht-Ereignis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263941