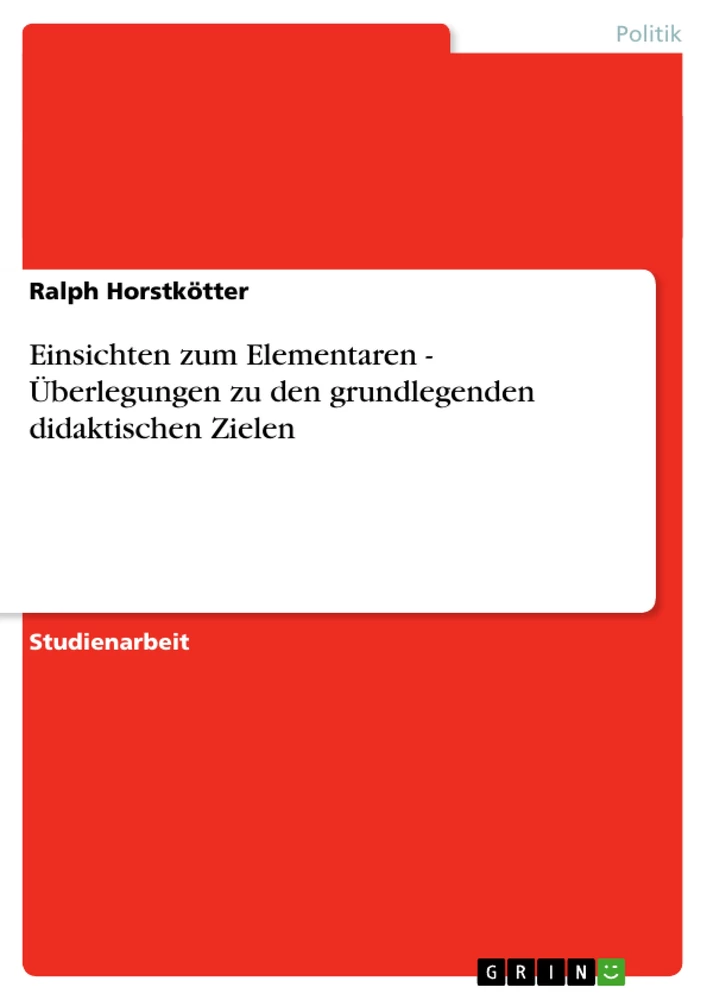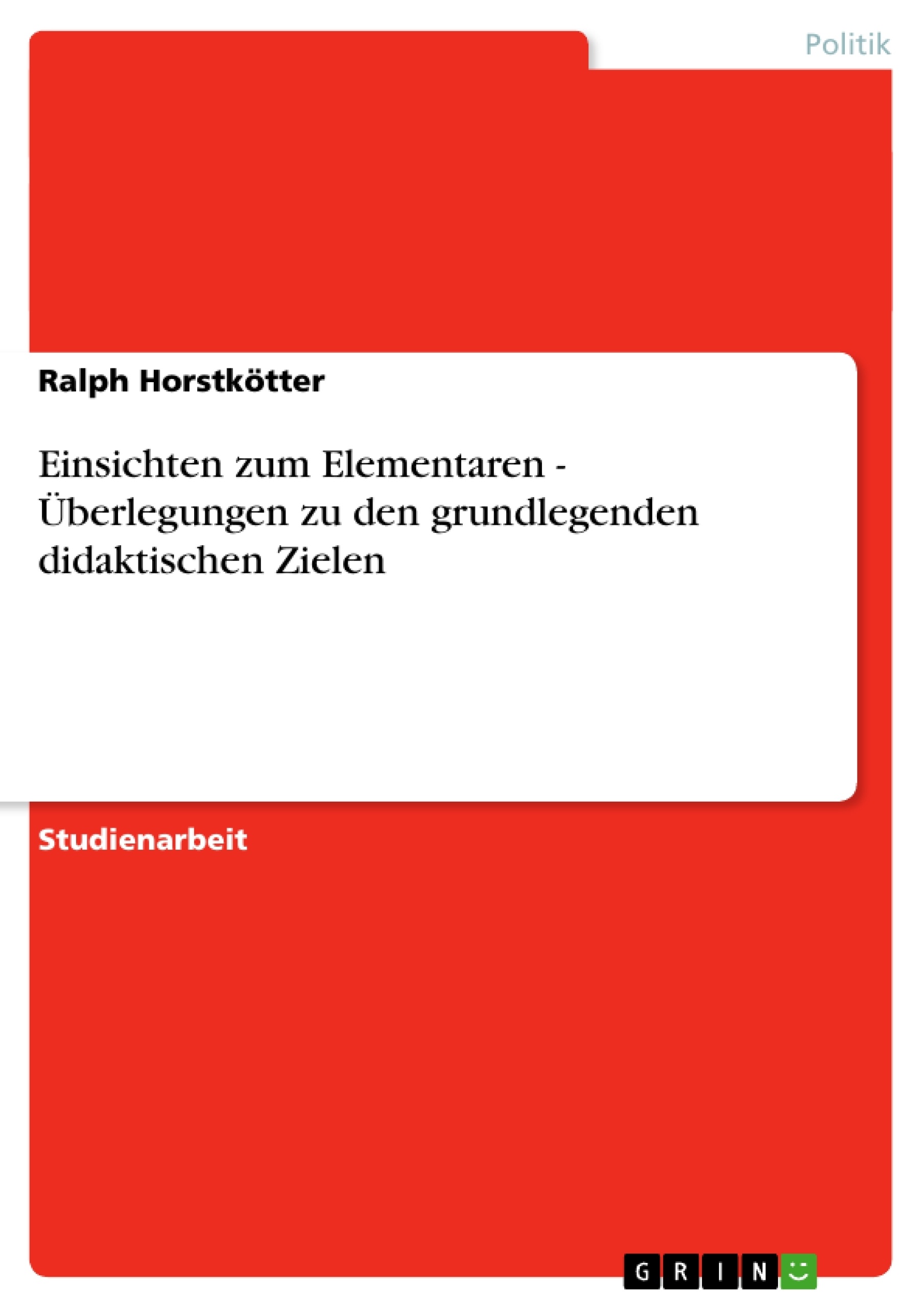Die Überzeugung, dass politische Bildung als ein Teil der allgemeinen Persönlichkeitsbildung
– mit der impliziten Aufgabe der Ausbildung demokratisch denkender
und handelnder Staatsbürger dieser Gesellschaft – notwendig ist, hat sich bereits in
der politikdidaktischen Diskussion der 1950er Jahre durchgesetzt.1 So kommt der
Schule als institutioneller Rahmen dieses Lernvorganges eine Schlüsselrolle zu. Die
Forderung nach bildungspolitischer Gleichbehandlung2, die in der Bildungsexpansion
ihren Ausdruck fand, „führte auf inhaltlicher Ebene zu einer Diskussion über die
Stofffülle der Lehrpläne, zur Kritik an ihrem Enzyklopädismus, zur Forderung nach
exemplarischem Lernen sowie nach einer Beschränkung auf das Wesentliche.“3 Auf
eine kurze Formel gebracht subsumieren die Tübinger Beschlüsse von 1951 denn
auch: „Verba docent, exempla trahunt.“4
Mit Kurt Gerhart FISCHER als einem Vertreter der „hessischen Didaktiker“, der sich
mitverantwortlich für die so genannte „didaktische Wende“ zeigte – nicht zuletzt
durch das 1960 veröffentlichte Buch „Der Politische Unterricht“5, welches von Walter
GAGEL als erste Fachdidaktik des politischen Unterrichts (!) gewürdigt wurde6 –
fanden die Begriffe der Einsichten und Erkenntnisse Eingang in die breitere politikdidaktische
Betrachtung. Anhand ihrer Implikationen werden im Folgenden Zielund
Inhaltskomponenten FISCHERs Didaktik des politischen Unterrichts7 betrachtet
und im heutigen gesellschaftlichen Kontext kritisch hinterfragt.
1 vgl. Tielking 1998, 57
2 d.h. der Minderung der starken Selektivität des Bildungssystems und der Verbesserung der
Zugangschancen zu den Sekundarstufen für bildungsferne soziale Schichten
3 Tielking 1998, 57
4 vgl. Tübinger Beschlüsse, zitiert nach Fischer 1999, 167
5 Fischer et al 1965, 1960
6 vgl. Gagel, Menne 1988, 18
7 Wenngleich Fischer die politische Bildung nicht als exklusive Aufgabe des Unterrichtsfaches Politik
verstanden hat, sondern vielmehr als eine Bildungsaufgabe per se in allen Bereichen – wie später noch
gezeigt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zieldimensionen und ihre Umsetzung
- Die Verflechtung von Elementarem und ihrer Einsichten
- Emanzipation – FISCHERS Bild des homo politicus
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk befasst sich mit den grundlegenden didaktischen Zielen von Kurt Gerhard Fischers politischer Bildungstheorie. Der Autor analysiert die Bedeutung elementarer politischer Einsichten und ihre Relevanz für die Entwicklung des homo politicus. Im Zentrum stehen die Frage nach der Umsetzung dieser Einsichten im politischen Unterricht und die kritische Hinterfragung der Konzepte im heutigen gesellschaftlichen Kontext.
- Die Rolle elementarer politischer Einsichten in der politischen Bildung
- Die Bedeutung von kritischer Urteilsbildung und politischem Handeln
- Die Entwicklung des homo politicus im Kontext der politischen Bildung
- Die Relevanz von Fischers Theorie für den heutigen politischen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der politischen Bildung in der Nachkriegszeit und die Bedeutung der Schule als institutionellen Rahmen für die Ausbildung demokratisch denkender und handelnder Staatsbürger.
- Zieldimensionen und ihre Umsetzung: Das Kapitel untersucht die Zieldimensionen von Fischers politischer Bildungstheorie. Die Bedeutung elementarer politischer Einsichten und die Entwicklung des homo politicus werden im Detail analysiert.
Schlüsselwörter
Politische Bildung, elementare Einsichten, homo politicus, kritische Urteilsbildung, politisches Handeln, didaktische Wende, Kurt Gerhard Fischer, politische Unterrichtsdidaktik, emanzipation, gesellschaftlicher Kontext.
- Quote paper
- Ralph Horstkötter (Author), 2004, Einsichten zum Elementaren - Überlegungen zu den grundlegenden didaktischen Zielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26377