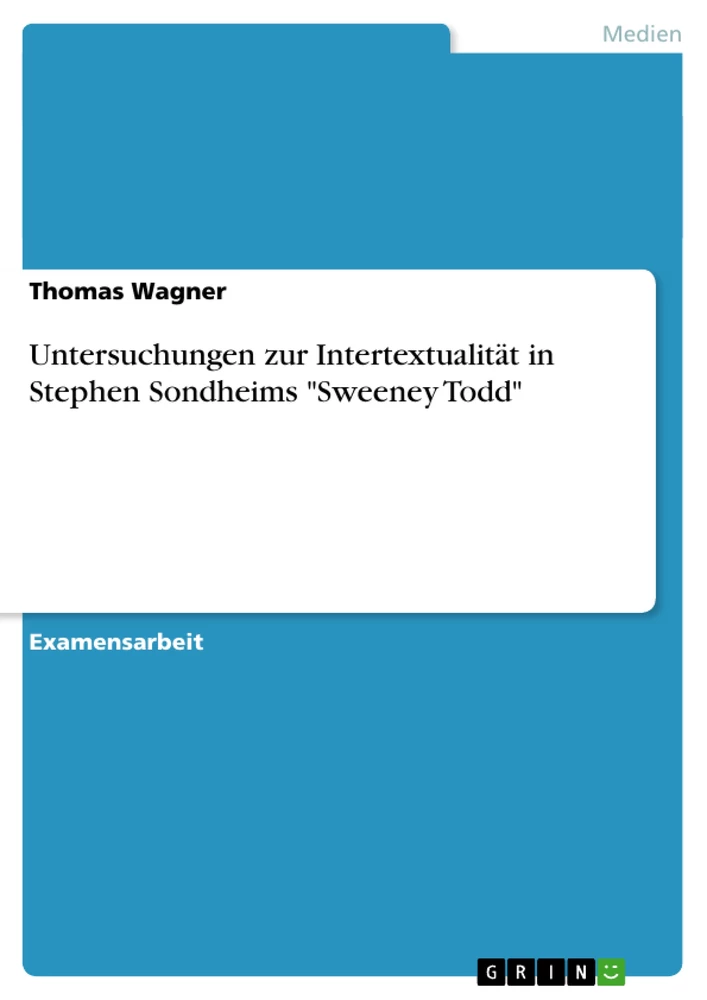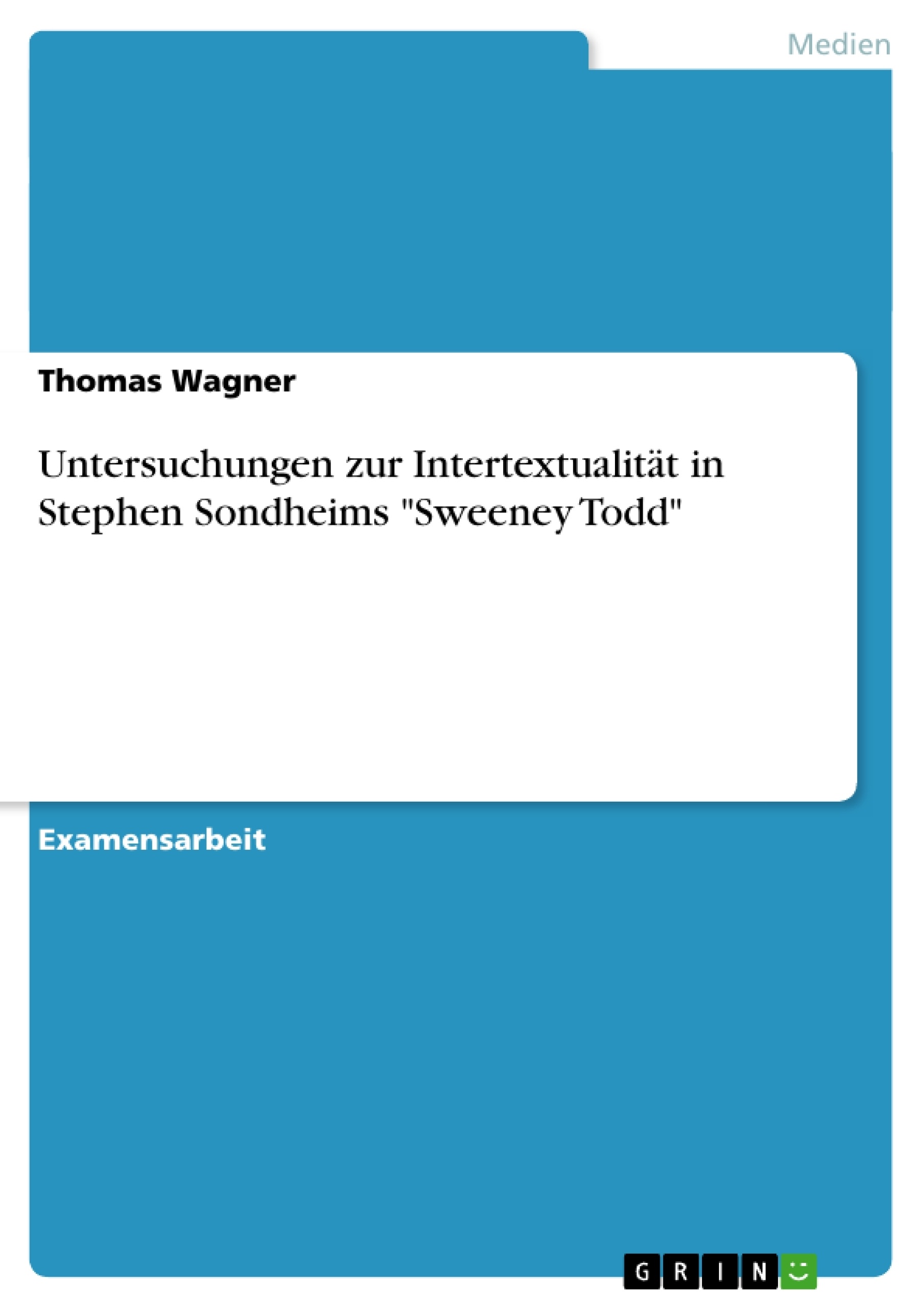Die ersten Teile der Arbeit beabsichtigen, ein Verständnis für die „Theaterwelt“ Sondheims zu gewinnen. Einerseits wird so deutlich, welche Einflüsse für seine Kompositionsweise prägend waren und sind, andererseits hat er sich in Interviews häufig sehr widersprüchlich über Musiktheater im Allgemeinen und seine Werke im Speziellen geäußert, sodass hier auch der Versuch unternommen werden soll, ein möglichst konsistentes, von etwaigen Selbstinszenierungsversuchen befreites Bild von Sondheims Theaterideal zu zeichnen.
Ein Überblick über die Geschichte des Sweeney Todd-Stoffes und den Weg vom Melodram zur Musicalfassung fällt eher knapp aus, da Sondheims Version die erste Musiktheaterbearbeitung darstellt.
Im Anschluss geht es um eine ähnliche Problematik in Bezug auf verschiedene, für die Analyse dringend benötigte Begriffe wie „Leitmotiv“, „Zitat“, „Collage“ und einige mehr. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Termini, bei denen keine klare, eindeutige Definition gegeben werden kann1. Es existieren vielmehr mehrere Erklärungsmodelle nebeneinander, weswegen es die Zielsetzung dieses Abschnitts sein wird, jeweils eine „Arbeitsfassung“ der Begriffe zu definieren, sodass klar wird, mit welchem Instrumentarium im später folgenden Analyseteil gearbeitet wird. Im Kontext dieser Definitionen wird auch zu klären sein, was im Umfeld des Musicals bzw. allgemein der musikwissenschaftlichen Untersuchung mit der Bezeichnung „Intertextualität“ gemeint ist und inwiefern sich deren Bedeutung von ihrer ursprünglichen, d.h. literaturwissenschaftlichen Form unterscheidet. Das vierte Kapitel gibt eine Zusammenfassung der in der Literatur schon lebhaft geführten Diskussion, womit wir es in Sweeney Todd formal zu tun haben – Oper, Operette, Musical, „Movie for the Stage“ sind nur eine kleine Auswahl von Einordnungen, die bisher vorgenommen wurden. Das Ziel des Kapitels ist es, die verschiedenen Gattungen und ihrn jeweiligen Anteil bzw. Einfluss (und damit mögliches Intertext-Potential) kurz darzustellen, um sich im fünften Abschnitt mit der Analyse einzelner Szenen befassen zu können. Es ist weder möglich noch beabsichtigt, eine vollständige Detailbetrachtung des kompletten Musicals zu leisten; stattdessen beschränkt sich die Analyse unter Einbeziehung der vorhergehenden Begriffsklärungen und Gattungsmerkmale auf einige sehr charakteristische Szenen, sodass ein möglichst großes Spektrum der von Sondheim verwendeten Techniken nachvollziehbar wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sweeney Todd und sein Komponist
- 2.1 Stephen Sondheims Theaterbiographie vor Sweeney Todd
- 2.2 Das „ideale Musiktheater“
- 2.3 Sweeney Todd - eine kurze Werkgeschichte
- 3 Begriffsklärungen
- 3.1 Intertextualität
- 3.2 Zitat, Collage, Pastiche, Parodie - Formen der Intertextualität
- 3.3 Leit- und Erinnerungsmotiv
- 3.3.1 Versuch einer Abgrenzung der Begriffe
- 3.3.2 Sondheims Konzeption motivischer Arbeit
- 4 Oper, Operette oder „Movie for the Stage“?
- 5 Analyse ausgewählter Szenen
- 5.1 Sweeney als Rächer, der Chor als Erzähler - Die „Ballad of Sweeney Todd“
- 5.2 Mrs Lovett und die Music Hall - „By the sea“ und „Parlor Songs“
- 5.3 Tobys (Kinder-)Lieder - „Pirelli's Miracle Elixir“ und „Not while I'm around“
- 5.4 Johanna, Pirelli und die Belcanto-Oper - „Green Finch and Linnet Bird“ und „The Contest“
- 5.5 Die „Final Sequence“ als „Konfrontation der Motive“
- 5.5.1 „City on Fire!“
- 5.5.2 „Searching“ (Part I & II)
- 5.5.3 „The Judges Return“
- 5.5.4 „Final Scene“
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Intertextualität in Stephen Sondheims Musical „Sweeney Todd“. Ziel ist es, die verschiedenen musikalischen und dramaturgischen Einflüsse und Zitate aufzuzeigen und deren Bedeutung für das Gesamtwerk zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet Sondheims Positionierung innerhalb des Musical-Genres und setzt sich kritisch mit der Rezeption des Musicals auseinander.
- Intertextualität in Sondheims „Sweeney Todd“
- Sondheims Stellung im Musical-Genre
- Die Rezeption von „Sweeney Todd“ in der Musikwissenschaft
- Der Umgang mit traditionellen Musiktheaterformen im Musical
- Motivische Arbeit in Sondheims Kompositionen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung thematisiert die gängige, oft abwertende Rezeption des Musicals in der Wissenschaft und stellt den Versuch dar, das Musical als ernstzunehmende Kunstform zu betrachten. Sie beleuchtet die Entwicklung des Genres und hebt Sondheim als Prototyp des gegen den Unterhaltungstrend kämpfenden, seriösen Intellektuellen hervor. Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein und gibt einen Überblick über die Argumentationslinie der Arbeit.
2 Sweeney Todd und sein Komponist: Dieses Kapitel skizziert die Theaterbiographie von Stephen Sondheim vor „Sweeney Todd“, um seinen künstlerischen Werdegang und die Einflüsse auf sein Werk zu beleuchten. Es wird seine Vorstellung vom „idealen Musiktheater“ erörtert und die Werkgeschichte von „Sweeney Todd“ kurz umrissen, um den Kontext für die anschließende Intertextualitätsanalyse zu schaffen.
3 Begriffsklärungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Intertextualität, Zitat, Collage, Pastiche und Parodie. Es grenzt diese Formen der Intertextualität voneinander ab und untersucht Sondheims Konzept motivischer Arbeit im Detail, um die Grundlage für die anschließende Analyse zu legen.
4 Oper, Operette oder „Movie for the Stage“?: Dieses Kapitel behandelt die Gattungszugehörigkeit von „Sweeney Todd“ und analysiert die vielfältigen Stilelemente und deren Einordnung im Kontext der Oper, Operette und des "Movie for the Stage". Die Diskussion umfasst die Frage nach der Einzigartigkeit und der Einordnung des Musicals in ein bereits etabliertes Genre-System.
5 Analyse ausgewählter Szenen: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Szenen aus „Sweeney Todd“, indem es die Intertextualität in Bezug auf musikalische Stile, Motive und dramaturgische Elemente untersucht. Die Analyse beleuchtet, wie Sondheim verschiedene musikalische Traditionen zitiert und verarbeitet und wie dies zur Gesamtwirkung des Musicals beiträgt. Es wird sowohl die narrativen als auch die kompositorischen Aspekte betrachtet.
Schlüsselwörter
Stephen Sondheim, Sweeney Todd, Intertextualität, Musical, Musiktheater, Oper, Operette, Leitmotiv, Komposition, Dramaturgie, Rezeption, Genrekonventionen.
Häufig gestellte Fragen zu „Sweeney Todd – Eine Intertextualitätsanalyse“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Intertextualität in Stephen Sondheims Musical „Sweeney Todd“. Der Fokus liegt auf der Aufdeckung und Bedeutung verschiedener musikalischer und dramaturgischer Einflüsse und Zitate für das Gesamtwerk.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Sondheims Positionierung innerhalb des Musical-Genres, analysiert die Rezeption des Musicals und beleuchtet den Umgang mit traditionellen Musiktheaterformen im Musical. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der motivischen Arbeit in Sondheims Kompositionen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Intertextualität in „Sweeney Todd“, Sondheims Stellung im Musical-Genre, die Rezeption von „Sweeney Todd“, den Umgang mit traditionellen Musiktheaterformen (Oper, Operette etc.) und die motivische Arbeit in Sondheims Kompositionen. Die Gattungszugehörigkeit des Musicals wird ebenso diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Sweeney Todd und sein Komponist, Begriffsklärungen (Intertextualität, Zitate etc.), Oper, Operette oder „Movie for the Stage“?, Analyse ausgewählter Szenen und Zusammenfassung. Die Kapitel 2 und 5 sind besonders umfangreich und detailliert.
Wie wird die Intertextualität analysiert?
Die Intertextualität wird anhand ausgewählter Szenen aus „Sweeney Todd“ analysiert, wobei musikalische Stile, Motive und dramaturgische Elemente untersucht werden. Die Analyse beleuchtet, wie Sondheim verschiedene musikalische Traditionen zitiert und verarbeitet und wie dies zur Gesamtwirkung des Musicals beiträgt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Stephen Sondheim, Sweeney Todd, Intertextualität, Musical, Musiktheater, Oper, Operette, Leitmotiv, Komposition, Dramaturgie, Rezeption, Genrekonventionen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine intertextuelle Analyse, um die verschiedenen Einflüsse und Zitate in Sondheims Werk aufzuzeigen und deren Bedeutung zu untersuchen. Zusätzlich wird die Gattungszugehörigkeit des Musicals diskutiert und die Rezeption des Werkes in der Musikwissenschaft beleuchtet.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Wissenschaftler*innen und Studierende der Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaft, die sich mit dem Musical-Genre, der Musik Sondheims und dem Phänomen der Intertextualität auseinandersetzen.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung thematisiert die oft abwertende Rezeption des Musicals in der Wissenschaft und argumentiert für eine Anerkennung des Musicals als ernstzunehmende Kunstform. Sie beleuchtet die Entwicklung des Genres, hebt Sondheim als seriösen Intellektuellen hervor und führt in die Forschungsfrage und die Argumentationslinie der Arbeit ein.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wesentlichen Inhalte und Argumentationslinien jedes Kapitels prägnant darstellt.
- Quote paper
- Thomas Wagner (Author), 2013, Untersuchungen zur Intertextualität in Stephen Sondheims "Sweeney Todd", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263497