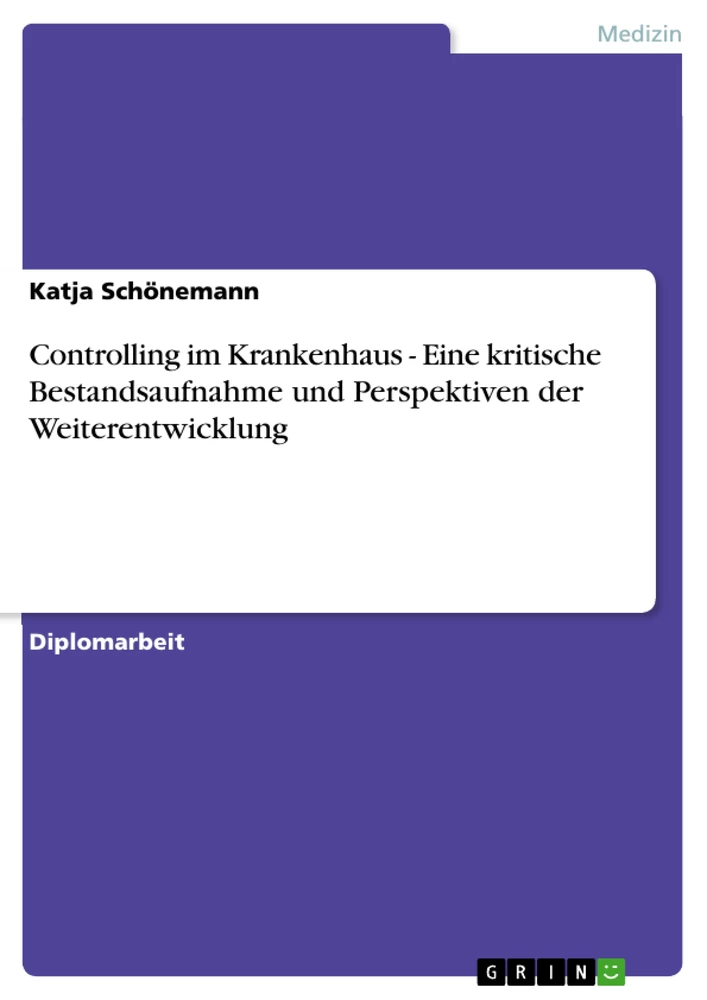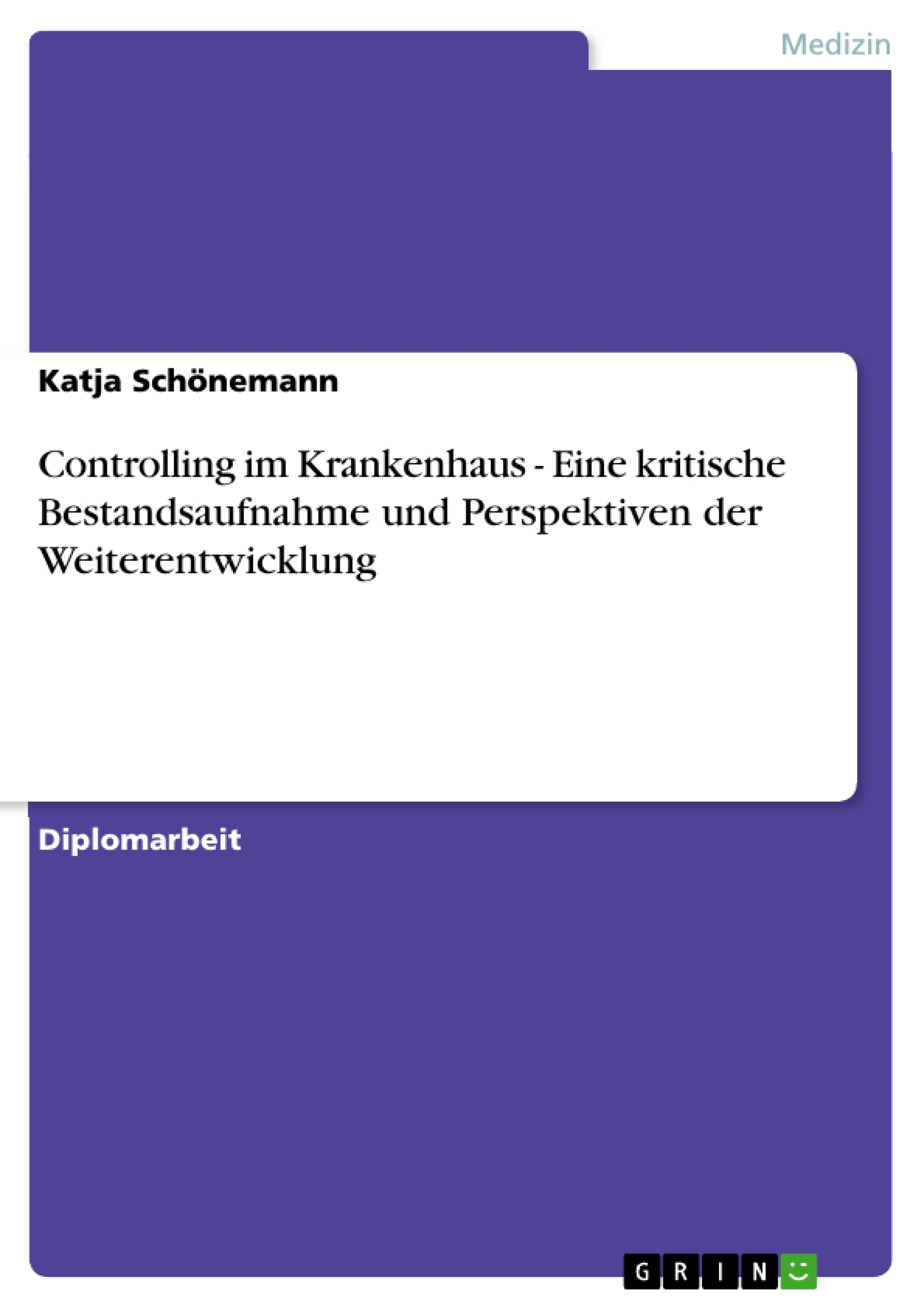Über 200 Krankenhäuser werden bis 2020 in Deutschland schließen müssen. Während sich im Jahr 2010 gerade mal jedes zehnte Krankenhaus in Insolvenzgefahr befand, wird 2020 bereits jedes sechste Krankenhaus von der Insolvenz bedroht sein. Schon heute erwirtschaftet etwa nur die Hälfte aller Krankenhäuser die Erträge, die zur Substanzerhaltung notwendig sind. Und in den nächsten Jahren wird sich diese Situation noch weiter zuspitzen. So lauten die alarmierenden Prognosen bis zum Jahr 2020, wenn sich die wirtschaftliche Situation nicht entscheidend verbessert. Zu dieser Erkenntnis kommen die Autoren des aktuellen Krankenhaus Rating Reports 2012. Für die dem Report zugrundeliegende bundesweite Gemeinschaftsstudie von RWI, HCB und Accenture wurden Jahresabschlüsse aus den Jahren 2009 und 2010 von insgesamt über 1.000 deutschen Krankenhäusern gründlich analysiert. Basierend auf diesen Daten konnten zum einen Hochrechnungen für die Jahre 2011 und 2012 durchgeführt und zum anderen Prognosen für 2020 aufgestellt werden. Demnach sind es besonders die kleinen kommunalen, die öffentlich-rechtlichen und die westdeutschen Krankenhäuser, denen schwierige Zeiten vorhergesagt werden. Während die Lage in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen vergleichsweise gut ist, müssen die Krankenhäuser in Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen ums Überleben kämpfen. Bei der Unterteilung nach Trägern zeichnet sich ebenso eine klare Tendenz ab. Während 80 % der privaten Krankenhäuser die trägerspezifische Mindest-Marge erreichen, trifft dies nur auf 40 % der nichtprivaten zu. Weiterhin arbeiten Kliniken mit einem hohen Spezialisierungsgrad qualitativ und wirtschaftlich nachweislich besser als Krankenhäuser mit einem breiten Leistungsspektrum. Es konnte nachgewiesen werden, dass mit dem Grad der Spezialisierung auch der Erfolg eines Krankenhauses zunimmt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Charakterisierung des deutschen Krankenhauswesens
- 2.1 Grundlagen des deutschen Gesundheitssystems
- 2.2 Grundlegende Merkmale von Krankenhäusern
- 2.2.1 Aktuelle Rahmendaten
- 2.2.2 Systematisierungsmöglichkeiten
- 2.2.3 Ziele und Aufgaben
- 2.2.4 Organisationsstruktur
- 2.3 Finanzierung von Krankenhäusern
- 2.3.1 Investitionsfinanzierung
- 2.3.2 Betriebskostenvergütung
- 3 Rahmenbedingungen deutscher Krankenhäuser
- 3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 3.2 Veränderungen des Wettbewerbsumfelds
- 4 Controlling im Krankenhaus
- 4.1 Controlling-Begriff
- 4.2 Zielsetzung und Aufgaben des Controllings im Krankenhaus
- 4.3 Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage des Controllings
- 4.4 Operative Controlling-Instrumente im Krankenhaus
- 4.4.1 Kennzahlen und Berichtswesen
- 4.4.2 Clinical Pathways
- 4.4.3 Prozesskostenrechnung
- 4.5 Taktische Controlling-Instrumente im Krankenhaus
- 4.5.1 Fallmix-Optimierung
- 4.5.2 Multiattributive Investitionsplanung
- 4.6 Strategische Controlling-Instrumente im Krankenhaus
- 4.6.1 SWOT-Analyse
- 4.6.2 Portfolio-Analyse
- 4.6.3 Benchmarking
- 4.6.4 Balanced Scorecard
- 5 Perspektiven und Weiterentwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Controlling im deutschen Krankenhauswesen. Ziel ist es, eine kritische Bestandsaufnahme des bestehenden Controllings durchzuführen und Perspektiven für dessen Weiterentwicklung aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Herausforderungen des Krankenhauscontrollings im Kontext des deutschen Gesundheitssystems.
- Charakterisierung des deutschen Krankenhauswesens und seiner Rahmenbedingungen
- Analyse der verschiedenen Controlling-Instrumente im Krankenhaus (operativ, taktisch, strategisch)
- Bewertung der Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage des Krankenhauscontrollings
- Diskussion der Herausforderungen und Potenziale des Controllings im Krankenhaus
- Entwicklung von Perspektiven zur Weiterentwicklung des Krankenhauscontrollings
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Krankenhauscontrollings ein und beschreibt die Relevanz und Zielsetzung der Arbeit. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodische Vorgehensweise.
2 Charakterisierung des deutschen Krankenhauswesens: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das deutsche Krankenhauswesen. Es werden die Grundlagen des Gesundheitssystems, die Merkmale von Krankenhäusern (Rahmendaten, Systematisierung, Ziele, Organisation), sowie die Finanzierung (Investitionen und Betriebskosten) detailliert beschrieben. Die komplexe Struktur und die verschiedenen Akteure des Systems werden beleuchtet, um das Umfeld des Krankenhauscontrollings zu verstehen.
3 Rahmenbedingungen deutscher Krankenhäuser: Hier werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Veränderungen im Wettbewerbsumfeld deutscher Krankenhäuser analysiert. Der Einfluss von Regulierungen und dem zunehmenden Wettbewerb auf die Controlling-Aktivitäten wird diskutiert. Es werden die Herausforderungen und Chancen, die sich aus den sich verändernden Rahmenbedingungen ergeben, beleuchtet.
4 Controlling im Krankenhaus: Das Kernkapitel analysiert das Controlling im Krankenhaus. Es definiert den Controlling-Begriff und beschreibt die spezifischen Zielsetzungen und Aufgaben im Krankenhauskontext. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird als Grundlage des Controllings im Detail erläutert. Anschließend werden operative, taktische und strategische Controlling-Instrumente wie Kennzahlen, Clinical Pathways, Prozesskostenrechnung, Fallmix-Optimierung, Investitionsplanung, SWOT-Analyse, Portfolio-Analyse, Benchmarking und die Balanced Scorecard umfassend dargestellt und in Bezug auf ihre Anwendbarkeit und Effektivität im Krankenhausumfeld bewertet. Die Kapitel beleuchtet die jeweiligen Stärken und Schwächen der einzelnen Instrumente und veranschaulicht deren Zusammenhänge.
Schlüsselwörter
Krankenhauscontrolling, Krankenhauswesen, Gesundheitswesen, Kostenrechnung, Leistungsrechnung, Finanzierung, Strategisches Controlling, Operatives Controlling, Taktisches Controlling, Kennzahlen, Clinical Pathways, Prozesskostenrechnung, Fallmix-Optimierung, SWOT-Analyse, Portfolio-Analyse, Benchmarking, Balanced Scorecard, Wettbewerb, Regulierung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Controlling im deutschen Krankenhauswesen"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Controlling im deutschen Krankenhauswesen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Controlling-Instrumente (operativ, taktisch, strategisch) im Kontext des deutschen Gesundheitssystems und der Herausforderungen sowie Potenziale des Krankenhauscontrollings.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung), Kapitel 2 (Charakterisierung des deutschen Krankenhauswesens), Kapitel 3 (Rahmenbedingungen deutscher Krankenhäuser), Kapitel 4 (Controlling im Krankenhaus) und Kapitel 5 (Perspektiven und Weiterentwicklungen). Kapitel 4 ist dabei besonders ausführlich und unterteilt sich in Unterkapitel zu verschiedenen Controlling-Instrumenten und deren Anwendung im Krankenhaus.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Ziel des Dokuments ist eine kritische Bestandsaufnahme des bestehenden Controllings im deutschen Krankenhauswesen und die Aufzeigung von Perspektiven für dessen Weiterentwicklung. Es beleuchtet die spezifischen Herausforderungen des Krankenhauscontrollings im Kontext des deutschen Gesundheitssystems.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Charakterisierung des deutschen Krankenhauswesens und seiner Rahmenbedingungen, die Analyse verschiedener Controlling-Instrumente (operativ, taktisch, strategisch), die Bewertung der Kosten- und Leistungsrechnung, die Diskussion der Herausforderungen und Potenziale des Controllings im Krankenhaus und die Entwicklung von Perspektiven zur Weiterentwicklung des Krankenhauscontrollings.
Welche Controlling-Instrumente werden im Detail beschrieben?
Das Dokument beschreibt detailliert sowohl operative (Kennzahlen, Berichtswesen, Clinical Pathways, Prozesskostenrechnung), taktische (Fallmix-Optimierung, Multiattributive Investitionsplanung) als auch strategische Controlling-Instrumente (SWOT-Analyse, Portfolio-Analyse, Benchmarking, Balanced Scorecard) im Kontext des Krankenhauswesens. Es werden deren Stärken, Schwächen und Anwendbarkeit im Krankenhausumfeld bewertet.
Welche Bedeutung hat die Kosten- und Leistungsrechnung?
Die Kosten- und Leistungsrechnung wird als grundlegende Grundlage des Controllings im Krankenhaus dargestellt und ausführlich erläutert. Ihre Bedeutung für die Steuerung und Optimierung von Krankenhausprozessen wird hervorgehoben.
Welche Herausforderungen und Perspektiven werden im Bezug auf das Krankenhauscontrolling diskutiert?
Das Dokument beleuchtet die Herausforderungen des Krankenhauscontrollings, die sich aus den komplexen Rahmenbedingungen des deutschen Gesundheitssystems (z.B. gesetzliche Regelungen, Wettbewerb) ergeben. Es werden zudem Perspektiven und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Controllings aufgezeigt, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern zu verbessern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Dokument?
Relevante Schlüsselwörter sind: Krankenhauscontrolling, Krankenhauswesen, Gesundheitswesen, Kostenrechnung, Leistungsrechnung, Finanzierung, Strategisches Controlling, Operatives Controlling, Taktisches Controlling, Kennzahlen, Clinical Pathways, Prozesskostenrechnung, Fallmix-Optimierung, SWOT-Analyse, Portfolio-Analyse, Benchmarking, Balanced Scorecard, Wettbewerb, Regulierung.
- Arbeit zitieren
- Katja Schönemann (Autor:in), 2013, Controlling im Krankenhaus - Eine kritische Bestandsaufnahme und Perspektiven der Weiterentwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263433