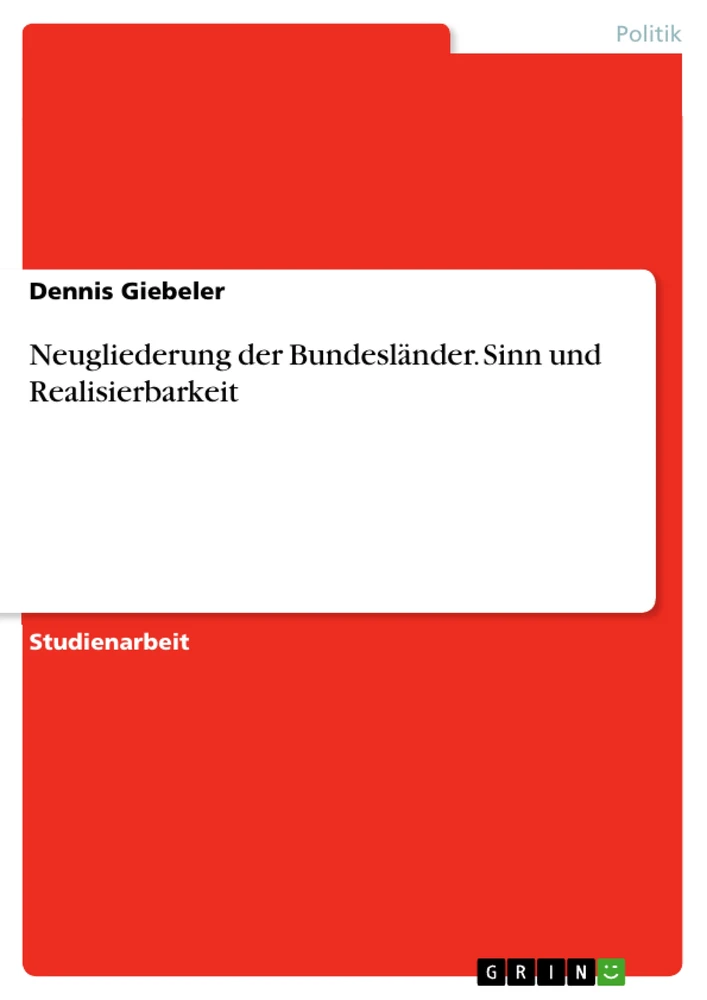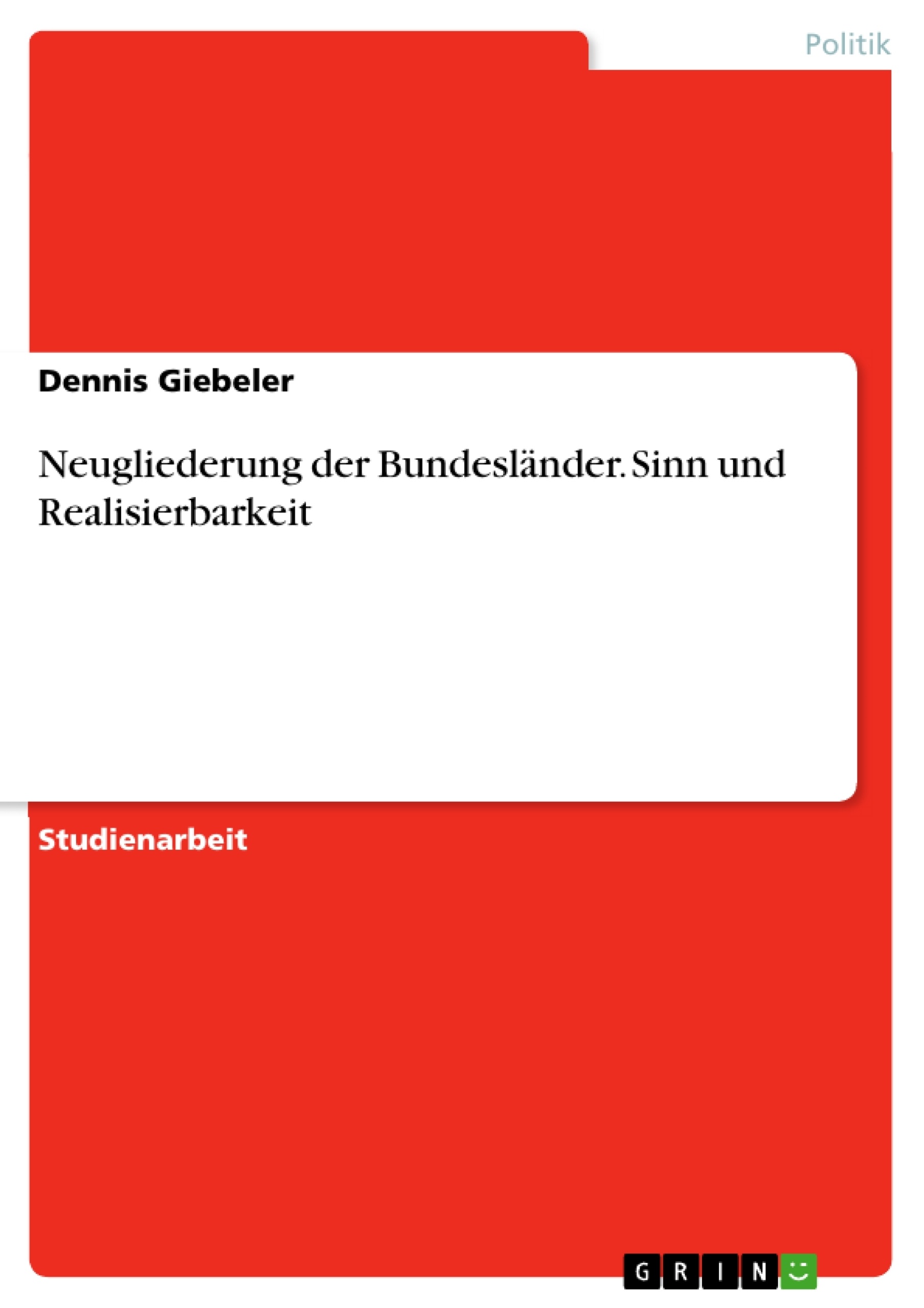Warum wird das Thema Neugliederung so kontrovers diskutiert? Was spricht für und was gegen sie? Und
wie realistisch sind alternative Grenzziehungen wirklich? Diese und mehr Fragen sollen in folgender Arbeit behandelt werden.
Dabei soll zunächst ein Blick auf die historische Entwicklung des Themas Neugliederung geworfen werden, um zu zeigen, welche Rolle das Grundgesetz spielte, wie die Bundesländer entstanden sind und welche Anläufe in Richtung neuer Grenzen es bereits gab. Danach wird
herausgestellt, welche Argumente für und gegen eine Neugliederung sprechen und bewertet, ob diese sinnvoll erscheint. Der Schwerpunkt der Arbeit wird jedoch auf Kapitel 4 liegen, in dem die Frage beantwortet wird, wie realistisch eine Neugliederung ist. Dazu sollen
Probleme, wie der Widerstand durch politische Akteure, und Chancen, wie der Druck durch Bürgergruppen, betrachtet werden. Zudem soll Kingdons Multiple-Streams-Ansatz (2003) herangezogen werden, um festzustellen, was nötig wäre, um ein „Gelegenheitsfenster“ für die
Neugliederung zu öffnen. Abschließend sollen in Kapitel 5 einige wichtige Punkte der Arbeit wiederaufgegriffen, ein Fazit gezogen und Vorschläge für weiterführende Untersuchungen gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Neugliederung als historisches Erbe
- 3. Neugliederung auf dem Prüfstand
- 3.1 Gründe für die Neugliederung
- 3.2 Gründe gegen die Neugliederung
- 3.3 Zwischenfazit
- 4. Realisierbarkeit der Neugliederung
- 5. Abschlussbetrachtung und Vorschläge zur weiterführenden Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sinnhaftigkeit und Realisierbarkeit einer Neugliederung der deutschen Bundesländer. Sie analysiert die historischen Entwicklungen, die Argumente für und gegen eine Neugliederung, und bewertet deren Realisierbarkeit unter Berücksichtigung politischer und gesellschaftlicher Faktoren. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie realistisch eine solche Neugliederung tatsächlich ist.
- Historische Entwicklung der Debatte um die Neugliederung der Bundesländer
- Argumente für und gegen eine Neugliederung
- Realisierbarkeit einer Neugliederung unter Berücksichtigung politischer Widerstände und gesellschaftlichen Drucks
- Analyse des Kingdons Multiple-Streams-Ansatzes im Kontext der Neugliederung
- Bewertung der Sinnhaftigkeit einer Neugliederung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Neugliederung der Bundesländer ein und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von Grenzziehungen im Allgemeinen und den besonderen Kontext der deutschen Bundesländer. Der Autor erläutert die Forschungsmethodik und den Aufbau der Arbeit, wobei der Schwerpunkt auf der Analyse der Realisierbarkeit einer Neugliederung gelegt wird. Die Definition des Begriffs "Neugliederung" im Kontext der Arbeit wird präzisiert.
2. Neugliederung als historisches Erbe: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Themas Neugliederung im Kontext der deutschen Geschichte. Es analysiert die Rolle des Grundgesetzes und der alliierten Besatzungspolitik bei der Bildung der Bundesländer. Das Kapitel beleuchtet verschiedene historische Anläufe zu einer Neugliederung, darunter den Euler-Ausschuss, die Weinheimer Tagung, den Luther-Ausschuss und die Ernst-Kommission. Die Analyse zeigt die unterschiedlichen Ansätze und die Gründe für das Scheitern der früheren Reformversuche. Der Einfluss des Grundgesetzes auf die Möglichkeiten einer Neugliederung wird detailliert dargestellt.
3. Neugliederung auf dem Prüfstand: Dieses Kapitel evaluiert die Argumente für und gegen eine Neugliederung der Bundesländer. Es präsentiert verschiedene Perspektiven und bewertet deren Tragfähigkeit. Die Diskussion berücksichtigt wirtschaftliche, soziale und politische Aspekte. Das Zwischenfazit dieses Kapitels bereitet den Weg zur folgenden Analyse der Realisierbarkeit.
Schlüsselwörter
Neugliederung, Bundesländer, Föderalismus, Grundgesetz, Realisierbarkeit, historische Entwicklung, politische Akteure, Bürgergruppen, Kingdons Multiple-Streams-Ansatz, Leistungsfähigkeit, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Neugliederung der deutschen Bundesländer
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Sinnhaftigkeit und Realisierbarkeit einer Neugliederung der deutschen Bundesländer. Sie analysiert die historischen Entwicklungen, die Argumente dafür und dagegen, und bewertet deren Realisierbarkeit unter Berücksichtigung politischer und gesellschaftlicher Faktoren. Der Fokus liegt auf der Frage, wie realistisch eine solche Neugliederung ist.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Debatte um die Neugliederung, Argumente für und gegen eine Neugliederung, die Realisierbarkeit unter Berücksichtigung politischer Widerstände und gesellschaftlichen Drucks, den Kingdons Multiple-Streams-Ansatz im Kontext der Neugliederung und eine Bewertung der Sinnhaftigkeit einer Neugliederung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfragen vor. Kapitel 2 (Neugliederung als historisches Erbe) untersucht die historische Entwicklung der Debatte. Kapitel 3 (Neugliederung auf dem Prüfstand) evaluiert Argumente für und gegen eine Neugliederung. Kapitel 4 (Realisierbarkeit der Neugliederung) befasst sich mit der praktischen Umsetzbarkeit. Kapitel 5 (Abschlussbetrachtung und Vorschläge zur weiterführenden Arbeit) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt Ausblicke.
Welche historischen Entwicklungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Rolle des Grundgesetzes und der alliierten Besatzungspolitik bei der Bildung der Bundesländer und beleuchtet verschiedene historische Anläufe zu einer Neugliederung, darunter den Euler-Ausschuss, die Weinheimer Tagung, den Luther-Ausschuss und die Ernst-Kommission. Der Einfluss des Grundgesetzes auf die Möglichkeiten einer Neugliederung wird detailliert dargestellt.
Welche Argumente für und gegen eine Neugliederung werden diskutiert?
Kapitel 3 präsentiert verschiedene Perspektiven und bewertet deren Tragfähigkeit, wobei wirtschaftliche, soziale und politische Aspekte berücksichtigt werden. Die Arbeit geht detailliert auf die jeweiligen Vor- und Nachteile einer Neugliederung ein.
Welche Rolle spielt der Kingdons Multiple-Streams-Ansatz?
Die Arbeit analysiert den Kingdons Multiple-Streams-Ansatz im Kontext der Neugliederung, um die Realisierbarkeit der Neugliederung besser zu verstehen und einzuschätzen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neugliederung, Bundesländer, Föderalismus, Grundgesetz, Realisierbarkeit, historische Entwicklung, politische Akteure, Bürgergruppen, Kingdons Multiple-Streams-Ansatz, Leistungsfähigkeit, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einer logischen Struktur mit Einleitung, historischer Analyse, Argumentationsbewertung, Realisierungsanalyse und Schlussfolgerung. Der Aufbau ist klar und nachvollziehbar, um die Forschungsfrage umfassend zu beantworten.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für alle bestimmt, die sich für die politische Organisation Deutschlands, den Föderalismus und die Geschichte der deutschen Bundesländer interessieren. Sie richtet sich insbesondere an Wissenschaftler und Studierende, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Text dient lediglich als Zusammenfassung und Übersicht über den Inhalt.
- Quote paper
- Dennis Giebeler (Author), 2013, Neugliederung der Bundesländer. Sinn und Realisierbarkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263423