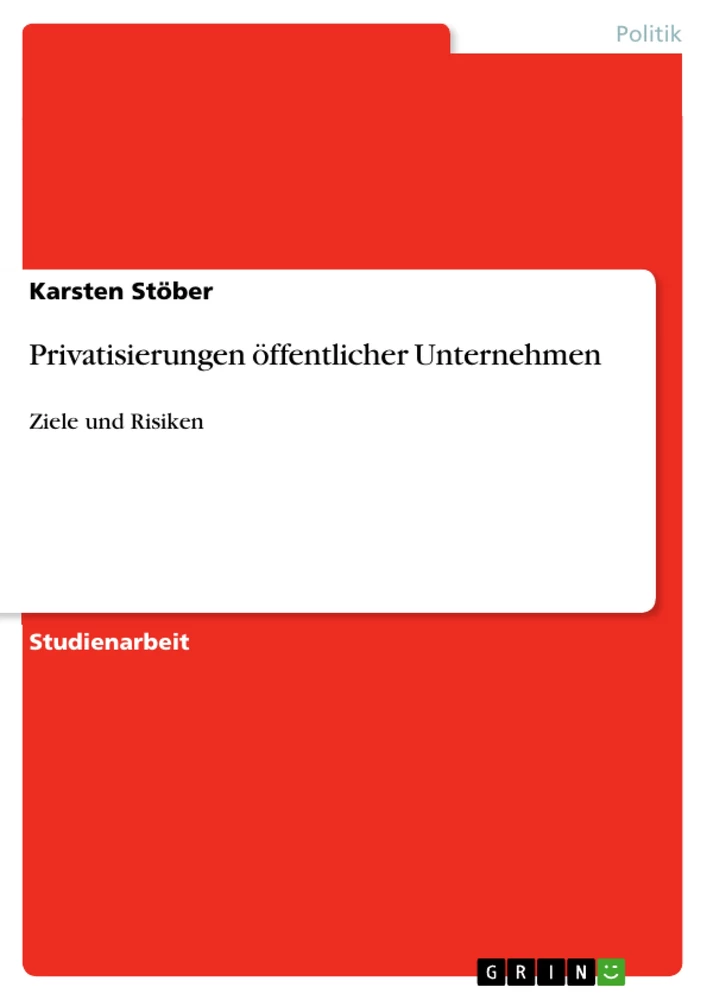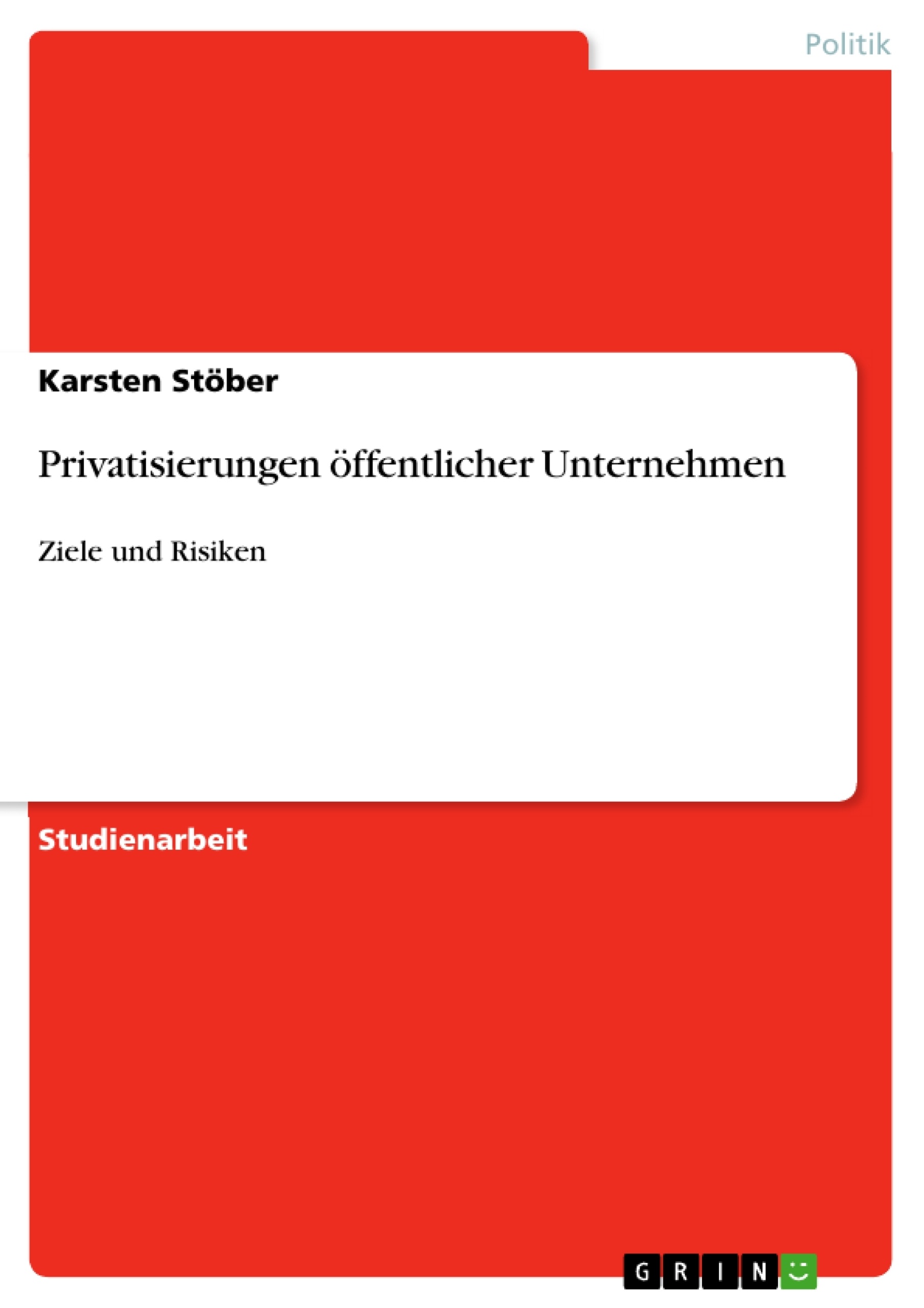Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und objektive Auseinandersetzung mit dem
Thema „Privatisierungspolitik“ ist die Begriffsklärung. Was bedeutet Privatisierung, wie
ist sie definiert und welche Formen der Privatisierung gibt es? Daher möchte ich zunächst
gängige Definitionen nennen und die besonderen Merkmale der unterschiedlichen Formen
von Privatisierungen erläutern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffsklärung
- 1.1 Definitionen
- 1.2 Merkmale und Formen der Privatisierung
- 2. Ziele der Privatisierung
- 2.1 Voraussetzungen
- 2.2 Effizienz- und Innovationssteigerung
- 2.3 Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum
- 2.4 Vorteile für Kunden
- 2.5 Vorteile für Bund, Land und Kommune
- 3. Risiken der Privatisierung
- 3.1 Demokratieabbau
- 3.2 Nachteile für Kunden
- 3.3 Nachteile für Angestellte
- 4. Privatisierungspolitik vom IWF und der Weltbank
- 4.1 Privatisierungspolitik vom IWF
- 4.2 Privatisierungspolitik von der Weltbank
- 5. Beispiele für Privatisierungen in Deutschland
- 5.1 Bahnreform und Privatisierungskurs der Deutschen Bahn
- 5.1.1 Ausgangssituation und Gründe für die Bahnstrukturreform
- 5.1.2 Ziele der Bahnstrukturreform
- 5.1.3 Bahnstrukturreform
- 5.1.4 Auswirkungen
- 5.1.5 Privatisierungskurs und Börsengang
- 5.2 Treuhandanstalt und Privatisierung nach 1990
- 5.2.1 Treuhandanstalt und Zielsetzung
- 5.2.2 Privatisierungsprobleme
- 5.1 Bahnreform und Privatisierungskurs der Deutschen Bahn
- 6. Beispiel für Privatisierung im Ausland
- 6.1 Privatisierung der British Rail (BR)
- 6.1.1 Folgen der Privatisierung
- 6.1 Privatisierung der British Rail (BR)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Privatisierung öffentlicher Unternehmen, beleuchtet die dahinterstehenden Ziele und analysiert die damit verbundenen Risiken. Der Fokus liegt auf der Erörterung der verschiedenen Formen der Privatisierung, der Beurteilung ihrer Auswirkungen auf Wirtschaft, Beschäftigung und Demokratie sowie der Betrachtung von Beispielen aus Deutschland und dem Ausland.
- Definition und Formen der Privatisierung
- Ziele der Privatisierung (Effizienzsteigerung, Wirtschaftswachstum)
- Risiken der Privatisierung (Demokratieabbau, negative Folgen für Kunden und Angestellte)
- Rolle internationaler Organisationen (IWF, Weltbank)
- Fallstudien aus Deutschland und Großbritannien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriffsklärung: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die weitere Arbeit, indem es verschiedene Definitionen von Privatisierung präsentiert und die Merkmale unterschiedlicher Formen von Privatisierung (materielle, funktionale und formelle Privatisierung) erläutert. Es werden Definitionen aus renommierten Quellen wie dem Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung und Meyers Lexikon herangezogen, um ein umfassendes Verständnis des Begriffs zu schaffen und die verschiedenen Facetten der Privatisierung hervorzuheben. Die unterschiedlichen Definitionen verdeutlichen die Komplexität des Themas und die vielschichtigen Auswirkungen von Privatisierungsmaßnahmen.
2. Ziele der Privatisierung: Dieses Kapitel befasst sich mit den angestrebten Zielen von Privatisierungen. Es werden erhöhte Effizienz und Innovation durch verstärkten Wettbewerb als zentrale Argumente genannt, untermauert durch Bezugnahmen auf Adam Smith und das Wagnersche Gesetz. Weiterhin wird das Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum als Hauptziel aus politischer Sicht hervorgehoben, wobei der Zusammenhang zwischen Privateigentum, Investitionen und der Schaffung von Arbeitsplätzen detailliert dargestellt wird. Die Notwendigkeit eines funktionierenden Wettbewerbs als Voraussetzung für den Erfolg von Privatisierungen wird betont, um Monopolbildung und deren negative Folgen zu vermeiden.
3. Risiken der Privatisierung: Im Fokus dieses Kapitels stehen die potenziellen negativen Folgen von Privatisierungen. Hier werden der Demokratieabbau, Nachteile für Kunden (z.B. höhere Preise, geringere Qualität) und negative Auswirkungen auf die Angestellten (z.B. Jobverluste, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen) diskutiert. Dieses Kapitel bietet eine Gegenposition zu den im vorherigen Kapitel dargestellten positiven Zielen und liefert eine ausgewogene Betrachtung der Privatisierungsproblematik. Es stellt die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den Risiken von Privatisierungsprozessen heraus.
4. Privatisierungspolitik vom IWF und der Weltbank: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss internationaler Organisationen wie dem IWF und der Weltbank auf die Privatisierungspolitik. Es beleuchtet die Strategien und Maßnahmen, die von diesen Institutionen gefördert werden, und analysiert deren Auswirkungen auf verschiedene Länder. Die Rolle dieser Organisationen in der Gestaltung und Verbreitung von Privatisierungsmaßnahmen wird kritisch hinterfragt und in den Kontext der globalen Wirtschaftspolitik eingeordnet.
5. Beispiele für Privatisierungen in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert konkrete Beispiele für Privatisierungen in Deutschland, wobei der Fokus auf der Bahnreform und der Treuhandanstalt liegt. Die Analyse der Bahnreform umfasst die Ausgangssituation, die Ziele der Reform, deren Umsetzung und die resultierenden Auswirkungen. Ähnlich wird die Treuhandanstalt und deren Rolle bei der Privatisierung nach der Wiedervereinigung beleuchtet. Die Fallstudien dienen dazu, die theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel mit realen Beispielen zu illustrieren und die Komplexität und Vielschichtigkeit von Privatisierungsprozessen zu verdeutlichen.
6. Beispiel für Privatisierung im Ausland: Dieses Kapitel präsentiert ein Beispiel für eine Privatisierung im Ausland, die Privatisierung der British Rail. Die Folgen dieser Privatisierung werden analysiert und kritisch bewertet. Der Vergleich mit den deutschen Beispielen aus Kapitel 5 erlaubt es, unterschiedliche Ansätze und Resultate von Privatisierungen in verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Kontexten zu analysieren und zu vergleichen.
Schlüsselwörter
Privatisierung, öffentliche Unternehmen, Deregulierung, Effizienz, Innovation, Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Risiken, Demokratie, IWF, Weltbank, Deutsche Bahn, Treuhandanstalt, British Rail, Reprivatisierung, Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Privatisierung öffentlicher Unternehmen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Privatisierung öffentlicher Unternehmen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzungserklärung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ziele, Risiken und Auswirkungen von Privatisierungen anhand von Fallstudien aus Deutschland (Deutsche Bahn, Treuhandanstalt) und Großbritannien (British Rail).
Was sind die Hauptziele der Privatisierung?
Die angestrebten Ziele der Privatisierung umfassen Effizienzsteigerung und Innovationsförderung durch verstärkten Wettbewerb, Wirtschaftswachstum und Beschäftigungssteigerung durch private Investitionen. Es wird betont, dass ein funktionierender Wettbewerb eine Grundvoraussetzung für den Erfolg darstellt.
Welche Risiken sind mit der Privatisierung verbunden?
Die Privatisierung birgt Risiken wie Demokratieabbau, Nachteile für Kunden (höhere Preise, geringere Qualität) und negative Auswirkungen auf Angestellte (Jobverluste, schlechtere Arbeitsbedingungen). Das Dokument betont die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen potenziellen negativen Folgen.
Welche Rolle spielen der IWF und die Weltbank bei der Privatisierung?
Das Dokument untersucht den Einfluss des IWF und der Weltbank auf die Privatisierungspolitik weltweit. Es analysiert deren Strategien und Maßnahmen und deren Auswirkungen auf verschiedene Länder. Die Rolle dieser Organisationen in der Gestaltung und Verbreitung von Privatisierungsmaßnahmen wird kritisch hinterfragt.
Welche Fallstudien werden im Dokument behandelt?
Das Dokument analysiert die Privatisierung der Deutschen Bahn in Deutschland, die Rolle der Treuhandanstalt bei der Privatisierung nach der Wiedervereinigung und die Privatisierung der British Rail in Großbritannien. Diese Fallstudien dienen dazu, die theoretischen Überlegungen mit realen Beispielen zu illustrieren.
Wie werden die verschiedenen Formen der Privatisierung definiert?
Das Dokument erläutert verschiedene Definitionen von Privatisierung und beschreibt die Merkmale unterschiedlicher Formen (materielle, funktionale und formelle Privatisierung). Es bezieht sich auf Definitionen aus renommierten Quellen wie dem Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung und Meyers Lexikon.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Schlüsselbegriffe umfassen Privatisierung, öffentliche Unternehmen, Deregulierung, Effizienz, Innovation, Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Risiken, Demokratie, IWF, Weltbank, Deutsche Bahn, Treuhandanstalt, British Rail, Reprivatisierung und Wettbewerb.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in sechs Kapitel gegliedert: 1. Begriffsklärung, 2. Ziele der Privatisierung, 3. Risiken der Privatisierung, 4. Privatisierungspolitik vom IWF und der Weltbank, 5. Beispiele für Privatisierungen in Deutschland, und 6. Beispiel für Privatisierung im Ausland. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
- Quote paper
- B.A. Karsten Stöber (Author), 2009, Privatisierungen öffentlicher Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263342