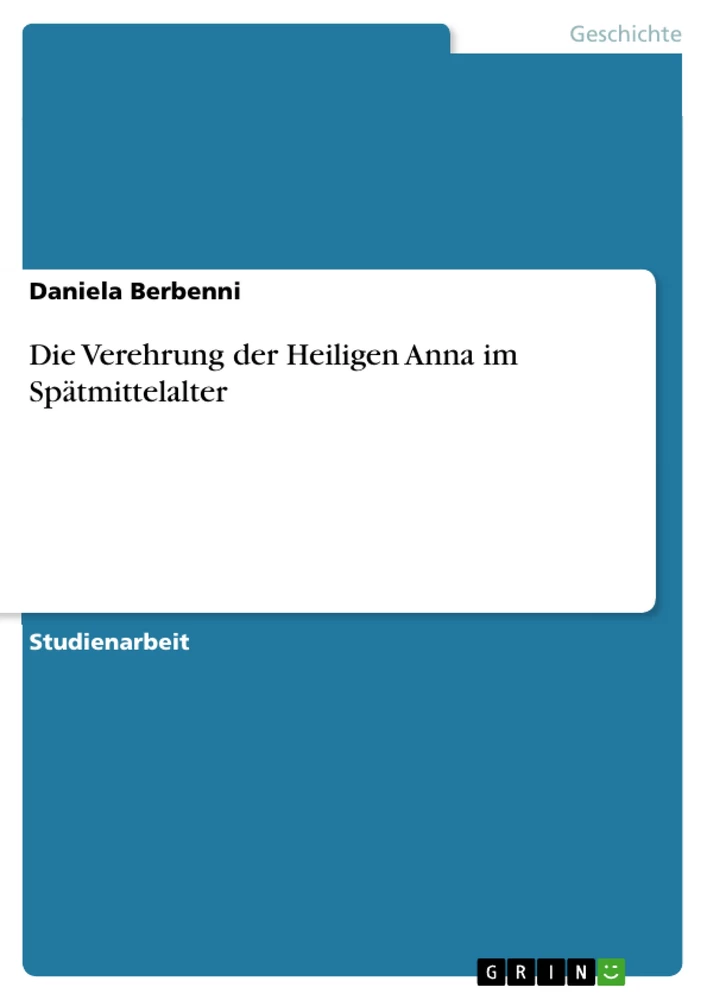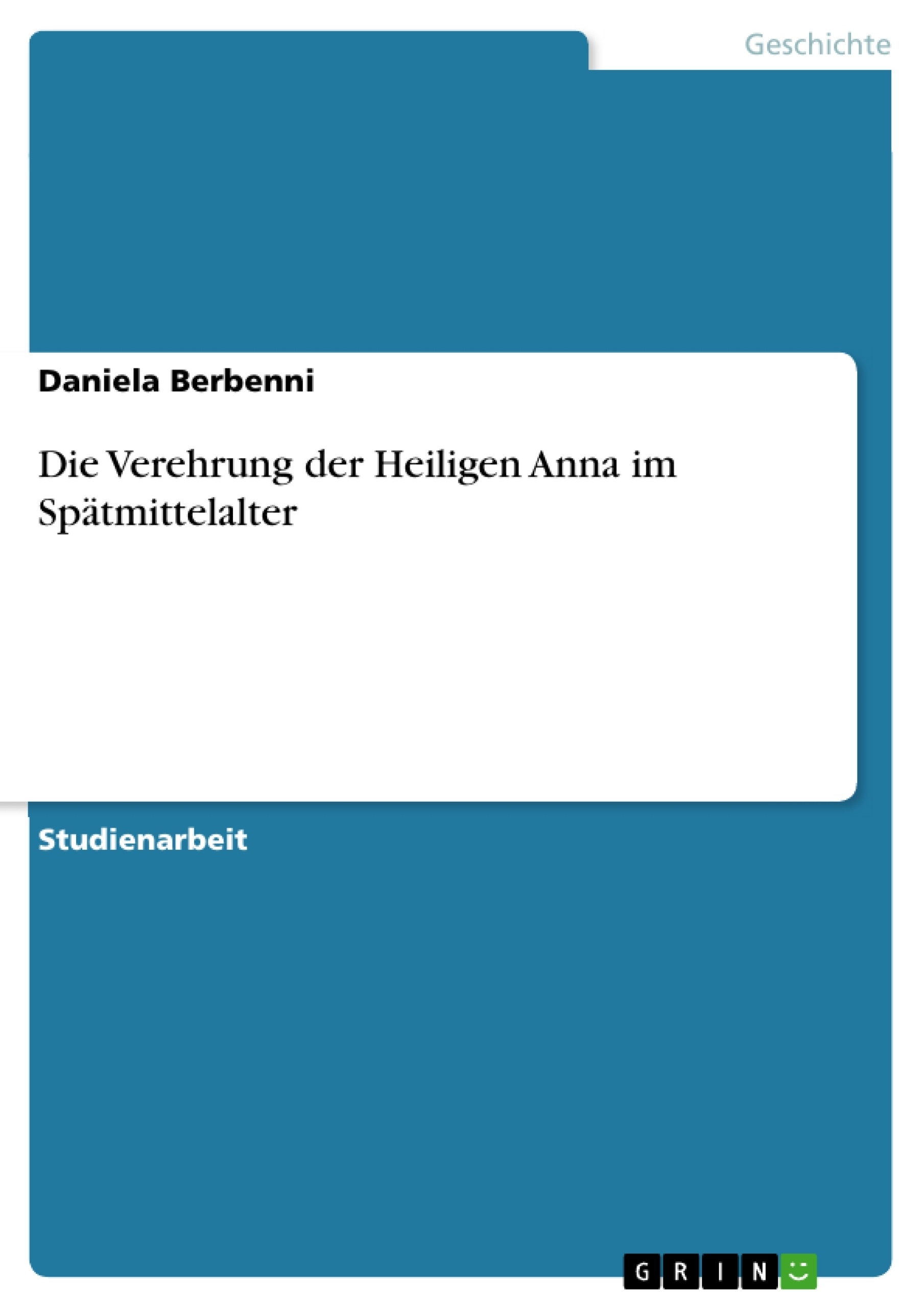Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, warum ausgerechnet die Verehrung der heiligen Anna um 1500 eine so starke Blüte erlebte. Unter diesem Leitaspekt werden weitere Fragen zu beantworten sein. Wer waren die sozialen Trägergruppen der Annenverehrung und was versprachen sich die Verehrer von der heiligen Großmutter? Warum fand ausgerechnet eine dreimal verheiratete Ehefrau und Mutter zu solcher Verehrung? Von der mittelalterlichen Kirche war die verheiratete Frau bis dahin kaum als religiöses Subjekt wahrgenommen worden und ihr Lebensraum wurde von Zeitgenossen in vielen Bereichen mit der Sünde in Verbindung gebracht.1
Der Aufbau der Arbeit ist ein deduktiver. Die Vorgehensweise vom Besonderen zum Allgemeinen soll am Beispiel der Annenverehrung strukturelle Merkmale und Veränderungen der Heiligenverehrung in dieser Zeit herausarbeiten und diese wiederum mit Rückgriff auf die vorhandene Forschungsliteratur diskutieren. In Kapitel 2.1. wird auf die Entstehung der Annenlegende eingegangen. Dann werden religiöse Rahmenbedingungen der Annenverehrung im 14. und 15. Jahrhundert darstellt (Kapitel 2.2.). Schwerpunkt wird hier der Streit um die unbefleckte Empfängnis Marias sein. Die folgenden zwei Kapiteln setzen sich mit Annenbruderschaften (Kapitel 2.3.) und Patrozinien (Kapitel 2.4.) der Heiligen auseinander, um so Rückschlüsse auf die soziale Trägerschaft der Annenverehrung und deren Bedürfnissen zu ziehen. Humanisten als Protagonisten der Annenverehrung werden in Kapitel 2.5. behandelt. In Kapitel 2.6. wird gezeigt, wie die Annenvita als Beispiel für ein glückliches Familienleben eine pädagogische Funktion einnimmt. In Kapitel 2.7. wird bezogen auf die Fragestellung auf das Thema Familie und Verwandtschaft im Spätmittelalter eingegangen. Im Kapitel 2.8. sollen die Merkmale und Veränderungen der Frömmigkeit um 1500 im Spiegel der Annenverehrung dargestellt werden. Zu diesem Zweck wird die vorliegende Forschungsliteratur genutzt, die sich in ihren Aussagen teilweise uneinheitlich präsentiert. Die verschiedenen Forschungsmeinungen werden darstellen und gegeneinander abgewogen. Im Schlussteil werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Fazit in Bezug auf die Forschungsfragen gestellt.
Die Arbeit konzentriert sich zeitlich auf das Spätmittelalter und beschränkt sich räumlich auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen. Regionale Unterschiede in diesem Bereich werden kurz angesprochen und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0. Einleitung
- 2.0. Hauptteil: Die Verehrung der Heilige Anna im Spätmittelalter
- 2.1. Entstehung der Annenlegende
- 2.2. Religiöse Rahmenbedingungen der Annenverehrung im 14. und 15. Jahrhundert
- 2.3. Annenbruderschaften
- 2.4. Patrozinien der heiligen Anna
- 2.5. Humanisten als Protagonisten der Annenverehrung
- 2.6. Annenvita von Jan van Denemarken als Beispiel für ein glückliches Familienleben
- 2.7. Familie und Verwandtschaft im Spätmittelalter
- 2.8. Frömmigkeit um 1500 im Spiegel der Annenverehrung
- 3.0. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die starke Blüte der Verehrung der Heiligen Anna um 1500 und befasst sich mit den sozialen Trägergruppen dieser Verehrung, ihren Motiven und dem besonderen Stellenwert der heiligen Großmutter. Die Arbeit untersucht, warum gerade eine dreimal verheiratete Ehefrau und Mutter zu solcher Verehrung gelangte, obwohl die mittelalterliche Kirche die verheiratete Frau kaum als religiöses Subjekt wahrnahm.
- Entstehung und Entwicklung der Annenlegende
- Soziale und religiöse Rahmenbedingungen der Annenverehrung
- Rolle von Bruderschaften und Patrozinien in der Annenverehrung
- Humanisten als Protagonisten der Annenverehrung
- Die Bedeutung der Annenvita für die Vorstellung vom Familienleben
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 beleuchtet die Entstehung der Annenlegende aus verschiedenen Überlieferungskreisen, die im Laufe der Zeit miteinander verknüpft wurden. Das Kapitel analysiert die Entwicklung der Annenvita von einer bloßen Mutter Marias hin zur eigenständigen Heiligen und Großmutter Christi.
Kapitel 2.2 untersucht die religiösen Rahmenbedingungen der Annenverehrung im 14. und 15. Jahrhundert. Hierbei wird der Fokus auf den Streit um die unbefleckte Empfängnis Marias gelegt, der die Annenverehrung stark beeinflusste.
Kapitel 2.3 und 2.4 analysieren Annenbruderschaften und Patrozinien. Diese dienen als wichtige Quellen, um die soziale Trägerschaft der Annenverehrung und ihre Bedürfnisse zu verstehen.
Kapitel 2.5 befasst sich mit den Humanisten als Protagonisten der Annenverehrung, während Kapitel 2.6 die Annenvita als Beispiel für ein glückliches Familienleben und ihre pädagogische Funktion untersucht.
Kapitel 2.7 beleuchtet das Thema Familie und Verwandtschaft im Spätmittelalter im Kontext der Annenverehrung, während Kapitel 2.8 die Merkmale und Veränderungen der Frömmigkeit um 1500 im Spiegel der Annenverehrung darstellt.
Schlüsselwörter
Heilige Anna, Spätmittelalter, Annenverehrung, Annenlegende, Annenvita, Familienleben, Frömmigkeit, Patrozinien, Bruderschaften, unbefleckte Empfängnis, Humanismus, soziale Trägergruppen.
- Quote paper
- Daniela Berbenni (Author), 2010, Die Verehrung der Heiligen Anna im Spätmittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263310