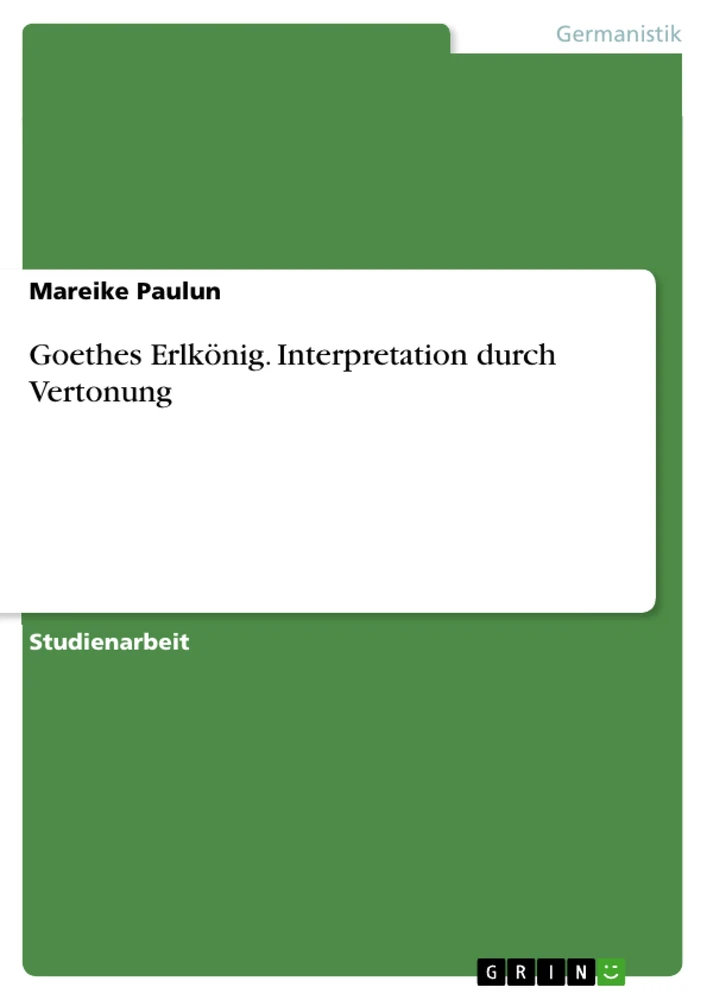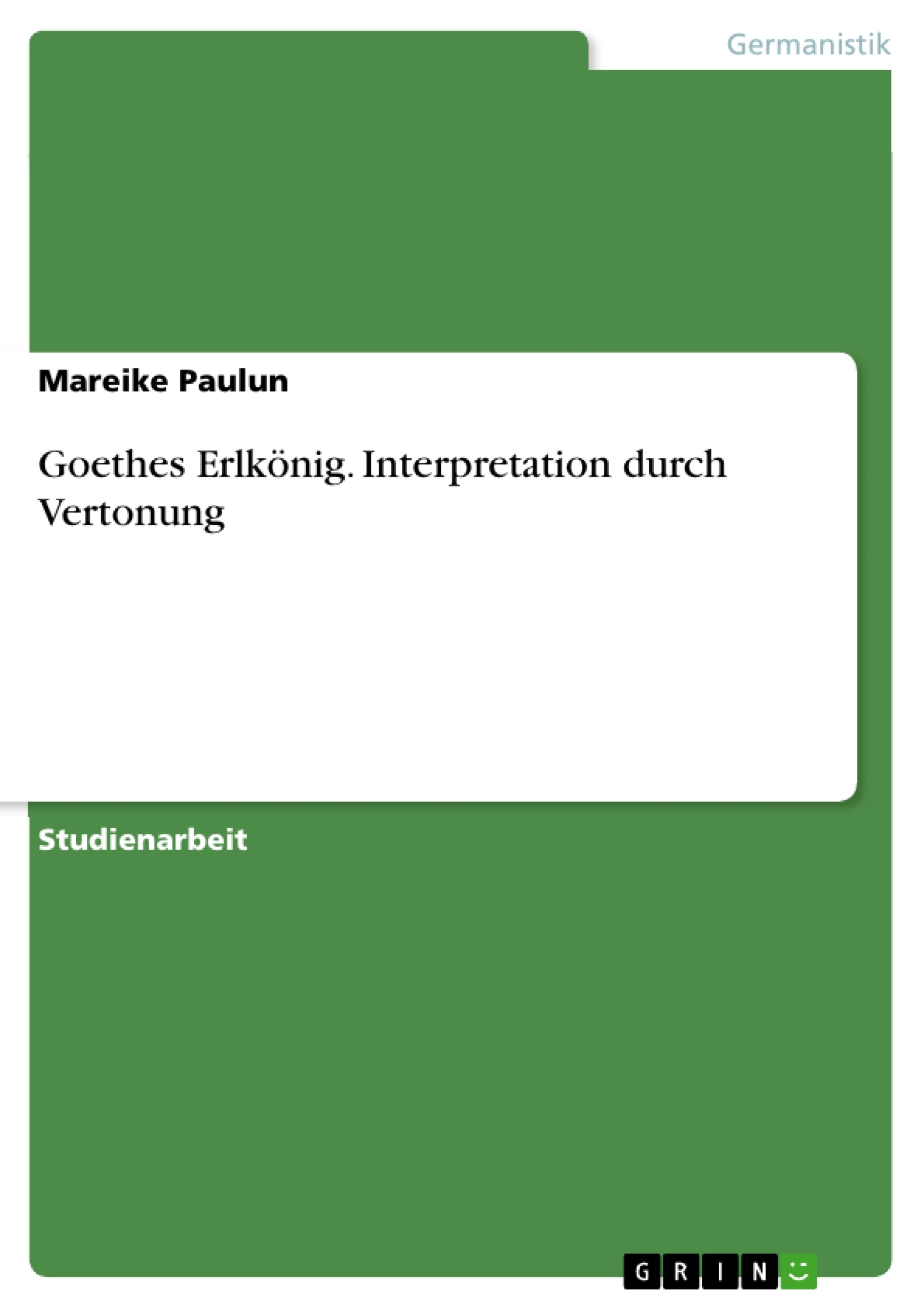Es werden die Erlkönig-Vertonungen von Zelterm Reichardt, Loewe und Schubert analysiert und interpretiert. Dabei werden (literatur-)historische und philosophische Strömungen und Aspekte mit einbezogen.
Goethes Erlkönig hat über Jahrhunderte hinweg einen Wirkungskreis erlangt, wie wohl kaum ein anderes lyrisches Werk: In vielfältiger Weise wurde es analysiert, interpretiert, karikiert und bot allerhand Stoff für psychoanalytische Deutungen. Nicht nur Literaten wurden von der Ballade zu Neu-, Um- und Weiterschöpfungen angeregt, auch und vor allem Komponisten fühlten sich von der lyrischen Arbeit Goethes inspiriert und machten sich daran, das Wesen der Ballade musikalisch einzufangen. So sind bis heute 131 Vertonungen des Erlkönig bekannt , viele Versionen vor allem von relativ unbekannten Musikern sind allerdings mittlerweile verschollen. Dennoch verfügt das erhaltene Repertoire noch immer über eine Vielzahl an sehr unterschiedlichen musikalischen Umsetzungen mitunter weltbekannter Persönlichkeiten, wie z.B. Schubert, Liszt oder Beethoven.
Aber nicht nur fühlten sich die Komponisten vom Erlkönig angezogen, Goethe selbst „suchte […] Künstler, denen er seine Gedichte anvertrauen konnte, damit sie diese durch die Musik erst vollendeten.“ So arbeitete Goethe während seiner Schaffungsperiode besonders mit Johann Friedrich Reichardt und Carl Friedrich Zelter zusammen, denen er viele seiner Werke zur Vertonung überließ, mit denen er teilweise neue Ideen und Texte entwickelte und mit denen ihn eine mitunter enge Freundschaft verband.
Goethe „war als Dichter vom Primat des Worts zutiefst überzeugt. Doch ein Gedicht vollendete sich in seinen Augen eigentlich erst, wenn man es vortrug, entweder rezitierend oder eben singend.“
Sieht oder hört man sich die einzelnen Vertonungen verschiedener Komponisten an, so fällt auf, dass die Ballade vielfältige musikalische Rahmenstrukturen versehen bekommen hat, die sich teilweise von Grund auf voneinander unterscheiden. Es soll von daher bei ausgewählten Musikwerken untersucht werden, welche Aspekte der Ballade auf welche Art und Weise wiedergegeben werden, welche ggf. unberücksichtigt blieben – und warum –, und welche Interpretation des Erlkönig sich daraus ableiten lässt. Für diese Untersuchung wurden aufgrund der starken persönlichen Bindung zu Goethe die Werke Reichardts und Zelters gewählt, sowie die Kompositionen Loewes und Schuberts, die damals wie heute als die besten Vertonungen des Erlkönig angesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe der ersten musikalischen Vertonung des Erlkönig von Corona Schröter
- Die Vertonung von Johann Friedrich Reichardt (1798)
- Reichardts Beziehung zu Goethe und zum Erlkönig
- Analyse der Vertonung
- Auswertung der Analyse
- Die Vertonung von Carl Friedrich Zelter (1807)
- Zelters Beziehung zu Goethe und zum Erlkönig
- Analyse der Vertonung
- Auswertung der Analyse
- Die Vertonung von Franz Schubert (1815)
- Schuberts Beziehung zu Goethe und zum Erlkönig
- Analyse der Vertonung
- Auswertung der Analyse
- Die Vertonung von Carl Loewe (1818)
- Loewes Beziehung zu Goethe und zum Erlkönig
- Analyse der Vertonung
- Auswertung der Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Vertonung von Goethes Erlkönig durch verschiedene Komponisten. Sie befasst sich mit den Hintergründen der jeweiligen Vertonungen, analysiert die musikalischen Elemente und untersucht, wie diese die Interpretation der Ballade beeinflussen.
- Die Beziehung zwischen den Komponisten und Goethe
- Der Einfluss des historischen und philosophischen Kontextes auf die Vertonungen
- Die unterschiedlichen Interpretationen des Erlkönig durch die Musik
- Die Rolle der Musik in der Vermittlung von Emotionen und Bedeutung
- Die Rezeption des Erlkönig in der Musikgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Goethes Erlkönig als ein Werk mit großer kultureller Bedeutung vor und skizziert den historischen Kontext der verschiedenen Vertonungen. Sie beleuchtet auch Goethes eigene Sicht auf die Vertonung seiner Werke.
Das zweite Kapitel widmet sich den Hintergründen der ersten Vertonung durch Corona Schröter. Es beschreibt ihre Beziehung zu Goethe und den Einfluss ihrer volksliedhaften Interpretation auf die weitere Entwicklung des Erlkönig in der Musik.
Die Kapitel drei und vier analysieren die Vertonungen von Johann Friedrich Reichardt und Carl Friedrich Zelter. Es werden ihre Beziehungen zu Goethe, ihre individuellen musikalischen Stilmittel und die Interpretation des Erlkönig in ihren Kompositionen beleuchtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Vertonung von Franz Schubert, die als besonders einflussreich gilt. Es beleuchtet Schuberts Beziehung zu Goethe, die musikalischen Besonderheiten seiner Komposition und die Interpretation des Erlkönig in seinem Werk.
Das sechste Kapitel analysiert die Vertonung von Carl Loewe, die ebenfalls eine wichtige Rolle in der Musikgeschichte des Erlkönig spielt. Es beleuchtet Loewes Beziehung zu Goethe, die musikalischen Eigenheiten seiner Komposition und die Interpretation des Erlkönig in seinem Werk.
Schlüsselwörter
Goethe, Erlkönig, Vertonung, musikalische Analyse, Interpretation, Beziehung, historische Kontext, Corona Schröter, Johann Friedrich Reichardt, Carl Friedrich Zelter, Franz Schubert, Carl Loewe.
- Quote paper
- Mareike Paulun (Author), 2013, Goethes Erlkönig. Interpretation durch Vertonung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263309