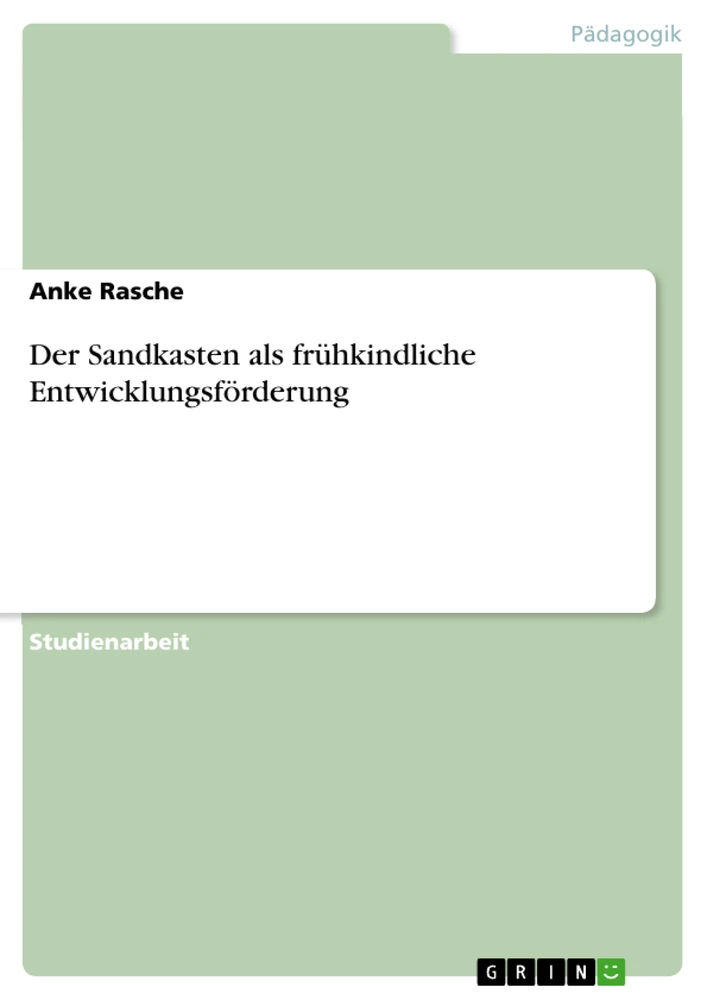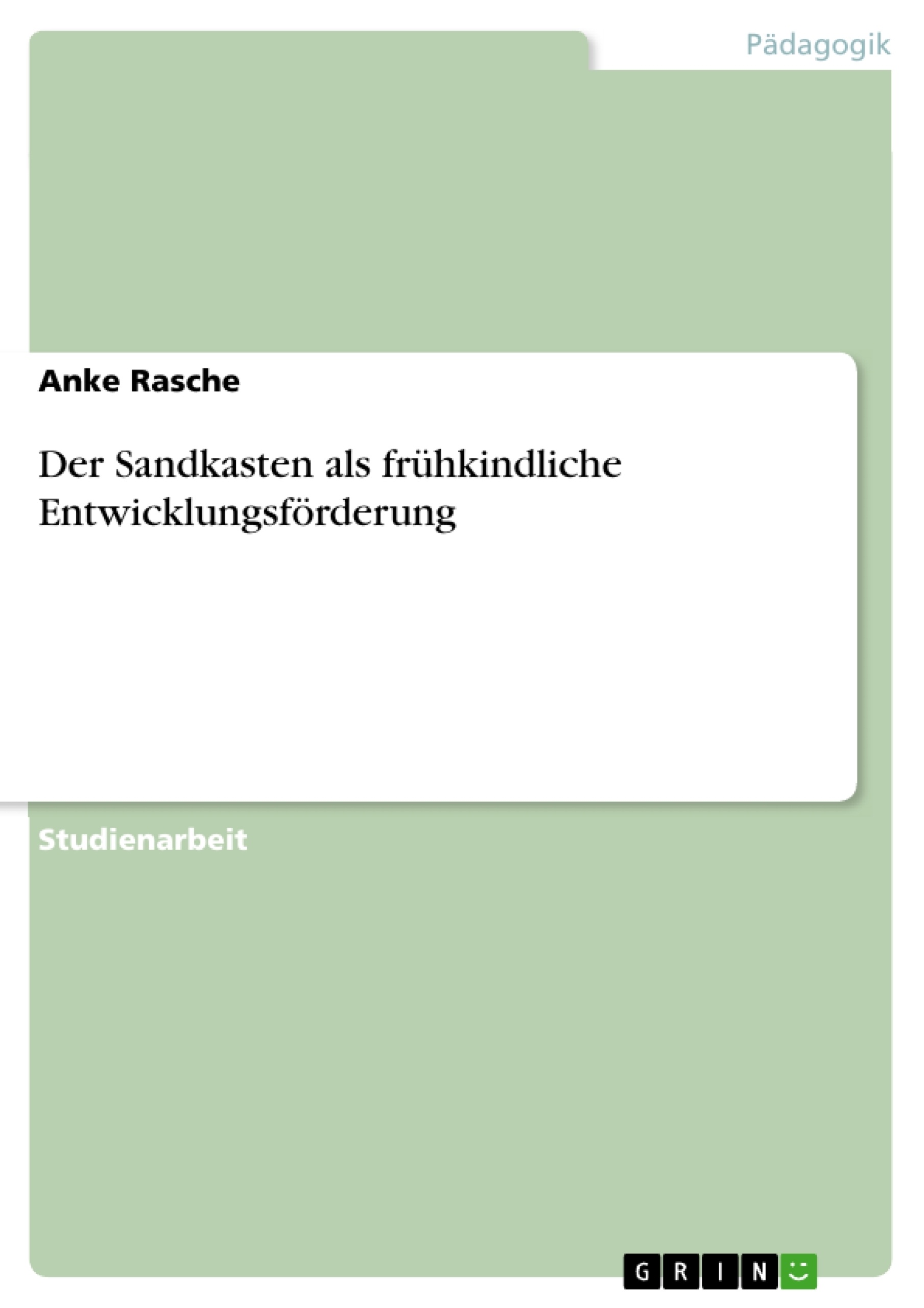Wenn gegenwärtig vom Spielen die Rede ist, glauben die meisten Menschen genau zu wissen, was damit gemeint ist: eine mit positiven Gefühlen begleitete Beschäftigung in der Freizeit. Das Wort „Spiel“ wird im Alltag nicht gerade selten gebraucht, doch nur wenige können genau die Merkmale des Spiels aufzählen.
Eines dieser Merkmale ist die Freiwilligkeit – Man kann kein Kind und keine Person zum Spielen zwingen. Das Spiel stellt also eine Handlung dar, die intrinsisch motiviert ist, also frei von den beteiligten Personen ausgeübt und selbst bestimmt wird. Ein weiteres Merkmal ist, dass es sich auch immer um ein „aktives Geschehen“ (Mogel, 1994, S.34) handelt. Der Spieler an sich ist hierbei gleichzeitig der Akteur. Er muss das Spiel aktiv beginnen und kann erst dann etwas passiver das laufende Geschehen beobachten; nur der Spieler selbst kann das Spiel auch beenden. Oft wechseln sich Aktivität und Passivität in einem Spiel ab, in dem der Spieler bzw. der Akteur die Fäden in der Hand hat. Zudem ist das Ziel des Spiels die Handlung selbst, also der Spielprozess an sich, das heißt es ist frei „von äußeren … Zwecksetzungen“ (Hegemann-Fonger, 1994, S.5) und nicht so stark auf ein Spielergebnis orientiert. Dennoch unterscheiden sich diese Handlungen von dem normalen Leben, da sie in einem fiktionalen Raum stattfinden, im Sinne von So-tun-als-ob und mehr oder weniger geregelt und geordnet sind (vgl. Konrad / Schultheis, 2008).
Inhaltsverzeichnis
- Formale Kennzeichen und Bedeutung des Spiels
- Formen des Sandspiels
- Phantasie- und Rollenspiel
- Das Bauspiel
- Aktivierungszirkel
- Warum spielen Kinder?
- Aktivierungszirkel des Sandspiels
- Förderung der kindlichen Entwicklung
- Förderung des Spiels an sich
- Sandspieltherapie
- Weitere Anwendungsgebiete von Sand
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Bedeutung des Sandkastens als Mittel zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung. Er beleuchtet die formalen Kennzeichen und die Bedeutung des Spielens im Allgemeinen, wobei insbesondere die Freiwilligkeit, die Aktivität und die Zweckfreiheit des Spielprozesses hervorgehoben werden. Des Weiteren werden verschiedene Formen des Sandspiels, wie Phantasie- und Rollenspiele sowie Bauspiele, analysiert und in den Kontext der kindlichen Entwicklung eingeordnet.
- Die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung
- Verschiedene Spielformen im Sandkasten
- Der Sandkasten als Werkzeug zur Förderung der Phantasie, Kreativität und sozialen Kompetenzen
- Die Rolle des Sandspiels in der Sandspieltherapie
- Weitere Anwendungsgebiete von Sand
Zusammenfassung der Kapitel
1. Formale Kennzeichen und Bedeutung des Spiels
Dieses Kapitel definiert das Spiel als eine freiwillige und intrinsisch motivierte Handlung, die von den beteiligten Personen selbst bestimmt wird. Es wird betont, dass das Spiel ein aktives Geschehen ist, bei dem der Spieler gleichzeitig der Akteur ist. Zudem wird die Zweckfreiheit des Spielprozesses hervorgehoben, der sich von den Zwecken des Alltagslebens unterscheidet. Weitere wichtige Merkmale des Spiels sind die Spielfreude, der „Moment der Geschlossenheit“ und der „Moment der inneren Unendlichkeit“. Der Text beleuchtet die immense Bedeutung von Spielen für Kinder, die ihre Probleme verarbeiten, ihre Grenzen kennenlernen, soziale Kontakte knüpfen und ihre Phantasie weiterentwickeln können.
2. Formen des Sandspiels
Dieses Kapitel stellt verschiedene Spielformen vor, die im Laufe der kindlichen Entwicklung auftreten, wobei das Phantasie- und Rollenspiel sowie das Bauspiel im Kontext des Sandspiels besonders relevant sind. Es wird erläutert, wie diese Spielformen die symbolische und imaginative Entwicklung des Kindes fördern.
2.1. Phantasie- und Rollenspiel
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Symbolspiel, bei dem Gegenstände ihre eigentliche Bedeutung verlieren und zu neuen, fiktiven Gegenständen werden. Es werden verschiedene Synonyme für das Phantasiespiel, wie Illusionsspiel, Imaginationsspiel und Fiktionsspiel, erläutert und die Bedeutung des symbolischen Denkens für die Entwicklung der kindlichen Phantasie hervorgehoben. Der Text beschreibt, wie Kinder beim Sandspielen Gegenstände und Situationen imaginär verändern und mit ihrer Phantasie neue Realitäten erschaffen. Die Rolle von Rollenspielen und Nachahmungshandlungen im Sandspiel wird ebenfalls beleuchtet.
2.2. Das Bauspiel
Dieser Abschnitt beschreibt die Verknüpfung von Bauspielen mit Phantasiespielen. Es wird erläutert, wie Kinder beim Bauen von Häusern oder Landschaften ihre Fantasie und Kreativität ausleben und diese Bauten als Kulissen für ihre Rollenspiele nutzen. Der Text hebt die Zweckfreiheit des Bauspiels hervor, die jedoch nicht ganz gegeben ist, da das Bauen von Häusern einen bestimmten Zweck verfolgt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: Sandspiel, frühkindliche Entwicklung, Phantasie, Kreativität, Spiel, Symbolspiel, Rollenspiel, Bauspiel, Sandspieltherapie, Aktivierungszirkel, Zweckfreiheit, Freiwilligkeit, Aktivität, Imagination, So-tun-als-ob.
- Quote paper
- Anke Rasche (Author), 2010, Der Sandkasten als frühkindliche Entwicklungsförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263163