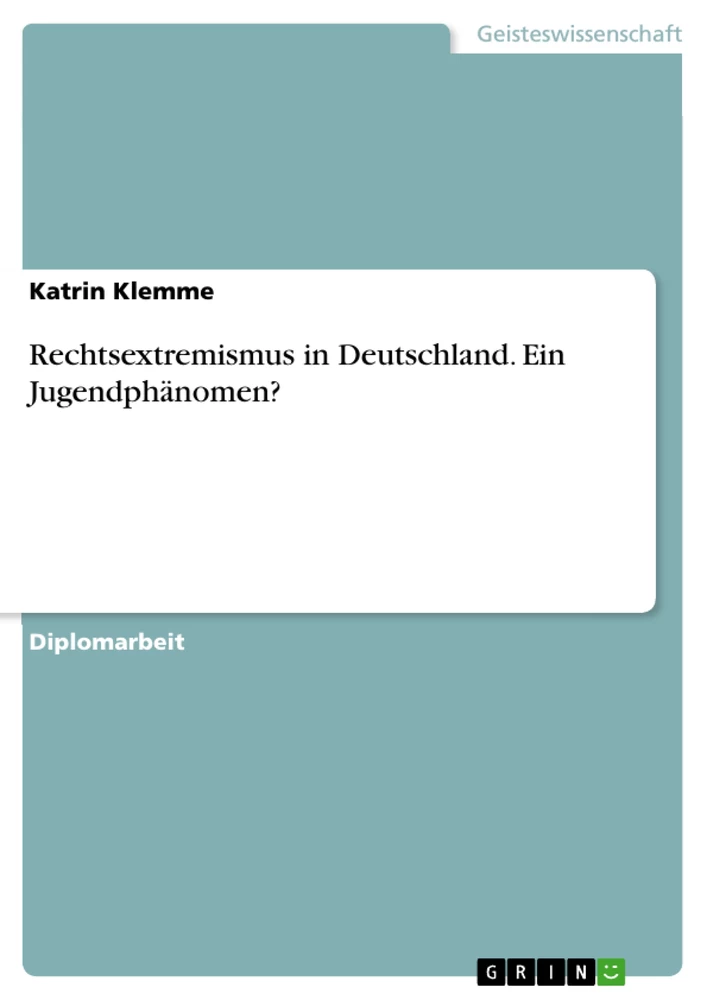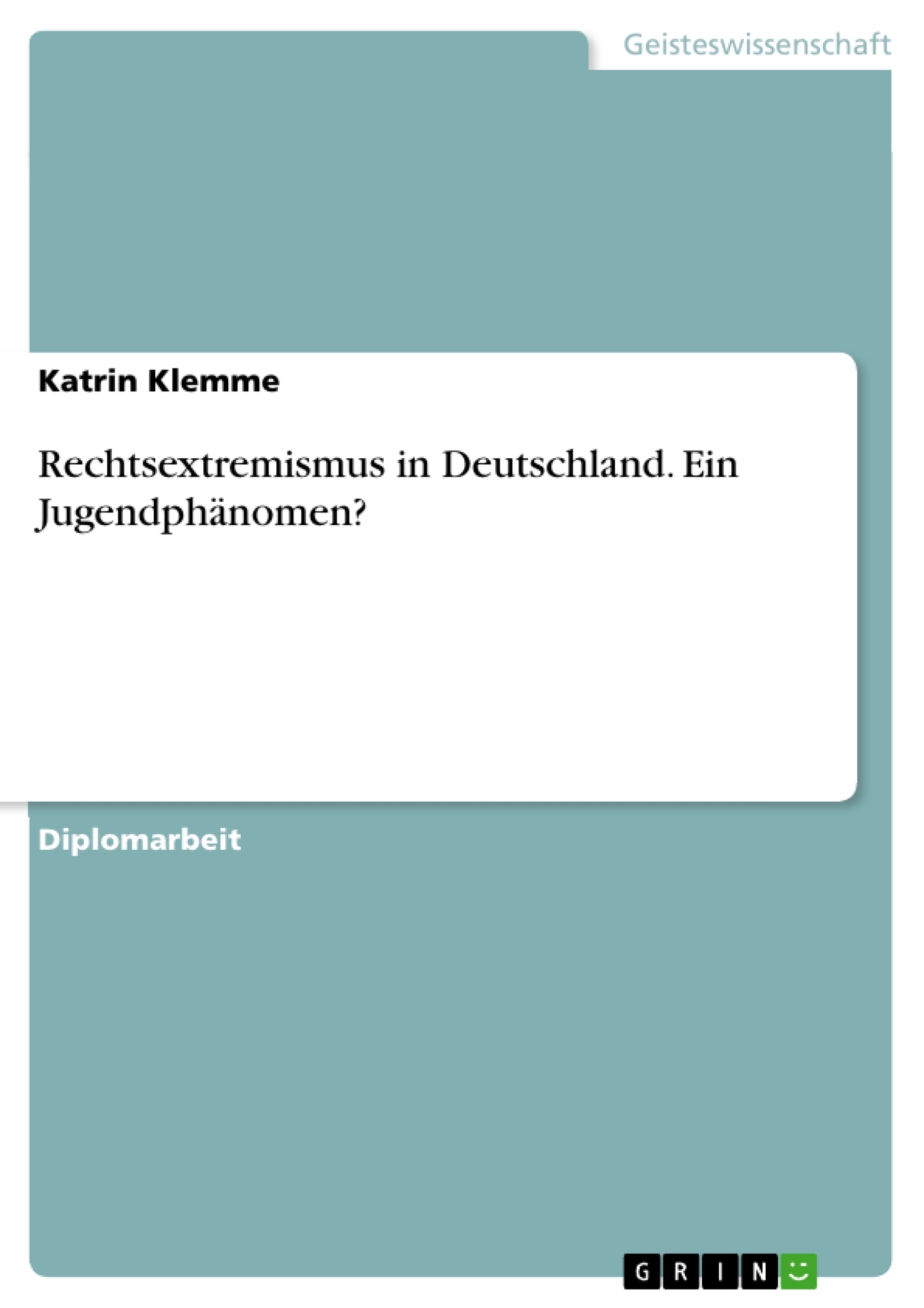Meldungen über fremdenfeindliche, rassistische bzw. antisemitische Taten sind inzwischen nahezu täglicher Bestandteil der Medienberichtserstattung. Dies betrifft vor allem rechtsextremistische Taten, bei denen Personen verletzt wurden bzw. starben. Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten hat bis 2000 zugenommen. Die meisten Gewalttaten richteten sich zu diesem Zeitpunkt gegen Fremde. Einen regionalen Schwerpunkt stellen hierbei die ostdeutschen Bundesländer dar. Dort konzentriert sich nach Aussage des VERFASSUNGSSCHUTZBERICHTES auch die Hälfte des Personenpotentials rechtsextremer Skinheads und anderer gewaltbereiter Rechtsextreme. Während 2000 der VERFASSUNGSSCHUTZBERICHT einen Rückgang des Personenpotentials insgesamt verzeichnet hat, ist die Anzahl der gewaltbereiten Rechtsextremen in den ostdeutschen Ländern weiter gestiegen; die Ursache soll hierbei beim Zulauf zur rechten Skinheadszene liegen. Nicht selten wird Rechtsextremismus als ein Problem von Jugendlichen dargestellt. Nach VERFASSUNGSSCHUTZBERICHT wurden gut 2/3 der Straftaten mit erwiesenem oder vermutetem rechtsextremistischen Hintergrund von Jugendlichen und Heranwachsenden begangen. Als Ursachen werden hierbei eine Verschärfung der sozialen der psychischen Deprivation im unteren Drittel unserer Gesellschaft angeführt, die zum Entstehen von Rechtsextremismus beitragen; die logische Schlussfolgerung hieraus wäre, Rechtsextremismus als eine Reaktion der unteren Schichten zu deuten. Ein Blick in die Statistik des BKA verdeutlicht aber, dass eine solche Schlussfolgerung dem Phänomen Rechtsextremismus nicht gerecht wird; anhand der Berufsstruktur von rechtsextremen Tätern bzw. mit vermutetem rechtsextremen Hintergrund lässt sich erkennen, dass 1992 43% der Täter Schüler, Studenten oder Auszubildende, 31 % Facharbeiter und Handwerker und 9 % Angestellte waren. Lediglich 9 % waren arbeitslos und 1 % ungelernte Arbeiter. Daher möchte ich im folgenden Verlauf meiner Arbeit der Frage nachgehen, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen sowie individuellen Bedingungen rechtsextreme Einstellungen und rechtsextrem motivierte Gewalt begünstigen können. Hierbei werde ich im allgemeinen auf die Zielgruppe Jugendliche und im speziellen auf Skinheads eingehen. Abschließend werde ich mich mit der bedeutsamsten sozialarbeiterischen Methode in der Arbeit mit Rechtsextremen, der „Akzeptierenden Jugendarbeit“, befassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserläuterung
- 2.1 Rechtsextremismus
- 2.2 Jugendlicher Rechtsextremismus
- 2.3 Fremdenfeindlichkeit
- 2.4 Gewaltbereiter Rechtsextremismus
- 3. Rechtsextremismus – Ein Jugendphänomen?
- 3.1 Jugendphase
- 3.1.1 Anforderungen an Jugendliche
- 3.1.2 Regionale Unterschiede
- 3.1.3 Schwerpunkt Ostdeutschland
- 3.2 Skinheads
- 3.2.1 Jugendliche Subkultur
- 3.2.2 Funktion von Subkultur
- 3.2.3 Deprivations- und Desintegrationstheorie
- 3.2.4 Selbstwirksamkeitserleben
- 3.2.5 Milieuzugehörigkeit
- 3.3 Studie „Jugend 90“
- 3.3.1 Vorstellung
- 3.3.2 Rechtsextremismus als Wohlstands- und Dominanzkultur
- 3.4 Identitätstheorie
- 3.5 Modernisierungsgegner
- 3.1 Jugendphase
- 4. Soziale Arbeit mit Jugendlichen Rechtsextremen
- 4.1 Am Beispiel der „Akzeptierenden Jugendarbeit“
- 4.1.1 Integratives Methodenverständnis
- 4.1.2 Einordnung des Konzeptes
- 4.2 Rechtliche Grundlagen
- 4.3 Bewertung des Projektes „Akzeptierende Jugendarbeit“
- 4.1 Am Beispiel der „Akzeptierenden Jugendarbeit“
- 5. Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die soziologischen und psychologischen Ursachen rechtsextremer Einstellungen in Deutschland, insbesondere im Kontext des sozialen Wandels und des Wohlstands im 21. Jahrhundert. Sie analysiert den Einfluss dieser Einstellungen auf die soziale Arbeit mit betroffenen Jugendlichen.
- Analyse rechtsextremer Einstellungen und deren Ursachen
- Rechtsextremismus als Jugendphänomen
- Die Rolle von Subkulturen wie Skinheads
- Soziale Arbeit mit rechtsextrem eingestellten Jugendlichen
- Bewertung von präventiven Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den aktuellen Stand der Forschung zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland, beleuchtet die Zunahme rechtsextremistisch motivierter Straftaten und Gewalttaten, insbesondere gegen Ausländer, und hebt regionale Unterschiede hervor, wobei Ostdeutschland als Schwerpunkt genannt wird. Der Fokus auf Jugendliche als Hauptgruppe der Täter wird thematisiert und die Diskussion über Ursachen und Bekämpfung von Rechtsextremismus in den Medien wird angesprochen. Es wird die Frage aufgeworfen, welche sozialen, wirtschaftlichen und individuellen Faktoren rechtsextreme Einstellungen und Gewalt begünstigen.
2. Begriffserläuterung: Dieses Kapitel liefert klare Definitionen zentraler Begriffe wie Rechtsextremismus, Jugendlicher Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und gewaltbereiter Rechtsextremismus. Es schafft eine fundierte Grundlage für die weitere Analyse, indem es die verschiedenen Facetten des Rechtsextremismus differenziert darstellt und die jeweiligen Definitionen aus der Literatur einordnet. Dies ist essentiell um den weiteren Kontext der Arbeit zu verstehen.
3. Rechtsextremismus – Ein Jugendphänomen?: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Frage, inwieweit Rechtsextremismus ein Jugendphänomen darstellt. Es untersucht die spezifischen Herausforderungen und Anforderungen an Jugendliche, regionale Unterschiede, den Schwerpunkt Ostdeutschlands, und die Rolle von Skinhead-Subkulturen. Die Analyse umfasst Theorien wie die Deprivations- und Desintegrationstheorie sowie den Aspekt der Selbstwirksamkeit und Milieuzugehörigkeit. Die Kapitel beschreibt auch die Studie "Jugend 90" und die Identitätstheorie in diesem Kontext.
4. Soziale Arbeit mit Jugendlichen Rechtsextremen: Dieses Kapitel widmet sich der sozialen Arbeit mit rechtsextrem eingestellten Jugendlichen, am Beispiel der „Akzeptierenden Jugendarbeit“. Es analysiert das integrative Methodenverständnis, ordnet das Konzept ein und beleuchtet die rechtlichen Grundlagen. Abschließend bewertet es das Projekt „Akzeptierende Jugendarbeit“ bezüglich seiner Wirksamkeit und seiner Grenzen. Die Kapitel erläutert die methodischen Ansätze und die rechtlichen Rahmenbedingungen der sozialen Arbeit in diesem Bereich.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Jugendlicher Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Skinheads, Subkultur, Soziale Arbeit, Prävention, Ostdeutschland, Identität, Soziale Deprivation, Desintegration, Akzeptierende Jugendarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Rechtsextremismus und Jugend
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die soziologischen und psychologischen Ursachen rechtsextremer Einstellungen in Deutschland, insbesondere bei Jugendlichen. Sie analysiert den Einfluss dieser Einstellungen auf die soziale Arbeit und bewertet präventive Maßnahmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definitionen von Rechtsextremismus (inkl. Jugendlicher Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit), Rechtsextremismus als Jugendphänomen (inkl. Rolle von Skinhead-Subkulturen und regionaler Unterschiede, insbesondere in Ostdeutschland), Theorien zur Erklärung rechtsextremer Einstellungen (Deprivations- und Desintegrationstheorie, Identitätstheorie), und die soziale Arbeit mit rechtsextrem eingestellten Jugendlichen, insbesondere am Beispiel der „Akzeptierenden Jugendarbeit“.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Literaturanalyse, um die verschiedenen Facetten des Rechtsextremismus zu beleuchten und Theorien zu analysieren. Die „Akzeptierende Jugendarbeit“ wird als Fallbeispiel untersucht, um die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen zu bewerten. Die Arbeit stützt sich auf vorhandene Studien und Literatur, um eine umfassende Analyse zu ermöglichen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit liefert eine umfassende Darstellung der Ursachen und Ausprägungen rechtsextremer Einstellungen bei Jugendlichen in Deutschland. Sie analysiert die Rolle von Subkulturen, soziale Faktoren und individuelle Motivationen. Die Bewertung der „Akzeptierenden Jugendarbeit“ liefert Einblicke in die Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen in der sozialen Arbeit.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Rechtsextremismus, Jugendlicher Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Skinheads, Subkultur, Soziale Arbeit, Prävention, Ostdeutschland, Identität, Soziale Deprivation, Desintegration, Akzeptierende Jugendarbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffserklärung, Rechtsextremismus als Jugendphänomen, Soziale Arbeit mit Jugendlichen Rechtsextremen und abschließende Gedanken. Jedes Kapitel baut auf den vorherigen auf und trägt zur Gesamtbetrachtung des Themas bei. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sozialarbeiter, Pädagogen, Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus und Jugend auseinandersetzen. Sie bietet wichtige Einblicke in die Ursachen, Auswirkungen und mögliche Gegenstrategien.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das vollständige Dokument enthält ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen und eine detaillierte Literaturliste. (Hinweis: Diese Informationen sind im bereits bereitgestellten HTML-Code enthalten.)
- Quote paper
- Katrin Klemme (Author), 2001, Rechtsextremismus in Deutschland. Ein Jugendphänomen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263