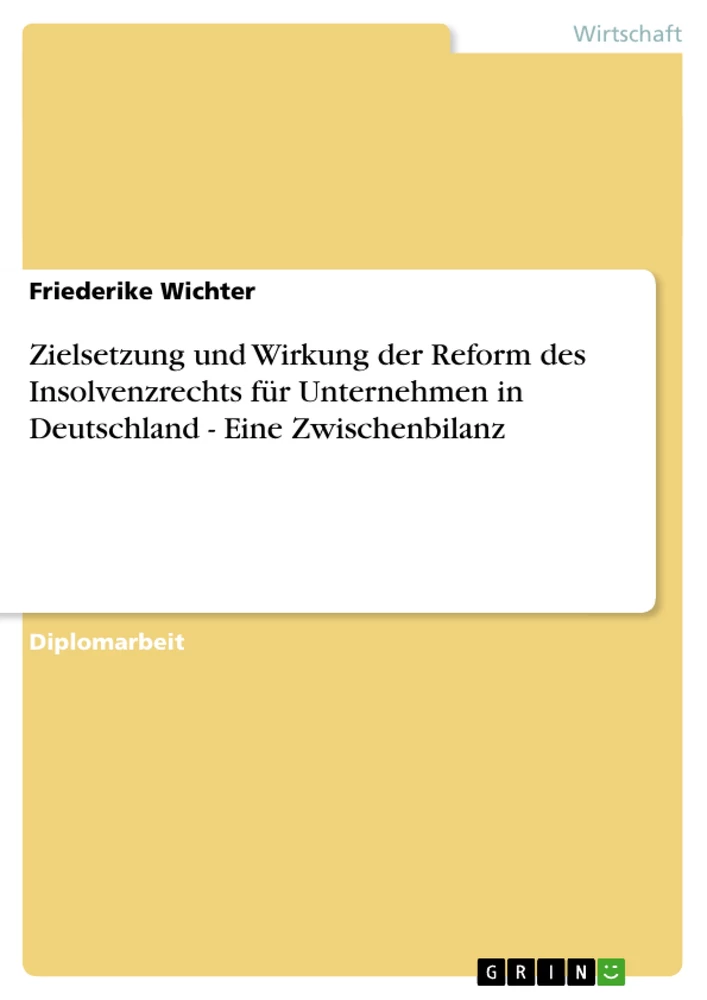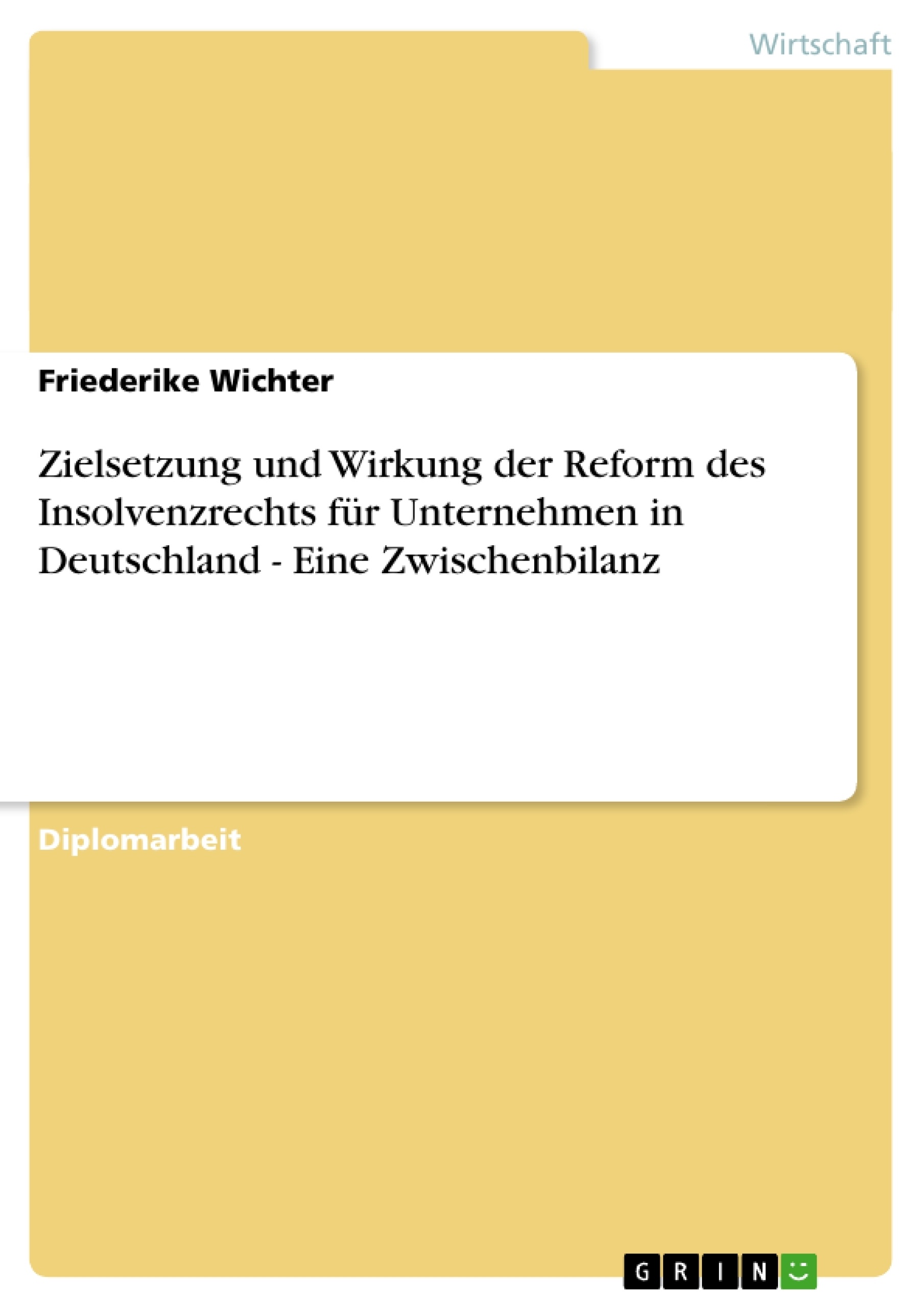Das Insolvenzrecht in Deutschland war von einer langen Kontinuität geprägt, bis die Insolvenzordnung im Jahr 1999 an die Stelle der Konkursordnung (KO) von 1877 und der Vergleichsordnung (VglO) von 1935 in Kraft getreten ist. Die Insolvenzordnung beinhaltet grundlegende Änderungen gegenüber ihren Vorgängergesetzen, die nur für einen Bruchteil der Unternehmenszusammenbrüche ein geordnetes Insolvenzverfahren vorsahen und keinen Beitrag zur Sanierung volkswirtschaftlich erhaltungswürdiger Betriebe beisteuerten. Mit dem neuen Insolvenzrecht sollten diese Defizite aus Konkurs- und Vergleichsordnung beseitigt werden. Nach fünf Jahren Insolvenzpraxis unter den neuen Insolvenzbestimmungen ist es nun von Interesse zu untersuchen, inwieweit die angestrebten Reformziele tatsächlich umgesetzt worden sind. Die Insolvenzordnung umfasst sowohl den Unternehmenssektor als auch die Verbraucherseite, wobei diese Arbeit ausschließlich auf Unternehmen ausgerichtet ist.
Das zunächst juristisch bezogene Themengebiet wird unter ökonomischen Gesichtspunkten analysiert, d. h. konkret, es wird eine Betrachtung des Insolvenzrechts unter ökonomisch relevanten Zielsetzungen angestellt. Deshalb werden eingangs die ökonomischen Grundlagen des Insolvenzrechts erläutert. Dabei stellt sich die mehr rechts- und wirtschaftspolitische Frage, welche verschiedenen Ausgestaltungen und Schwerpunkte das Insolvenzregime begründen soll.
Daraufhin werden dann sowohl die Kritikpunkte am alten Insolvenzrecht als auch die daraus resultierenden Reformgesetze und damit verbundenen Ziele der neuen Insolvenzordnung detailliert angeführt. Weiterhin findet über die Schilderung der veränderten Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung des neuen Rechts eine Bezugnahme zu den ökonomischen Grundlagen statt.
Nach der Beschreibung der neuen Regelungen in der Insolvenzordnung werden zum Schluss die Veränderungen in der Insolvenzpraxis herausgearbeitet, die sich aufgrund der Reformgesetze eingestellt haben. Es wird untersucht, ob eine erfolgreiche Umsetzung der angestrebten Verbesserungen in der Realität stattgefunden hat. Anhand von deskriptiven Statistiken und Umfragen kann schließlich eine Zwischenbilanz aufgestellt werden, die zeigt, dass die Ziele der Insolvenzrechtsreform größtenteils wegen der Organisation des deutschen Finanzsystems bisher nicht erreicht werden konnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Problemstellung
- 2 Ökonomische Grundlagen des Insolvenzrechts
- 2.1 Begründung und allgemeine Funktion des Insolvenzrechts
- 2.2 Die Ziele
- 2.2.1 Das Ex post Ziel der maximalen Werterhaltung durch effiziente Verwertung
- 2.2.2 Das Interim Ziel als optimale Terminierung der Verfahrensauslösung
- 2.2.3 Das Ex ante Ziel der Disziplinierungswirkung
- 2.3 Der Trade off zwischen den Zielen - Weiches vs. hartes Insolvenzregime
- 3 Die Insolvenzrechtsreform in Deutschland
- 3.1 Vom Erkennen einer Reformbedürftigkeit zur Gesetzesänderung
- 3.2 Die Mängel der alten Konkurs- und Vergleichsordnung
- 3.2.1 Das Problem der wenigen Eröffnungen von Insolvenzverfahren und der geringen Konkursquoten
- 3.2.1.1 Unzureichende Insolvenztatbestände
- 3.2.1.2 Aus- und Absonderungsrechte
- 3.2.1.3 Konkursvorrechte
- 3.2.1.4 Regelung und Verteilung der Verfahrenskosten
- 3.2.2 Die Bedeutungslosigkeit der Vergleichsordnung als Konsequenz der Zerschlagungsautomatik
- 3.2.2.1 Fehlendes integriertes Reorganisationsverfahren
- 3.2.2.2 Verspätete Antragstellung
- 3.2.2.3 Sicherungsrechte
- 3.2.2.4 Bevorrechtigte Fiskal- und Arbeitnehmeransprüche
- 3.2.2.5 Rechtsstellung und Kompetenz des Konkursverwalters
- 3.3 Die Ziele und Maßnahmen der neuen Insolvenzordnung
- 3.3.1 Die Insolvenzordnung als Reformgesetz
- 3.3.2 Die Bekämpfung der Massearmut mittels Vorverlegung der Antragstellung
- 3.3.2.1 Reform der Insolvenztatbestände
- 3.3.2.2 Eigenverwaltung
- 3.3.2.3 Subsidiäre Verfahrenskostenhaftung
- 3.3.2.4 Restschuldbefreiung
- 3.3.3 Weitere Bestimmungen zur Masseanreicherung
- 3.3.3.1 Der (vorläufige) Insolvenzverwalter und die Behandlung von Sicherungsgütern
- 3.3.3.2 Verschärfung der Rückschlagsperre und der Anfechtung
- 3.3.3.3 Neustrukturierung der Gläubigergruppen
- 3.3.3.4 Deckung der Verfahrenskosten
- 3.3.3.5 Einbeziehung des Neuerwerbs
- 3.3.4 Die Gestaltung eines marktkonformen Insolvenzgesetzes
- 3.3.5 Das vereinheitlichte Insolvenzrecht - Gleichstellung der Sanierung gegenüber der Liquidation
- 4 Die Entwicklung der Insolvenzpraxis unter Berücksichtigung der Reformziele
- 4.1 Die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen seit der Reform unter statistikrelevanten Aspekten
- 4.2 Die Anzahl der Verfahrenseröffnungen
- 4.2.1 Zunahme der Eröffnungsquote von Insolvenzverfahren
- 4.2.2 Gründe für den Anstieg der eröffneten Verfahren
- 4.2.2.1 Mangelnde Vorverlegung der Verfahrensanträge
- 4.2.2.2 Anwendung der Bestimmungen zur Masseanreicherung
- 4.2.3 Verteilung der Masse an die Gläubiger
- 4.3 Die Umsetzung der Marktkonformität
- 4.3.1 Anzeichen gestärkter Gläubigerautonomie
- 4.3.2 Zunehmende Bedeutung von gerichtlichen Sanierungen?
- 4.3.2.1 Schattendasein des Insolvenzplans in der Praxis
- 4.3.2.2 Zweckmäßigkeit eines integrierten Reorganisationsverfahrens im deutschen Banken- und Insidersystem
- 4.3.2.3 Der Fall Herlitz als Musterbeispiel einer Sanierung mit Insolvenzplan
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
- Analyse der Ziele und Maßnahmen der Insolvenzrechtsreform
- Bewertung der Auswirkungen der Reform auf die Praxis
- Untersuchung der Effizienz und Gläubigerfreundlichkeit des Insolvenzverfahrens
- Bedeutung der Eigenverwaltung und des Insolvenzplans
- Herausforderungen und Chancen der Insolvenzrechtsreform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Reform des Insolvenzrechts in Deutschland und untersucht deren Zielsetzung und Auswirkungen auf die Praxis. Im Fokus steht dabei die Frage, ob die Reform zu einer Steigerung der Effizienz und der Gläubigerfreundlichkeit des Insolvenzverfahrens geführt hat.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung, die den Kontext der Insolvenzrechtsreform in Deutschland beschreibt. Anschließend werden die ökonomischen Grundlagen des Insolvenzrechts beleuchtet, wobei die wichtigsten Ziele und Funktionen des Insolvenzrechts im Fokus stehen. Das dritte Kapitel beleuchtet die Insolvenzrechtsreform selbst, indem es die Mängel der alten Konkurs- und Vergleichsordnung aufzeigt und die Ziele und Maßnahmen der neuen Insolvenzordnung analysiert. Das vierte Kapitel untersucht die Entwicklung der Insolvenzpraxis unter Berücksichtigung der Reformziele. Hierbei werden die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen seit der Reform, die Anzahl der Verfahrenseröffnungen und die Umsetzung der Marktkonformität betrachtet.
Schlüsselwörter
Insolvenzrecht, Unternehmensinsolvenz, Reform, Ziele, Effizienz, Gläubigerfreundlichkeit, Eigenverwaltung, Insolvenzplan, Sanierung, Liquidation, Marktkonformität, Praxis, Entwicklung, Statistik
- Quote paper
- Friederike Wichter (Author), 2004, Zielsetzung und Wirkung der Reform des Insolvenzrechts für Unternehmen in Deutschland - Eine Zwischenbilanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26291