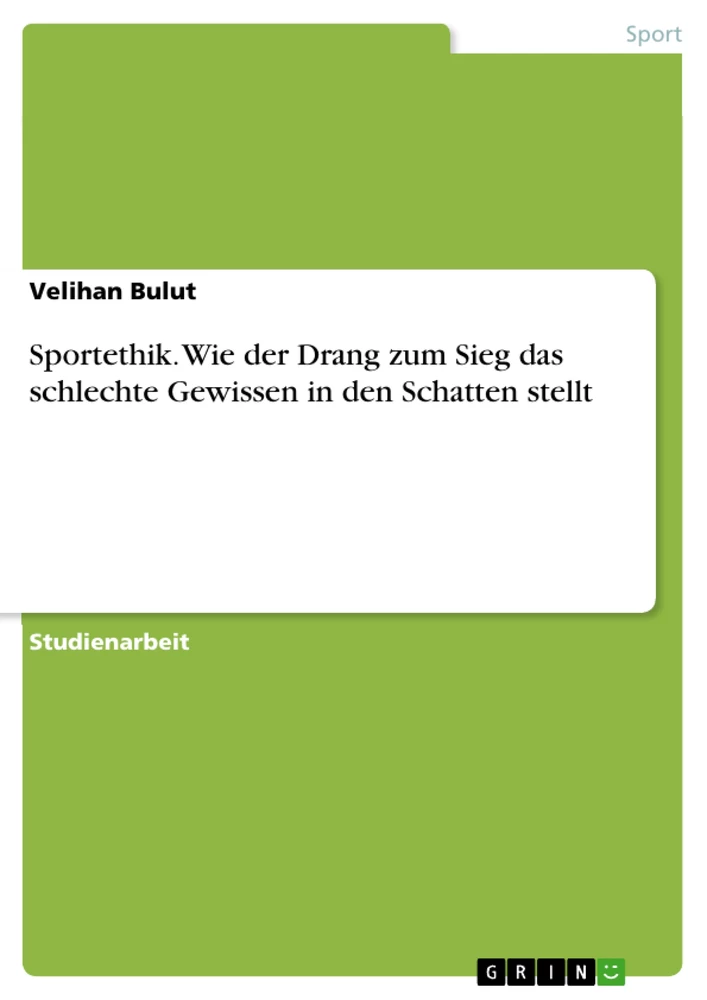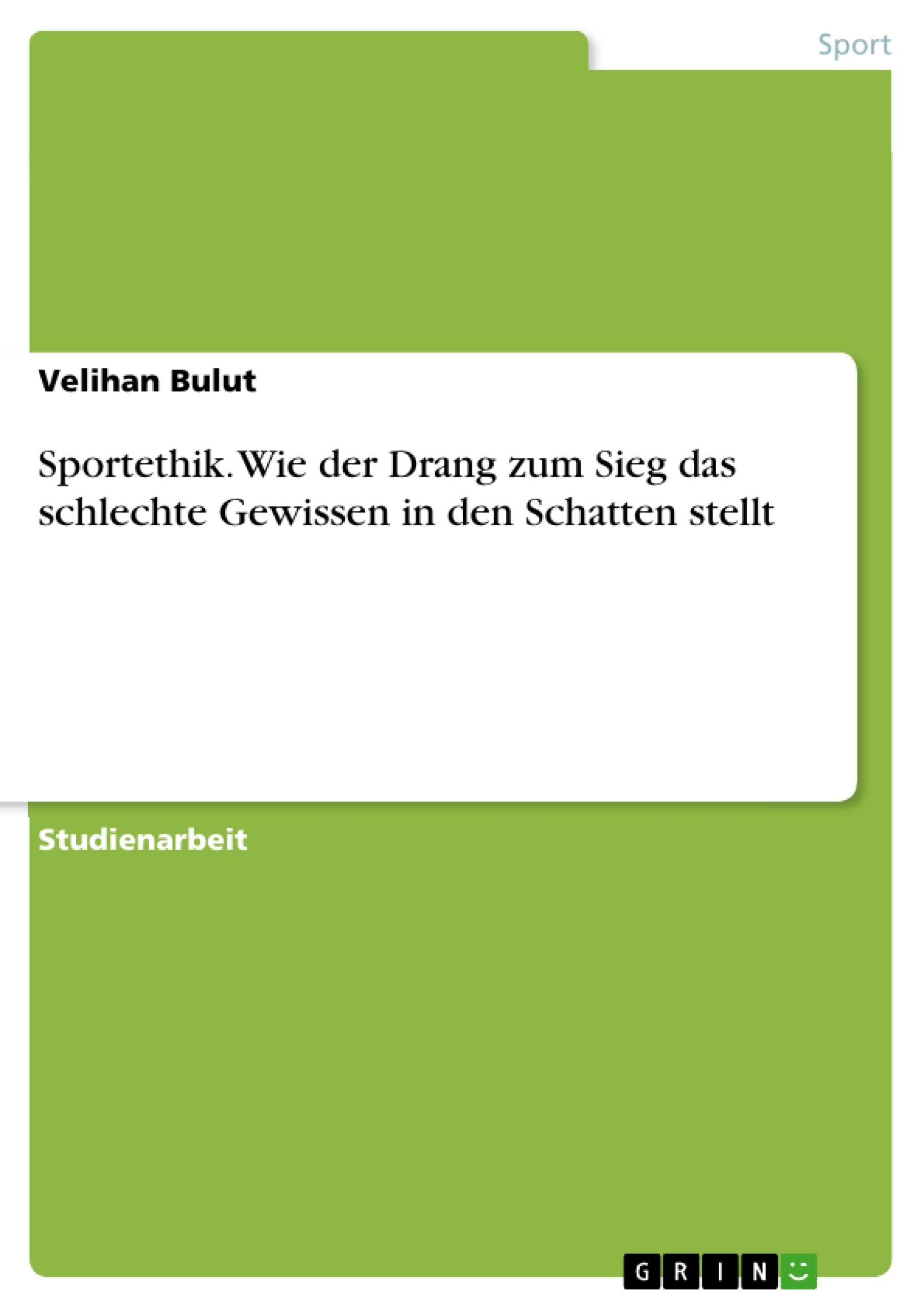Den Sport gibt es schon seit mehreren tausend Jahren, mindestens so lang wie es auch die Ethik gibt. Doch früher brachte man den Sport weniger mit der Ethik in Verbindung als heute. Das liegt daran, dass der Sport sich seit etwa Ende des 19. Jahrhunderts grundlegend verändert hat. Sport ist ursprünglich zur Erhaltung der Gesundheit getrieben worden. Doch heute haben die Mediatisierung, die Medikalisierung und die Kommerzialisierung den Sport stark beeinflusst.1 Der Gedanke an den Sieg und dessen positiven Folgen haben das schlechte Gewissen unterdrückt, wie man es auch bei den verschiedenen Dopingskandalen in den Medien zu sehen kriegt. Trotz Sperren und Strafen ihrer Gegner, nehmen sie diese nicht als exemplarisches Beispiel und entscheiden sich ebenfalls für das Doping. Ohne Rücksicht auf Gesundheit, Karriere und Fairness spritzen sie sich oder nehmen Medikamente, und haben bei ihrer Missetat nur Ruhm und Reichtum im Kopf. Doch einige ethische Fragen an die Sportler bleiben unbeantwortet:
o Fanden die Sportler das Training für unzureichend und haben sie sich deshalb gedopt?
o Oder hatten die Sportler beim Verlieren das Gefühl, abseits von den Besseren zu stehen, und haben sie sich deshalb gezwungen gefühlt, ein Mitläufer zu werden?
o Hatte sie schon vom Anfang ihrer Sportkarriere die böse Absicht, oder hat der Drang zum Sieg dazu geführt, den Fairnessgedanken aus dem Auge zu blenden?
Hatten sie nach ihren Siegen kein schlechtes Gewissen? Schließlich haben sie betrogen und sich nichts verdient.
Ich versetzte mich in deren Lage und dachte mir, wenn ich ein Spitzensportler wäre, ob ich dopingfrei bleiben würde, oder ob sich bei mir der Druck und die Belastung durchschlagen hätten und mich überredet hätten, mich dem Doping zuzuneigen. Denn schließlich würde ich meine Karriere, meine Gesundheit, mein Ansehen und vieles mehr verlieren und mich und den Sport in das Elend ziehen. Nun wollte ich genaueres zu diesem Thema wissen, und entschied mich, das Dopingproblem ethisch zu hinterfragen.
Zum Inhalt der Seminararbeit lässt sich sagen, dass sie unter sportethischen Aspekten die Dopingproblematik verdeutlichen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Information
- Dopingdefinition
- Geschichte des Dopings
- Ethik und dessen Beziehung zum Sport
- Sportethik
- Fairness und Chancengleichheit
- Gesundheit
- Das Dilemma zwischen Erfolg und Werten des Sports
- Doping aus der Sicht der Befürworter
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Problematik des Dopings im Sport unter sportethischen Aspekten. Sie analysiert die Definitionen und Geschichte des Dopings und beleuchtet die ethischen Dimensionen des Themas. Die Arbeit untersucht die Argumente für und gegen ein Dopingverbot, wobei die Themen Fairness und Chancengleichheit, Gesundheitsschutz sowie das Dilemma zwischen Erfolg und Werten des Sports im Vordergrund stehen.
- Dopingdefinitionen und ihre Entwicklung
- Ethische Aspekte des Dopings
- Fairness und Chancengleichheit im Sport
- Gesundheitliche Folgen des Dopings
- Das Dilemma zwischen Erfolg und Werten des Sports
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Doping im Sport ein und beleuchtet die Veränderungen des Sports im Laufe der Zeit. Die Kommerzialisierung, Mediatisierung und Medikalisierung haben den Sport stark beeinflusst und den Druck auf Sportler erhöht, erfolgreich zu sein. Die Einleitung stellt die ethischen Fragen, die sich aus der Nutzung von Doping ergeben, und die Motivation des Autors, sich mit dem Thema zu befassen.
- Allgemeine Information
- Dopingdefinition
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Doping. Es beschreibt die Entwicklung der Dopingdefinitionen von den frühen Definitionen des Deutschen Sportbundes bis zur aktuellen Definition des World Anti-Doping Code (WADC) der WADA. Der WADC ist die offiziell anerkannte Definition und beinhaltet eine umfangreiche Liste von verbotenen Substanzen und Methoden.
- Geschichte des Dopings
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Dopings, die bis in die Antike zurückreicht. Es werden die drei entscheidenden Aspekte der Kommerzialisierung, Mediatisierung und Medikalisierung des Sports hervorgehoben, die den Wert des Dopings in der heutigen Zeit verändert haben. Die Kommerzialisierung hat das Interesse am Sport gesteigert, die Mediatisierung hat den Druck auf Sportler erhöht, erfolgreich zu sein, und die Medikalisierung hat die Bedeutung des Gesundheitsschutzes im Sport verstärkt.
- Ethik und dessen Beziehung zum Sport
Dieses Kapitel erläutert den Begriff „Ethik" und seine Beziehung zum Sport. Es wird argumentiert, dass die Entwicklung des Sports, insbesondere durch die Kommerzialisierung, Mediatisierung und Medikalisierung, die Ethik im Sport immer wichtiger gemacht hat. Die ethischen Prinzipien des Sports, wie Fairness und das Streben nach Leistung durch Training, stehen im Konflikt mit der Nutzung von Doping.
- Dopingdefinition
- Sportethik
- Fairness und Chancengleichheit
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung von Fairness und Chancengleichheit im Sport. Es wird argumentiert, dass Doping die Chancengleichheit untergräbt, da es Sportlern einen unfairen Vorteil verschafft. Die Einhaltung der Spielregeln und die gleiche Startchance für alle Sportler sind entscheidend für einen fairen Wettkampf. Die Dopingfreigabe würde die Fairness im Sport zerstören und den Fokus auf die Herstellung von leistungssteigernden Substanzen verlagern. Fairness gegenüber Gegnern und Zuschauern wird ebenfalls beleuchtet.
- Gesundheit
Dieses Kapitel befasst sich mit den gesundheitlichen Folgen des Dopings. Doping ist für den menschlichen Körper schädlich und kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, bis hin zum Tod. Die Gesundheit des Sportlers sollte immer an erster Stelle stehen, selbst wenn dies bedeutet, die Karriere zu beenden oder zu verändern. Das Leben ist vergänglich und die Gesundheit ist ein hohes Gut, das nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden sollte.
- Das Dilemma zwischen Erfolg und Werten des Sports
Dieses Kapitel beschreibt das Dilemma, dem Sportler oft gegenüberstehen, wenn sie zwischen Erfolg und den Werten des Sports wählen müssen. Es wird das Beispiel eines jungen Sportlers angeführt, der vor der Entscheidung steht, ob er Doping verwenden soll, um im Finalrennen zu gewinnen. Der Druck, erfolgreich zu sein, kann dazu führen, dass Sportler sich für den falschen Weg entscheiden, ohne die langfristigen Folgen zu bedenken. Die Werte des Sports sollten für Sportler das höchste Gebot sein, da sie die Grundlage für eine lange und erfolgreiche Karriere bilden.
- Doping aus der Sicht der Befürworter
Dieses Kapitel beleuchtet die Sichtweise der Dopingbefürworter. Es wird dargelegt, dass Dopingbefürworter ihre Handlungen oft mit moralischen Argumenten rechtfertigen, um ihr schlechtes Gewissen zu unterdrücken. Die Argumentation der Dopingbefürworter wird aus der Sicht von Sportlern, Trainern und Ärzten analysiert. Es wird betont, dass die Werte des Sports und die Gesundheit des Sportlers wichtiger sind als kurzfristiger Erfolg.
- Fairness und Chancengleichheit
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
- Quote paper
- Velihan Bulut (Author), 2011, Sportethik. Wie der Drang zum Sieg das schlechte Gewissen in den Schatten stellt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262652